 Seite drucken
Seite drucken
 Entscheidung als PDF runterladen
Entscheidung als PDF runterladen
 Seite drucken
Seite drucken
 Entscheidung als PDF runterladen
Entscheidung als PDF runterladen

1. Ist das Verhältnis von vorläufiger Veranlagung zur Abrechnung eines Beitragsjahres derart ausgestaltet,dass mit der Abrechnung lediglich insofern eine Regelung getroffen wird, als hierin eine Differenz zu der vorangegangenen vorläufigen Veranlagung aufgrund einer Änderung der steuerlichen Bemessungsgrundlage ausgewiesen wird, enthält die Abrechnung auch keine Regelung mehr bezüglich der der grundsätzlichen Beitragspflicht des Mitglieds zugrunde liegenden Wirtschaftssatzung und Wirtschaftsplanung für das jeweilige Beitragsjahr. In der Folge ist eine Klage gegen einen Ab-rechnungsbescheid allein mit der Begründung, die Wirtschaftsplanung der IHK in diesem Beitragsjahr sei rechtswidrig gewesen, unzulässig.2. Die Nutzung einer Simulationssoftware stellt im Hinblick auf das Gebot der Schätzgenauigkeit grundsätzlich eine geeignete Prognosemethode für die Bemessung der Höhe der Ausgleichsrücklage dar. Dass eine solche Risiko-simulation fehlerhaft wäre, ist angesichts dessen, dass den IHKen bei der Aufstellung ihres Wirtschaftsplanes ein weiter Gestaltungsspielraum zusteht und die Bildung von angemessenen Rücklagen gerade Bestandteil einer geordneten Haushaltsführung ist, von den klagenden Mitgliedern substantiiert vorzutragen.3. Gelten für die Höhe der Nettoposition dieselben Regelungen wie für die Rücklagenbildung und ist deshalb ein Wirtschaftsplan nicht nur dann rechtswidrig, wenn er eine unzulässige Erhöhung der Nettoposition vorsieht, sondern auch dann, wenn er die Nettoposition in rechtswidriger Höhe beibehält, so muss es der IHKim Rahmen ihrer jährlichen Wirtschaftsplanung möglich sein, die Nettoposition für die Zukunft wieder auf ein zulässiges Maß zurückzuführen.
Die Klage wird abgewiesen.
Die außergerichtlichen Kosten der Beklagten sowie die Gerichtskosten tragen die Klägerin zu 1. zu 352,00/22.407,92, die Klägerin zu 2. zu 352,00/22.407,92, der Kläger zu 3. zu 135,69/22.407,92, die Klägerin zu 4. zu 254,58/22.407,92, die Klägerin zu 5. zu 2.162,54/22.407,92, die Klägerin zu 6. zu 11.720,43/22.407,92, die Klägerin zu 7. zu 6.666,58/22.407,92 und die Klägerin zu 8. zu 764,00/22.407,92. Im Übrigen findet eine Kostenerstattung nicht statt.
Das Urteil ist im Verhältnis der Beklagten zu den Klägern zu 1. bis 5. sowie zu der Klägerin zu 8. wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige Vollstreckungsschuldner darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. Im Verhältnis der Beklagten zu den Klägerinnen zu 6. und 7. ist das Urteil wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages.
Die Berufung gegen das Urteil wird zugelassen.
Tatbestand:
2Die Kläger sind Mitglieder bei der Beklagten Industrie- und Handelskammer (IHK). Sie wenden sich gegen die Erhebung von IHK-Beiträgen für mehrere Jahre.
3In der Sitzung der Vollversammlung der Beklagten vom 12. Dezember 2019 beschloss die Beklagte die Wirtschaftssatzung für das Geschäftsjahr 2020. In der Wirtschaftssatzung für das Jahr 2020 wurde folgender Wirtschaftsplan zugrunde gelegt:
4„I. Wirtschaftsplan
5Der Wirtschaftsplan wird
61. in der Plan-Gewinn- und Verlustrechnung mit
7Erträgen in Höhe von 21.139.000 €
8Aufwendungen in Höhe von 23.020.000 €
9einer geplanten Vortrag in Höhe von 393.000 €
10einem Saldo der Rücklagenveränderung in Höhe von 1.488.000 €
11[…] festgestellt.“
12Als Betriebsaufwand wies die Plan-Gewinn- und Verlustrechnung (Plan-GuV) 2020 einen Betrag in Höhe von 22.400.00,00 Euro aus.
13In der Sitzung der Vollversammlung am 1. Dezember 2020 beschloss die Beklagte die Nachtragswirtschaftssatzung für das laufende Beitragsjahr 2020 sowie die Wirtschaftssatzung für das Geschäftsjahr 2021.
14In der Nachtragswirtschaftssatzung für das laufende Beitragsjahr wurde folgender Nachtragswirtschaftsplan zugrunde gelegt:
15„Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 vom 12. Dezember 2019 wird durch den Nachtrag
16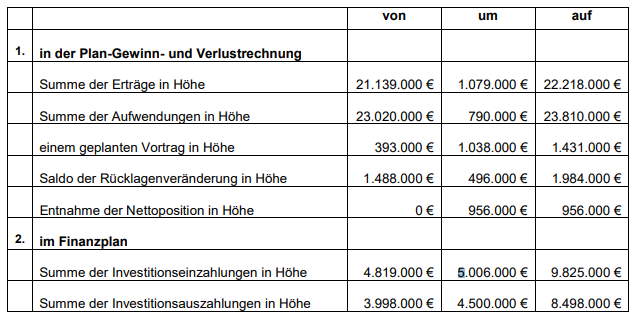
neu festgestellt. Im Übrigen bleiben die Festsetzungen der von der Vollversammlung am 12. Dezember 2019 beschlossenen Wirtschaftssatzung 2020 unverändert.“
18Als Betriebsaufwand wies der Nachtrag zur Plan-GuV 2020 einen Betrag in Höhe von 23.117.000,00 Euro aus.
19Im Nachtragswirtschaftsplan für das laufende Beitragsjahr 2020 wurde ausweislich der Erläuterungen hierzu sowie des Protokolls der Hauptversammlung vom 1. Dezember 2020 beschlossen, die ursprünglich für das Jahr 2020 in Höhe von 5.383.000,00 Euro dotierte Ausgleichsrücklage aufzulösen. Nach den neueren Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts im Januar 2020 dürfe die Ausgleichsrücklage nur noch mit Blick auf die Risiken des Folgejahres dotiert werden, nicht mehr um eine finanzielle Vorsorge, z.B. für eine mehrjährige konjunkturelle Schwächephase mit entsprechenden Beitragsverlusten, zu treffen. Ferner sei bei der Beschlussfassung eines Nachtragswirtschaftsplans für ein Geschäftsjahr, das weitgehend abgeschlossen sei, zur realitätsgerechten Kalkulation der Risiken von Beitragsausfällen erforderlich, zunächst auf die Daten des laufenden Jahres zurückzugreifen und zu überprüfen, ob und inwieweit die Beitragseinnahmen hinter den Annahmen des Wirtschaftsplans zurückblieben. Schließlich habe das Bundesverwaltungsgericht fünf von acht Positionen aus dem bundeseinheitlichen Muster-Risikokatalog als nicht rechtskonform eingestuft, sodass nur noch die drei folgenden Risikofaktoren zu berücksichtigen seien: Konjunkturelle Änderungen bei den IHK-Beiträgen, Ertragsausfälle bei den Gebühren, Rückgang von Entgelten. Eine Überprüfung anhand der vorgenannten Maßstäbe habe ergeben, dass für wesentliche Positionen der ursprünglichen Risikobewertung für das Jahr 2020 keine Restrisiken mehr bestünden bzw. diese nicht mehr in die Bewertung miteinzubeziehen seien.
20Ferner wurde beschlossen, die im Jahr 2006 in der Eröffnungsbilanz mit 2.400.000,00 Euro dotierte und zum 31. Dezember 2017 anlässlich des mit 3.600.00,00 Euro verbuchten Neubaus des Prüfungs- und Weiterbildungszentrums der IHK am Standort L. um 4.600.00,00 Euro erhöhte Nettoposition in Höhe von 956.000,00 Euro aufzulösen, wodurch sich eine Nettoposition in Höhe von 6.014.000,00 Euro ergebe. Die damalige Erhöhung sei in Höhe von 3.600.000,00 Euro aufgrund eines sachlichen Grundes im Rahmen zulässiger Kammertätigkeit erfolgt. Nach den neueren Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts im Januar 2020 sei der darüber hinausgehende Teil in Höhe von 956.000,00 Euro jedoch aufzulösen, da die Nettoposition nicht zu dem Zweck angehoben werden dürfe, langfristig gebundenes Anlagevermögen durch Erhaltung des festgesetzten Kapitals dauerhaft in seinem Bestand zu sichern oder den Wert des langfristig gebundenen Vermögens in der Nettoposition abzubilden.
21Die hierdurch frei werdenden Mittel wurden in Höhe von 4.900.000,00 Euro für die Dotierung der Baurücklage verwendet. Hierdurch sowie durch weitere Zuführungen aus ersparten Aufwendungen in Höhe von 398.000,00 Euro sollte die Baurücklage 5.298.000,00 Euro betragen. Die Dotierung der Baurücklage sei im Hinblick auf den geplanten Neubau der IHK-Geschäftsstelle Neuss mit einem Prüfungs- und Weiterbildungszentrum erfolgt. Für diesen seien nach den Ende 2010 erstellten und Ende 2020 aktualisierten Entwürfen eines Architekturbüros Kosten von rund 9.500.000,00 Euro vorgesehen. Die Fertigstellung solle zwischen 2024 und 2025 erfolgen. Im Rahmen dieser zeitlichen Perspektive solle die Baurücklage in einem ersten Schritt mit 5.298,00,00 Euro dotiert werden. Die fehlenden Mittel zur vollständigen Finanzierung seien noch aus dem erwarteten Verkaufserlös des alten IHK-Gebäudes O. (laut Wertgutachten 2.900.000,00 Euro) sowie durch weitere Zuführungen zur Baurücklage in Höhe von 1.300.000,00 Euro in den Folgejahren nach Haushaltsverfügbarkeit aufzubringen.
22In der Wirtschaftssatzung für das Jahr 2021 wurde folgender Wirtschaftsplan zugrunde gelegt:
23„I. Wirtschaftsplan
24Der Wirtschaftsplan wird
251. in der Plan-Gewinn- und Verlustrechnung mit
26Erträgen in Höhe von 22.368.000 €
27Aufwendungen in Höhe von 24.742.000 €
28einer geplanten Vortrag in Höhe von 2.779.000 €
29einem Saldo der Rücklagenveränderung in Höhe von -405.000 €
30[…] festgestellt.“
31Als Betriebsaufwand wies die Plan-GuV 2021 einen Betrag in Höhe von 24.194.000,00 Euro aus.
32Im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 wurde ausweislich des Protokolls der Hauptversammlung vom 1. Dezember 2020 beschlossen, die Ausgleichsrücklage für das Jahr 2021 in Höhe von 1.655.000,00 Euro zu dotieren sowie die übrigen frei werdenden Mittel aus der (teilweisen) Auflösung der Ausgleichsrücklage für das Jahr 2020 sowie der Nettoposition für den Ausgleich des geplanten negativen Jahresergebnisses im Jahr 2021 in Höhe von 1.124.000,00 Euro zu verwenden. Hierbei lagen der Dotierung der Ausgleichsrücklage die folgenden Erwägungen zugrunde: Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts seien einige zuvor bei der Bemessung der Ausgleichsrücklage berücksichtigte Risikofaktoren nicht mehr zu berücksichtigen. Hierzu gehöre insbesondere die betriebswirtschaftlich sinnvolle finanzielle Risikovorsorge für mehrere Jahre. In der Folge würden nur noch folgende drei Risikofaktoren berücksichtigt: Konjunkturelle Änderungen bei den IHK-Beiträgen, Ertragsausfälle bei den Gebühren, Rückgang bei den Entgelten. Die Risikobewertung werde jährlich unter Berücksichtigung der Empfehlungen des bundesweiten Arbeitskreises des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) aktualisiert. Die bei einem Risikoereignis erwartete Schadenssumme sei wie in den Vorjahren mit der allen IHKen vom DIHK zur Verfügung gestellten Simulationssoftware „@Risk“ berechnet worden. Wesentlich für die Berechnung der über die Ausgleichsrücklage zu deckenden Risikosumme sei hierbei die Wahl des Konfidenzniveaus. Bislang sei hierfür in Anlehnung an die Empfehlung des DIHK-Arbeitskreises die Auswahl von 95% getroffen worden, mit dem unter anderem Versicherungen im Bereich der Schadensregulierung arbeiteten. Die aktuelle Überprüfung der Ausgleichsrücklage sei auch mit Blick auf die Historie der letzten zwölf Jahre angestellt worden. Dies habe ergeben, dass sich die sehr teuren Schadensereignisse über 90% des Konfidenzniveaus bei der Beklagten bisher nicht annähernd realisiert hätten. Aus diesem Grunde sei ein Konfidenzniveau von 90% zugrunde gelegt worden. Hiermit errechne sich ein Risiko in Höhe von 1.655.277,00 Euro für das Jahr 2021, welches durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden solle.
33Jahresbeitrag |
mit früheren Bescheiden festgesetzt |
mit diesem Bescheid festgesetzt |
Saldo |
|
IHK-Beitrag 2020 – vorläufige Veranlagung |
||||
Bemessungsgrundlage Gewerbeertrag: 0,00 |
||||
Grundbeitrag |
176,00 |
|||
Umlage: Bemessungsgrundlage * Hebesatz 0,200% |
0,00 |
|||
Summe Beitragsjahr |
176,00 |
0,00 |
176,00 |
176,00 |
Unter dem 24. Januar 2020 erließ die Beklagte gegen die Klägerin zu 1. einen Beitragsbescheid mit im Wesentlichen folgendem Inhalt:
35Unter dem 2. März 2021 erließ die Beklagte gegen die Klägerin zu 1. einen Beitragsbescheid mit im Wesentlichen folgendem Inhalt:
36Jahresbeitrag |
mit früheren Bescheiden festgesetzt |
mit diesem Bescheid festgesetzt |
Saldo |
|
IHK-Beitrag 2021 – vorläufige Veranlagung |
||||
Bemessungsgrundlage Gewerbeertrag: 0,00 |
||||
Grundbeitrag |
176,00 |
|||
Umlage: Bemessungsgrundlage * Hebesatz 0,200% |
0,00 |
|||
Summe Beitragsjahr |
176,00 |
0,00 |
176,00 |
176,00 |
Unter dem 2. März 2021 erließ die Beklagte gegen die Klägerin zu 2. einen Beitragsbescheid mit im Wesentlichen folgendem Inhalt:
38Jahresbeitrag |
mit früheren Bescheiden festgesetzt |
mit diesem Bescheid festgesetzt |
Saldo |
|
IHK-Beitrag 2018 – Abrechnung |
||||
Bemessungsgrundlage Gewerbeertrag 2018: 0,00 |
||||
Grundbeitrag |
176,00 |
|||
Umlage: Bemessungsgrundlage * Hebesatz 0,200% |
0,00 |
|||
Summe Beitragsjahr |
176,00 |
176,00 |
0,00 |
0,00 |
IHK-Beitrag 2020 – vorläufige Veranlagung |
||||
Bemessungsgrundlage Gewerbeertrag 2017: 0,00 |
||||
Grundbeitrag |
176,00 |
|||
Umlage: Bemessungsgrundlage * Hebesatz 0,200% |
0,00 |
|||
Summe Beitragsjahr |
176,00 |
0,00 |
176,00 |
176,00 |
IHK-Beitrag 2021 – vorläufige Veranlagung |
||||
Bemessungsgrundlage Gewerbeertrag 2018: 0,00 |
||||
Grundbeitrag |
176,00 |
|||
Umlage: Bemessungsgrundlage * Hebesatz 0,190% |
0,00 |
|||
Summe Beitragsjahr |
176,00 |
0,00 |
176,00 |
176,00 |
Unter dem 12. Februar 2021 erließ die Beklagte gegen den Kläger zu 3. einen Beitragsbescheid mit im Wesentlichen folgendem Inhalt:
40Jahresbeitrag |
mit früheren Bescheiden festgesetzt |
mit diesem Bescheid festgesetzt |
Saldo |
|
IHK-Beitrag 2018 – Abrechnung |
||||
Bemessungsgrundlage Gewerbeertrag 2018: 25.600,00 |
||||
Grundbeitrag |
89,00 |
|||
Umlage: Bemessungsgrundlage * Hebesatz 0,200% |
20,52 |
|||
Summe Beitragsjahr |
109,52 |
82,32 |
27,20 |
27,20 |
IHK-Beitrag 2021 – vorläufige Veranlagung |
||||
Bemessungsgrundlage Gewerbeertrag 2018: 25.600,00 |
||||
Grundbeitrag |
89,00 |
|||
Umlage: Bemessungsgrundlage * Hebesatz 0,190% |
19,49 |
|||
Summe Beitragsjahr |
108,49 |
0,00 |
108,49 |
108,49 |
Unter dem 12. Februar 2021 erließ die Beklagte gegen die Klägerin zu 4. einen Beitragsbescheid mit im Wesentlichen folgendem Inhalt:
42Jahresbeitrag |
mit früheren Bescheiden festgesetzt |
mit diesem Bescheid festgesetzt |
Saldo |
|
IHK-Beitrag 2017 – berichtigte Abrechnung |
||||
Bemessungsgrundlage Gewerbeertrag 2017: 88.200,00 |
||||
Grundbeitrag |
176,00 |
|||
Umlage: Bemessungsgrundlage * Hebesatz 0,200% |
145,72 |
|||
Summe Beitragsjahr |
321,72 |
321,72 |
0,00 |
0,00 |
IHK-Beitrag 2018 – berichtigte Abrechnung |
||||
Bemessungsgrundlage Gewerbeertrag 2018: 56.700,00 |
||||
Grundbeitrag |
176,00 |
|||
Umlage: Bemessungsgrundlage * Hebesatz 0,200% |
82,72 |
|||
Summe Beitragsjahr |
258,72 |
290,72 |
-32,00 |
-32,00 |
IHK-Beitrag 2021 – vorläufige Veranlagung |
||||
Bemessungsgrundlage Gewerbeertrag 2018: 56.700,00 |
||||
Grundbeitrag |
176,00 |
|||
Umlage: Bemessungsgrundlage * Hebesatz 0,190% |
78,58 |
|||
Summe Beitragsjahr |
254,58 |
0,00 |
254,58 |
254,58 |
Unter dem 2. März 2021 erließ die Beklagte gegen die Klägerin zu 5. einen Beitragsbescheid mit im Wesentlichen folgenden Inhalt:
44Jahresbeitrag |
mit früheren Bescheiden festgesetzt |
mit diesem Bescheid festgesetzt |
Saldo |
|
IHK-Beitrag 2013 – berichtigte Abrechnung |
||||
Bemessungsgrundlage Gewerbeertrag 2013: 121.400,00 |
||||
Grundbeitrag |
265,00 |
|||
Umlage: Bemessungsgrundlage * Hebesatz 0,110% |
133,54 |
|||
Summe Beitragsjahr |
398,54 |
454,97 |
-56,43 |
398,54 |
IHK-Beitrag 2017 – Abrechnung |
||||
Bemessungsgrundlage Gewerbeertrag 2017: 515.900,00 |
||||
Grundbeitrag |
353,00 |
|||
Umlage: Bemessungsgrundlage * Hebesatz 0,200% |
1.031,80 |
|||
Summe Beitragsjahr |
1.384,80 |
176,00 |
1.208,80 |
1.384,80 |
IHK-Beitrag 2018 – Abrechnung |
||||
Bemessungsgrundlage Gewerbeertrag 2018: 189.100,00 |
||||
Grundbeitrag |
353,00 |
|||
Umlage: Bemessungsgrundlage * Hebesatz 0,200% |
378,20 |
|||
Summe Beitragsjahr |
731,20 |
176,00 |
555,20 |
731,20 |
Unter dem 2. März 2021 erließ die Beklagte gegen die Klägerin zu 6. einen Beitragsbescheid mit im Wesentlichen folgenden Inhalt:
46Jahresbeitrag |
mit früheren Bescheiden festgesetzt |
mit diesem Bescheid festgesetzt |
Saldo |
|
IHK-Beitrag 2013 – berichtigte Abrechnung |
||||
Bemessungsgrundlage Gewerbeertrag 2013: 1.117.800,00 |
||||
Grundbeitrag |
265,00 |
|||
Umlage: Bemessungsgrundlage * Hebesatz 0,110% |
1.212,71 |
|||
Summe Beitragsjahr |
1.477,71 |
132,00 |
1.345,71 |
1.477,71 |
IHK-Beitrag 2017 – berichtigte Abrechnung |
||||
Bemessungsgrundlage Gewerbeertrag 2017: 5.114.200,00 |
||||
Grundbeitrag |
353,00 |
|||
Umlage: Bemessungsgrundlage * Hebesatz 0,200% |
10.197,72 |
|||
Summe Beitragsjahr |
10.550,72 |
176,00 |
10.374,72 |
10.550,72 |
Unter dem 2. März 2021 erließ die Beklagte gegen die Klägerin zu 7. zwei Beitragsbescheide mit im Wesentlichen folgenden Inhalt:
48Jahresbeitrag |
mit früheren Bescheiden festgesetzt |
mit diesem Bescheid festgesetzt |
Saldo |
|
IHK-Beitrag 2005 – berichtigte Abrechnung |
||||
Bemessungsgrundlage Gewerbeertrag 2005: 2.323.590,80 |
||||
Grundbeitrag |
385,00 |
|||
Umlage: Bemessungsgrundlage * Hebesatz 0,250% |
5.808,98 |
|||
Summe Beitragsjahr |
6.193,98 |
7.218,23 |
-1.024,25 |
1.450,86 |
IHK-Beitrag 2006 – berichtigte Abrechnung |
||||
Bemessungsgrundlage Gewerbeertrag 2006: 2.665.458,00 |
||||
Grundbeitrag |
385,00 |
|||
Umlage: Bemessungsgrundlage * Hebesatz 0,250% |
6.663,65 |
|||
Summe Beitragsjahr |
7.048,65 |
6.025,48 |
1.023,17 |
6.187,51 |
IHK-Beitrag 2013 – berichtigte Abrechnung |
||||
Bemessungsgrundlage Gewerbeertrag 2013: 12.516,85 |
||||
Grundbeitrag |
132,00 |
|||
Umlage: Bemessungsgrundlage * Hebesatz 0,110% |
13,77 |
|||
Summe Beitragsjahr |
145,77 |
132,00 |
13,77 |
13,77 |
Jahresbeitrag |
mit früheren Bescheiden festgesetzt |
mit diesem Bescheid festgesetzt |
Saldo |
|
IHK-Beitrag 2017 – berichtigte Abrechnung |
||||
Bemessungsgrundlage Gewerbeertrag 2017: 844.469,14 |
||||
Grundbeitrag |
353,00 |
|||
Umlage: Bemessungsgrundlage * Hebesatz 0,200% |
1.688,94 |
|||
Summe Beitragsjahr |
2.041,94 |
176,00 |
1.865,94 |
1.865,94 |
IHK-Beitrag 2018 – Abrechnung |
||||
Bemessungsgrundlage Gewerbeertrag 2018: 305.581,42 |
||||
Grundbeitrag |
353,00 |
|||
Umlage: Bemessungsgrundlage * Hebesatz 0,200% |
611,16 |
|||
Summe Beitragsjahr |
964,16 |
176,00 |
788,16 |
788,16 |
IHK-Beitrag 2020 – vorläufige Veranlagung |
||||
Bemessungsgrundlage Gewerbeertrag 2017: 844.469,14 |
||||
Grundbeitrag |
353,00 |
|||
Umlage: Bemessungsgrundlage * Hebesatz 0,200% |
1.688,94 |
|||
Summe Beitragsjahr |
2.041,94 |
0,00 |
2.041,94 |
2.041,94 |
IHK-Beitrag 2021 – vorläufige Veranlagung |
||||
Bemessungsgrundlage Gewerbeertrag 2018: 305.581,42 |
||||
Grundbeitrag |
353,00 |
|||
Umlage: Bemessungsgrundlage * Hebesatz 0,190% |
580,60 |
|||
Summe Beitragsjahr |
933,60 |
0,00 |
933,60 |
933,60 |
Unter dem 2. März 2021 erließ die Beklagte gegen die Klägerin zu 8. einen Beitragsbescheid mit im Wesentlichen folgenden Inhalt:
51Jahresbeitrag |
mit früheren Bescheiden festgesetzt |
mit diesem Bescheid festgesetzt |
Saldo |
|
IHK-Beitrag 2018 – Abrechnung |
||||
Bemessungsgrundlage Gewerbeertrag 2018: 60.000,00 |
||||
Grundbeitrag |
265,00 |
|||
Umlage: Bemessungsgrundlage * Hebesatz 0,200% |
120,00 |
|||
Summe Beitragsjahr |
385,00 |
176,00 |
209,00 |
209,00 |
IHK-Beitrag 2020 – vorläufige Veranlagung |
||||
Bemessungsgrundlage Gewerbeertrag 2017: 0,00 |
||||
Grundbeitrag |
176,00 |
|||
Umlage: Bemessungsgrundlage * Hebesatz 0,200% |
0,00 |
|||
Summe Beitragsjahr |
176,00 |
0,00 |
176,00 |
176,00 |
IHK-Beitrag 2021 – vorläufige Veranlagung |
||||
Bemessungsgrundlage Gewerbeertrag 2018: 60.000,00 |
||||
Grundbeitrag |
265,00 |
|||
Umlage: Bemessungsgrundlage * Hebesatz 0,190% |
114,00 |
|||
Summe Beitragsjahr |
379,00 |
0,00 |
379,00 |
379,00 |
Sämtliche Bescheide enthielten den Satz: „Wenn zu den oben ausgeführten Beitragsjahren bereits Beitragsbescheide ergangen sind, werden diese durch den aktuellen Bescheid nicht aufgehoben.“
53Gegen den an sie gerichteten Bescheid vom 24. Januar 2020 hat die Klägerin zu 1. am 11. Februar 2020 Klage erhoben (20 K 730/20), gegen den Bescheid vom 2. März 2021 am 5. April 2021 (20 K 2227/21).
54Gegen den an sie gerichteten Bescheid vom 2. März 2021 hat die Klägerin zu 2. am 8. April 2021 Klage erhoben (20 K 2311/21), diese jedoch auf die Beitragsjahre 2020 und 2021 beschränkt.
55Gegen den an ihn gerichteten Beitragsbescheid vom 12. Februar 2021 hat der Kläger zu 3. am 10. März 2021 Klage erhoben (20 K 1527/21).
56Gegen den an sie gerichteten Beitragsbescheid vom 12. Februar 2021 hat die Klägerin zu 4. am 15. März 2021 Klage erhoben (20 K 1926/21), diese jedoch auf das Beitragsjahr 2021 beschränkt.
57Gegen den an sie gerichteten Beitragsbescheid vom 2. März 2021 hat die Klägerin zu 5. am 5. April 2021 Klage erhoben (20 K 2222/21).
58Gegen den an sie gerichteten Beitragsbescheid vom 2. März 2021 hat die Klägerin zu 6. am 5. April 2021 Klage erhoben (20 K 2223/21).
59Gegen die an sie gerichteten Beitragsbescheide vom 2. März 2021 hat die Klägerin zu 7. am 5. April 2021 Klage erhoben, diese jedoch auf die Beitragsjahre 2006, 2013 (20 K 2224/21), 2017, 2018, 2020 und 2021 (20 K 2225/21) beschränkt.
60Gegen den an sie gerichteten Beitragsbescheid vom 2. März 2021 hat die Klägerin zu 8. am 5. April 2021 Klage erhoben (20 K 2226/21).
61Die Verfahren sind mit Beschluss vom 18. Mai 2022 zur gemeinsamen Entscheidung unter dem Aktenzeichen 20 K 730/20 verbunden worden.
62Zur Begründung ihrer Klagen verweisen die Kläger auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 9. Dezember 2015 (BVerwG 10 C 6.15), wonach eine pauschale Festlegung von Rücklagen ohne konkrete jährliche Risikoabschätzung unzulässig sei. Angesichts der im Nachgang der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ergangenen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Düsseldorf zu den Beitragsjahren 2011 bis 2016 sei eine erneute Abrechnung der betroffenen Beitragsjahre geradezu anstößig. Bezüglich des Jahres 2006 könne die Beklagte nicht ernsthaft behaupten, ihre Wirtschaftsführung, Rücklagenbildung und Bedarfsabschätzung zur Rücklagenbildung für dieses Jahr sei nicht mit den gleichen Makeln behaftet, wie dies nach den Feststellungen des Verwaltungsgerichts Düsseldorf für die Jahre 2011 bis 2016 der Fall gewesen sei.
63Konkret sei hier die unzulässige Anhebung der Nettoposition um 4.529.073,79 zum 31. Dezember 2017 zu nennen. Dass die Beklagte mit Beschluss über einen Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2020 der Nettoposition 956.000,00 Euro entnommen habe, zeige, dass sie die Rechtswidrigkeit ihrer damaligen Vermögensbildung selbst eingestehe. Soweit der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 diese unzulässige Erhöhung schone, führe diese zur Rechtswidrigkeit der Beitragserhebung. Diese rechtswidrige Erhöhung wirke auch unter Berücksichtigung des Prinzips der Jährlichkeit fort, bis sie nicht gänzlich rückgängig gemacht worden sei. Der Versuch der Beklagten, die damals rechtswidrige Anhebung der Nettoposition nunmehr durch eine neu erdachte Begründung im Zusammenhang mit der Aufstellung des Nachtragswirtschaftsplans 2020 zu rechtfertigen, sei unzulässig. Für die Rücklagenbildung seien nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts die ex-ante-Perspektive sowie die zum Zeitpunkt der Rücklagenbildung tatsächlich vorliegenden Tatsachen zugrunde zu legen. Auch anhand der Bilanzen zeige sich, dass die Gründe, die die Beklagte nun zur Rechtfertigung vortrage, nichts mit der Realität zu tun hätten. Erstens sei die Finanzierung des neu errichteten Prüfungs- und Weiterbildungszentrums mit der Bilanz des Jahres 2016 bereits vollständig abgebildet gewesen. Aufgrund dieses zeitlichen Versatzes zwischen der Erhöhung der Nettoposition und der Aktivierung des Prüfungs- und Weiterbildungszentrums sei die Erhöhung der Nettoposition aus anderen Mitteln erfolgt. Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund, dass die für den Bau des Prüfungs- und Weiterbildungszentrums aufgebaute Baurücklage trotz der Aktivierung des Wertes des unbeweglichen Vermögens zum 31. Dezember 2016 auch im Jahr 2017 zunächst noch nahezu unvermindert fortbestanden habe. Sie habe damit gerade nicht mehr einem sachlichen Zweck, sondern allein dem – nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts unzulässigen – Zweck gedient, das langfristig gebundene Anlagevermögen durch die Erhöhung des festgesetzten Kapitals dauerhaft in seinem Bestand zu sichern bzw. den Wert des langfristig gebundenen Vermögens in der Nettoposition abzubilden. Zweitens beziffere die Beklagte Kosten in Höhe von 3.600.000,00 Euro als rechtfertigenden Grund für die Erhöhung der Nettoposition; tatsächlich weise die Bilanz des Jahres 2016 jedoch nur eine Erhöhung von 3.470.473,00 Euro aus. Drittens sei der Wert des unbeweglichen Sachanlagevermögens in der Bilanz zum 31. Dezember 2017 sogar geringfügig um 117.259,00 Euro gesunken.
64Auch die Ausgleichsrücklage sei zu hoch dotiert. Das Bundesverwaltungsgericht habe in seinen aktuellen Entscheidungen das von der Beklagten genutzte „risk-tool“ als Maßstab für die gerichtliche Kontrolle behördlicher Prognosen als ungeeignet bezeichnet. Für die von der Beklagten durchgeführte Risikobewertung habe sie lediglich Unterlagen unter der Überschrift „IHK RISIKOKATALOG 2020 L. “ vorgelegt. Für das Jahr 2020 habe es aber nach der Auflösung der Ausgleichsrücklage im Nachtragswirtschaftsplan keiner Risikoprognose mehr bedurft. Für das Jahr 2021 fehlten entsprechende Unterlagen. Bezögen sich die vorgelegten Unterlagen auf das Jahr 2021, falle auf, dass die Risikoerfassung das Datum „13. August 2020“ trage, also weit vor dem Beschluss der Vollversammlung im Dezember 2020 abgeschlossen worden sei. Sie könne daher nicht dem rechtlichen Anspruch genügen, bestmögliche und naheliegende Quellen der Informationsgewinnung zu nutzen. Für ihre Behauptungen, die bei der Anwendung des „risk-tools“ verwendeten Daten beruhten auf den besten vorliegenden und verfügbaren Informationen und sie passe die Nutzung des „risk-tools“ ständig aktuellen Erkenntnissen und Vorgaben aus der Rechtsprechung an, habe die Beklagte keinerlei Unterlagen vorgelegt. Zudem widerspreche die Datierung der Risikoerfassung auf den „13. August 2020“ diesen Behauptungen. Insgesamt sei die Beklagte aufgrund der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gezwungen gewesen, ihre Ausgleichsrücklage neu zu bewerten und weitestgehend aufzulösen. Dies sei erkennbar nicht geschehen, stattdessen habe die Beklagte die frei werdenden Mittel in andere Rücklagen „umgetopft“. Es werde bestritten, dass hierfür eine Rechtfertigung bestanden habe.
65Die Verwendung der durch die aufgrund des Nachtragswirtschaftsplanes für das Jahr 2020 frei werdenden Mittel für die Kostendeckung im Jahr 2021 (Dotierung der Ausgleichsrücklage 2021; negatives Planergebnis 2021) verstoße gegen den Grundsatz der Jährlichkeit. Es sei offensichtlich rechtswidrig, die Mittelbedarfsfeststellung für das Jahr 2021 so anzusetzen, dass sich ein negatives Ergebnis ergebe, welches durch Einnahmen aus Vorjahren gedeckt werden solle. Die durch die Rechtsprechung erzwungenen Auflösungen der rechtswidrig gebildeten Rücklagen stünden den Beitragszahlern zu, deren Beiträge zur Bildung dieser Rücklagen herangezogen worden seien. Durch eine Verwendung dieser freiwerdenden Mittel zur Vermeidung zukünftiger Beitragserhöhungen, werde der Zeitpunkt der Beitragsbelastung verschoben, was nicht mehr vom Gestaltungsspielraum der Beklagten erfasst sei. Denn diese dürfe nur so viel an Beiträgen erheben, wie erforderlich.
66Die massive Erhöhung der Baurücklage, die die Beklagte mit Beschluss vom 1. Dezember 2020 vorgenommen habe, verstoße gegen das Äquivalenzprinzip und den Gleichheitsgrundsatz. Die dafür benötigten Mittel seien zum großen Teil ad hoc in Abweichung von der bisherigen Wirtschaftsplanung bereitgestellt worden. Hierdurch seien die Beitragszahler ganz weniger Jahre zur Finanzierung eines Gebäudes herangezogen worden, welches über Jahrzehnte künftigen Kammermitgliedern zur Verfügung stehen werde, die gar nicht oder nur in ganz geringem Maße zur Mitfinanzierung herangezogen worden seien. Ferner werde bestritten, dass die für die Bildung einer Baurücklage in Höhe von 5.300.00,00 Euro notwendigen Voraussetzungen vorlägen. Die Beklagte habe hierzu keinerlei Unterlagen vorgelegt.
67Die Klägerin zu 1. beantragt,
68die an sie gerichteten Beitragsbescheide vom 24. Januar 2020 und 3. März 2021 aufzuheben.
69Die Klägerin zu 2. beantragt,
70den an sie gerichteten Beitragsbescheid vom 2. März 2021 aufzuheben, soweit die Beklagte für die Jahre 2020 und 2021 im Wege der vorläufigen Veranlagung jeweils einen Betrag in Höhe von 176,00 Euro veranlagt hat.
71Der Kläger zu 3. beantragt,
72den an ihn gerichteten Beitragsbescheid vom 12. Februar 2021 aufzuheben.
73Die Klägerin zu 4. beantragt,
74den an sie gerichteten Beitragsbescheid vom 12. Februar 2021 aufzuheben, soweit die Beklagte für das Jahr 2021 im Wege der vorläufigen Veranlagung einen Betrag in Höhe von 254,58 Euro veranlagt hat.
75Die Klägerin zu 5. beantragt,
76den an sie gerichteten Beitragsbescheid vom 2. März 2021 aufzuheben, soweit die Beklagte für das Jahr 2013 im Wege der berichtigten Abrechnung einen Betrag von 398,54 Euro, für das Jahr 2017 im Wege der Abrechnung einen Betrag von 1.208,80 Euro und für das Jahr 2018 im Wege der Abrechnung einen Betrag in Höhe von 555,20 Euro veranlagt hat.
77Die Klägerin zu 6. beantragt,
78den an sie gerichteten Beitragsbescheid vom 2. März 2021 aufzuheben.
79Die Klägerin zu 7. beantragt,
80die an sie gerichteten Beitragsbescheide vom 12. Februar 2021 aufzuheben, soweit die Beklagte für das Jahr 2006 im Wege der berichtigten Abrechnung einen Betrag von 1.023,17 Euro, für das Jahr 2013 im Wege der berichtigten Abrechnung einen Betrag von 132,00 Euro sowie für das Jahr 2017 im Wege der berichtigten Abrechnung einen Betrag in Höhe von 1.865,94 Euro, für das Jahr 2018 im Wege der Abrechnung einen Betrag in Höhe von 788,16 Euro, für das Jahr 2020 im Wege der vorläufigen Veranlagung einen Betrag in Höhe von 2.041,94 und für das Jahr 2021 im Wege der vorläufigen Veranlagung einen Betrag in Höhe von 933,60 Euro veranlagt hat.
81Die Klägerin zu 8. beantragt,
82den an sie gerichteten Beitragsbescheid vom 2. März 2021 aufzuheben.
83Die Beklagte beantragt in allen Verfahren,
84die Klage abzuweisen.
85Das Vorbringen der Klägerin sei unsubstantiiert. Es werde pauschal auf die Rechtsprechung verwiesen, ohne einen Bezug zum konkreten Fall herzustellen.
86Unabhängig von der Rechtmäßigkeit der ursprünglichen Wirtschaftsplanung für das Jahr 2020 bestehe nach der Nachtragswirtschaftsplanung für das Jahr 2020 kein Angriffspunkt mehr für die Klägerin. Im Rahmen der Aufstellung des Nachtragswirtschaftsplans 2020 habe die Beklagte – den Vorgaben zum Jährlichkeitsprinzip aus der jüngeren Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts folgend – die Einnahme- und Risikoentwicklung des laufenden Geschäftsjahres berücksichtigt. Hierbei hätten selbstverständlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie eine große Rolle gespielt.
87Die von ihr gebildete Ausgleichsrücklage sei rechtmäßig. Die Bildung einer Ausgleichsrücklage sei grundsätzlich als Instrument der Risikovorsorge zulässig. Konkret habe sie bei der von ihr gebildeten Ausgleichsrücklage die rechtlichen Vorgaben, insbesondere das Gebot der Schätzgenauigkeit beachtet. Hierbei sei das von ihr verwendete „risk-tool“ entgegen der Auffassung der Kläger als tragfähiges Modell zur Berechnung der Höhe der Ausgleichsrücklage in der Rechtsprechung anerkannt. Das Bundesverwaltungsgericht habe sich in seinen aktuellen Entscheidungen überhaupt nicht zur generellen Eignung des „risk-tools“ geäußert. Die bei der Anwendung des „risk-tools“ verwendeten Daten beruhten auf den besten vorliegenden und verfügbaren Informationen. Die durch das “risk-tool“ ausgewiesenen Werte würden darüber hinaus einer Plausibilisierung durch eine zusätzliche händische Risikoberechnung ohne Nutzung eines Algorithmus unterzogen. Schließlich passe sie die Nutzung des „risk-tools“ ständig aktuellen Erkenntnissen und Vorgaben aus der Rechtsprechung an, was sich aus dem Protokoll der Vollversammlung am 1. Dezember 2020 deutlich ergebe. Als Ergebnis ihrer Risikoprognose sei die Ausgleichsrücklage für das Jahr 2020 aufgelöst und für das Jahr in Höhe von 1.655.277,00 Euro dotiert worden. Die von den Klägern im Hinblick auf die Höhe der Ausgleichsrücklage geäußerte Kritik sei gänzlich unsubstantiiert. Die von ihr vorgelegte Risikobewertung für das Jahr 2021 trage zwar die Überschrift „2020 L. Risikoerfassungsbogen“, beziehe sich aber auf das Jahr 2021. Grund für die Überschrift sei, dass die entsprechende Betrachtung stets im laufenden Jahr für das Folgejahr erfolge, mithin im Jahr 2020 für das Jahr 2021 vorgenommen worden sei.
88Die Nettoposition sei in der Eröffnungsbilanz mit zunächst etwa 2.400.000,00 Euro ausgewiesen worden. Eine Erhöhung könne nach der Rechtsprechung mit einem sachlichen Grund im Rahmen zulässiger Kammertätigkeit erfolgen. Im Jahr 2017 sei die Nettoposition um ca. 4.600.00,00 Euro erhöht worden. Hierbei habe in Höhe von 3.600.000,00 Euro ein sachlicher Grund im Rahmen zulässiger Kammertätigkeit bestanden, da es sich um die Verbuchung des damals neu errichteten Prüfungs- und Weiterbildungszentrums am Standort L. gehandelt habe und die Prüfungstätigkeit zu ihren Kernaufgaben gehöre. Dass die Erhöhung der Nettoposition im Jahr 2017 vor diesem Hintergrund erfolgt sei, ergebe sich eindeutig aus dem damaligen Protokoll der Vollversammlung. Das Prüfungs- und Weiterbildungszentrum als unbewegliches Sachanlagevermögen sei auf der Aktivseite der Bilanz im Haushaltsjahr 2016 aktiviert worden. Der Zeitversatz zwischen der Aktivierung des Prüfungs- und Weiterbildungszentrums im Jahr 2016 und der Erhöhung der Nettoposition im Jahr 2017 sei dabei irrelevant. Es bestehe kein Rechtssatz, wonach die Anpassung der Nettoposition zwingend im gleichen Jahr wie die Zunahme des Vermögens auf der Aktivseite der Bilanz erfolgen müsse. Es werde allein gefordert, dass die Nettoposition grundsätzlich die Differenz zwischen dem Aktivvermögen und den Schulden abbilde, weshalb die Höhe der Nettoposition nicht die Höhe des Kammervermögens übersteigen solle. Überdies sei die Aufnahme der Nutzung einiger Bereiche des Prüfungs- und Weiterbildungszentrums erst im Jahr 2017 nach der bauordnungsrechtlichen Bescheinigung einer mängelfreien Bauzustandsbesichtigung, abschließender Fertigstellung sowie Schlussrechnungsstellung erfolgt. Erst danach sei für sie erkennbar gewesen, ob noch weitere aktivierungspflichtige Kosten für den Bau des Prüfungs- und Weiterbildungszentrums anfallen würden. Sofern man – wie die Kläger im Falle eines zeitlichen Versatzes – zusätzlich zu einem sachlichen Zweck für die Erhöhung der Nettoposition auf eine Identität der Mittelherkunft abstellen wollte, wäre auch diese Voraussetzung erfüllt. Denn die Anhebung der Nettoposition wäre im Jahr 2016 auf der Passivseite in gleicher Weise und mit den gleichen Mitteln wie im Jahr 2017 tatsächlich geschehen erfolgt, nämlich durch die mit der Fertigstellung des Gebäudes verpflichtend aufzulösende Baurücklage, die exakt zu diesem Zweck begründet worden sei. Durch die Reduzierung der Nettoposition um den darüber hinausgehenden Anteil in Höhe von 956.000,00 Euro sei eine Anpassung dieser Position an den Wert des aktuell bestehenden unbeweglichen Sachanlagevermögens erreicht worden. Eine solche Anpassung im laufenden Haushaltsjahr sei nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts möglich bzw. sogar angezeigt. Die Erhöhung der Nettoposition im Beitragsjahr 2017 selbst sei nicht verfahrensgegenständlich. Dies werde durch die Berichte des Landesrechnungshofes des Landes Nordrhein-Westfalen 15. Mai 2019 und 4. März 2020 bestätigt. Diese hielten die Erhöhung der Nettoposition dem Grunde nach für zulässig, da eine tatsächliche Veränderung der Verhältnisse gegenüber den Verhältnissen am Eröffnungsbilanzstichtag eingetreten sei. Soweit der Landesrechnungshof die unzulässige Höhe der Nettoposition gerügt habe, sei dies im Rahmen der Nachtragswirtschaftsplanung für das Jahr 2020 korrigiert worden. Wenn die Kläger ausführten, tatsächlich weise die Bilanz des Jahres 2016 nur eine Erhöhung von 3.470.473,00 Euro aus, ließen sie hierbei die naturgemäß jährlich anfallende Gebäudeabschreibung zum 31. Dezember 2016 unberücksichtigt.
89Die durch die Neudotierung der Rücklagen sowie die teilweise Auflösung der Nettoposition frei werdenden Mittel seien zur Dotierung der Baurücklage in Höhe von 5.300.000,00 Euro für den Neubau der IHK-Geschäftsstelle in O. mit einem Prüfungs- und Weiterbildungszentrum sowie zur Dotierung der Ausgleichsrücklage für das Jahr 2021 in Höhe von 1.655.000,00 Euro und den Ausgleich des geplanten negativen Jahresergebnisses für das Wirtschaftsjahr 2021 (einschließlich der Beitragssenkung) in Höhe von 1.124.000,00 Euro verwendet worden. Auch dies sei nicht zu beanstanden. Es bestehe keine Verpflichtung, frei werdende Mittel in jedem Fall an die Mitglieder auszukehren. Vielmehr sei es nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zulässig, diese Mittel für einen anderen zulässigen Zweck im Rahmen der Kammertätigkeit zu verwenden. Da die Verwendung freiwerdender Mittel zu einem zulässigen Zweck im Rahmen der Kammertätigkeit eines Beschlusses über die zukünftige Mittelverwendung bedürfe und die Haushaltsplanung der Kammer grundsätzlich jährlich im Vorgriff auf das nächste Haushaltsjahr erfolge, sei eine solche Verwendung frei werdender Mittel zu einem zulässigen Zweck im Rahmen der Kammertätigkeit rein praktisch nur für das nächste Haushaltsjahr möglich. Die Unterstellung der Klägerin, dass bewusst ein negatives Jahresergebnis für das Jahr 2021 vorgesehen worden sei, um auf diese Weise angeblich freies Vermögen zu übertragen, treffe nicht zu. Die Beklagte habe vor der Herausforderung gestanden, während einer beispiellosen globalen Pandemie und damit einhergehenden Einnahmeausfällen, insbesondere im Bereich der Prüfung und Weiterbildung, einen gleichbleibend hohen Service zu Gunsten ihrer Mitglieder ohne die Anhebung von Mitgliedsbeiträgen anzubieten. Dies habe durch die Übertragung von Mitteln im Wege des Verlustausgleichs sichergestellt werden können.
90Auch die Baurücklage sei nicht zu beanstanden. Dass die IHKen auch Baurücklagen bilden dürften, sei in der Rechtsprechung anerkannt. Nach § 15 lit. a) Abs. 2 Satz 4 ihres Finanzstatuts sei die Bildung zweckgebundener Rücklagen zulässig, sofern der Verwendungszweck, der Umfang sowie der Zeitpunkt der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Rücklage hinreichend konkretisiert seien. Diesen Anforderungen sei sie gerecht geworden, wie die entsprechenden Ausführungen im Protokoll der Sitzung der Vollversammlung am 1. Dezember 2020 zeigten. Bezeichnenderweise trügen die Kläger nicht vor, inwiefern ihrer Auffassung nach die Baurücklage rechtswidrig sein solle. Das Jährlichkeitsprinzip sei nicht auf zweckgebundene Rücklagen zu übertragen, da dieses der einer solchen Rücklage immanenten Ansparfunktion widerspräche. Diese Ansparfunktion entspreche aber gerade den Grundsätzen einer geordneten Wirtschaftsführung und dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nach § 3 Abs. 2 IHK. Ohne eine solche Ansparfunktion könnten Investitionsvorhaben nur mit einem massiv gesteigerten Beitragsaufkommen in dem jeweiligen Investitionsjahr oder der Aufnahme von Krediten einhergehen. Beides dürfte – auch vor dem Hintergrund eines latenten Risikos einer Zinsänderung – nicht im Interesse der Beitragszahler sein. Daneben bestehe auch kein Verstoß gegen das Prinzip der Beitragsgerechtigkeit. Es sei schon fraglich, ob die aktuellen Beitragszahler überhaupt mit der Gruppe der zukünftigen Beitragszahler vergleichbar seien. Auch bestehe kein Vorrang einer Kreditfinanzierung eines Bauvorhabens gegenüber einer Rücklagenbildung, um auf diesem Wege nicht nur aktuelle, sondern auch künftige Beitragszahler in die Finanzierungsverantwortung zu nehmen. Überdies sei eine Verletzung des Äquivalenzprinzips nur anzunehmen, wenn die Beitragshöhe außer Verhältnis der durch sie abgegoltenen Vorteile stehe. Worin ein solches Missverhältnis im hiesigen Falle bestehe, zeigten die Kläger nicht auf, zumal die hierzu zitierten Quellen nicht auf den vorliegenden Sachverhalt übertragbar seien.
91Die Verfahren 20 K 2068/12, 20 K 3225/15 und 20 K 338/18 sind beigezogen worden. Die Beteiligten haben ihr Einverständnis mit einer Entscheidung des Gerichts ohne mündliche Verhandlung erklärt.
92Bezüglich des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakte sowie der beigezogenen Verwaltungsvorgänge ergänzend Bezug genommen.
93Entscheidungsgründe:
94A. Das Gericht kann gem. § 101 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Beteiligten ihr Einverständnis hierzu erklärt haben. Die Kläger haben ihr Einverständnis nicht – wie mit ihrem letzten Fristverlängerungsantrag angekündigt – widerrufen. Das von den Klägern erklärte Einverständnis ist auch nicht aufgrund des Schriftsatzes der Beklagten vom 26. April 2022 „verbraucht“, da die Beklagte hierin im Wesentlichen die von ihr bereits vorgetragenen Argumente vertieft hat,
95vgl. Dolderer, in: Sodan/Ziekow, VwGO, 5. Aufl. 2018, VwGO § 101 Rn. 37.
96B. Die Klage hat keinen Erfolg. Sie ist, soweit die Kläger mit ihr Abrechnungen von Beitragsjahren anfechten, unzulässig.
97Mit der gem. § 42 Abs. 1 VwGO erhobenen Anfechtungsklage kann die Aufhebung eines Verwaltungsaktes im Sinne des § 35 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) begehrt werden. Soweit die Kläger mit ihren Klagen Abrechnungen von Beitragsjahren hier ausschließlich mit der Begründung anfechten, die Beklagte habe in diesen Jahren eine unzulässige Vermögensbildung betrieben, fehlt es den Abrechnungsbescheiden insoweit an einer Regelungswirkung, welche Voraussetzung für das Vorliegen eines Verwaltungsaktes ist.
98Die Bestimmung des Regelungsgehalts hat durch Auslegung des Verwaltungsakts zu erfolgen. Für diese sind sowohl der Wortlaut des angefochtenen Bescheides als auch der Kontext aus normativem Rahmen und bereits ergangenen Verwaltungsakten von hoher Bedeutung,
99vgl. OVG Niedersachsen, Urteil vom 17. September 2018 – 8 LB 129/17 –, juris Rn. 57; bestätigt durch BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 11/19 –, juris Rn. 12.
100Sämtliche der angefochtenen Bescheide enthielten den Satz: „Wenn zu den oben ausgeführten Beitragsjahren bereits Beitragsbescheide ergangen sind, werden diese durch den aktuellen Bescheid nicht aufgehoben.“ § 15 Abs. 3 Satz 1 der Beitragsordnung der Beklagten lautet: „Sofern der Gewerbeertrag oder der Zerlegungsanteil für das Bemessungsjahr noch nicht vorliegt, kann das IHK-Mitglied aufgrund des letzten vorliegenden Gewerbeertrages oder – soweit ein solcher nicht vorliegt – aufgrund einer Schätzung in entsprechender Anwendung des § 162 AO vorläufig veranlagt werden.“ § 15 Abs. 4 der Beitragsordnung der Beklagten lautet: „Ändert sich die Bemessungsgrundlage nach Erteilung des Beitragsbescheides, so erlässt die IHK einen berichtigenden Bescheid. Zu viel gezahlte Beiträge werden erstattet, zu wenig erhobene Beiträge werden nachgefordert. […] Soweit der berichtigende Bescheid für ein bestimmtes Beitragsjahr einen korrigierten Beitrag ausweist, regelt er nur die Anpassung der Höhe des Beitrags an die der IHK vorliegenden Bemessungsgrundlagen; die zu dem betroffenen Beitragsjahr bereits zuvor ergangenen Beitragsbescheide bleiben im Übrigen wirksam und werden durch den berichtigenden Beitragsbescheid nicht aufgehoben, sondern nur im Umfang der Korrektur geändert.“
101Hiervon ausgehend ist bei der Beklagten das Verhältnis von vorläufiger Veranlagung zu Abrechnungen eines Beitragsjahres derart ausgestaltet, dass mit der Abrechnung lediglich insofern eine Regelung getroffen wird, als hierin eine Differenz zu den vorangegangenen vorläufigen Veranlagungen aufgrund einer Änderung der steuerlichen Bemessungsgrundlage ausgewiesen wird. Soweit der vorangegangene Bescheid nicht abgeändert wird, soll er in Geltung bleiben. Der nunmehr erlassene Bescheid tritt insoweit nicht an seine Stelle. Daraus folgt, dass der Jahresbeitrag und der mit früheren Bescheiden festgesetzte Betrag durch den angefochtenen Bescheid nur nachrichtlich bzw. als Teil der Begründung mitgeteilt werden, ohne Bestandteil der Beitragsfestsetzung zu sein,
102vgl. OVG Niedersachsen, Urteil vom 17. September 2018 – 8 LB 129/17 –, juris Rn. 63; bestätigt durch BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 11/19 –, juris Rn. 12.
103Denkt man dieses Verhältnis zu Ende, enthält die Abrechnung eines Beitragsjahres jedoch auch keine Regelung mehr bezüglich der der grundsätzlichen Beitragspflicht des Mitglieds zugrunde liegenden Wirtschaftssatzung und Wirtschaftsplanung für das jeweilige Beitragsjahr.
104Rechtsgrundlage für die Beitragspflicht der IHK-Mitglieder ist § 3 Abs. 2 und 3 Gesetz zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern (IHKG) in der hier maßgeblichen Fassung zum Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Bescheide in Verbindung mit der für das Beitragsjahr jeweils geltenden Beitragsordnung sowie der für das Beitragsjahr jeweils erlassenen Wirtschaftssatzung der Beklagten. Nach § 3 Abs. 2 IHKG werden die Kosten der Errichtung und Tätigkeit der IHK, soweit sie nicht anderweitig gedeckt sind, nach Maßgabe des Wirtschaftsplans durch Beiträge der Kammerzugehörigen gemäß einer Beitragsordnung aufgebracht. Der Wirtschaftsplan ist jährlich nach den Grundsätzen einer sparsamen und wirtschaftlichen Finanzgebarung unter pfleglicher Behandlung der Leistungsfähigkeit der Kammerzugehörigen aufzustellen und auszuführen. Gem. § 3 Abs. 3 Satz 1 IHKG erhebt die IHK als Beiträge Grundbeiträge und Umlagen.
105Gem. § 1 Abs. 2 der Beitragsordnung werden die Beiträge als Grundbeiträge und Umlagen erhoben. Gem. § 1 Abs. 3 der Beitragsordnung setzt die Vollversammlung jährlich in der Wirtschaftssatzung die Grundbeiträge, den Hebesatz der Umlage und die Freistellungsgrenze fest. Gem. § 6 Abs. 1 der Beitragsordnung kann der Grundbeitrag gestaffelt werden und dabei insbesondere der Gewerbeertrag berücksichtigt werden. Die Staffelung und die Höhe der Grundbeiträge legt die Vollversammlung in der Wirtschaftssatzung fest. Gem. § 7 Abs. 1 der Beitragsordnung ist die Bemessungsgrundlage für die Umlage der Gewerbeertrag. Gem. § 9 Abs. 1 und 2 der Beitragsordnung wird das Bemessungsjahr für den Gewerbeertrag in der jährlichen Wirtschaftssatzung festgesetzt. Wie bereits ausgeführt, regelt § 15 Abs. 3 Satz 1 der Beitragsordnung, dass, sofern der Gewerbeertrag für das Bemessungsjahr noch nicht vorliegt, das IHK-Mitglied aufgrund des letzten vorliegenden Gewerbeertrages vorläufig veranlagt werden kann. Nach § 15 Abs. 4 der Beitragsordnung erlässt die IHK einen berichtigenden Bescheid, wenn sich die Bemessungsgrundlage nach Erteilung des Beitragsbescheides ändert und werden zu viel gezahlte Beiträge erstattet bzw. zu wenig erhobene Beiträge nachgefordert. Dabei regelt der berichtigende Bescheid nur die Anpassung der Höhe des Beitrags an die der IHK vorliegenden Bemessungsgrundlagen; die zu dem betroffenen Beitragsjahr bereits zuvor ergangenen Beitragsbescheide bleiben im Übrigen wirksam und werden durch den berichtigenden Beitragsbescheid nicht aufgehoben, sondern nur im Umfang der Korrektur geändert.
106Gem. § 3 Abs. 1 des Finanzstatuts der Beklagten dient der Wirtschaftsplan der Beklagten der Gegenüberstellung der erwarteten Einnahmen und Ausgaben zur Feststellung des Finanzbedarfs im folgenden Geschäftsjahr. Die Feststellung des Wirtschaftsplanes erfolgt gem. § 2 Abs. 1 des Finanzstatuts durch die Wirtschaftssatzung. Zugleich werden in der Wirtschaftssatzung das Bemessungsjahr für den Gewerbeertrag sowie die Staffelung des Grundbeitrages und der Hebesatz für die Umlage festgelegt.
107Der Gesamtschau der vorzitierten Regelungen lässt sich – auch für die Kläger ersichtlich – entnehmen, dass die grundsätzliche Beitragspflicht eines Mitglieds aufgrund der Wirtschaftssatzung und Wirtschaftsplanung für das jeweilige Beitragsjahr bereits mit der vorläufigen Veranlagung gem. § 15 Abs. 3 der Beitragsordnung endgültig festgesetzt wird. Bereits mit der vorläufigen Veranlagung werden der im Wirtschaftsplan für das jeweilige Beitragsjahr verbindlich festgestellte Finanzbedarf der IHK über die in der Wirtschaftssatzung festgelegten Bemessungsgrundlagen für die Beiträge auf die Mitglieder umgelegt. Die Vorläufigkeit der Veranlagung beschränkt sich lediglich darauf, dass zum Zeitpunkt der vorläufigen Veranlagung der Gewerbeertrag für das Bemessungsjahr noch nicht vorliegt. Bei der Abrechnung gem. § 15 Abs. 4 der Beitragsordnung erfolgt lediglich noch eine Anpassung der Beitragsveranlagung aufgrund der zwischenzeitlich und häufig Jahre später erfolgenden Mitteilung des Gewerbeertrags im Bemessungsjahr. Eine neuerliche Überprüfung der Wirtschaftsplanung findet anlässlich der Mitteilung des Gewerbeertrags im Bemessungsjahr nicht statt und wäre nach § 10 Abs. 2 des Finanzstatuts in der Regel auch nicht möglich, da auch eine Nachtragswirtschaftsplanung nur bis zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres erfolgen kann.
108Ein derartiges Verständnis verhindert auch eine willkürliche Ungleichbehandlung derjenigen Mitglieder, deren Abrechnung keine zusätzlichen Beitrage ausweisen, da sich ihr Gewerbeertrag im Bemessungsjahr im Vergleich zu dem für die vorläufige Veranlagung herangezogenen Gewerbeertrag nicht verändert bzw. verringert hat. Denn solche Mitglieder könnten nach der vorzitierten Rechtsprechung die an sie ergangenen Abrechnungsbescheide nicht mehr anfechten. Ein sachlicher Grund dafür, dass diejenigen Mitglieder, bei denen sich – letztlich zufällig aufgrund einer Erhöhung der Gewerbeerträge im Bemessungsjahr im Vergleich zu dem für die vorläufige Veranlagung herangezogenen Gewerbeertrag – zusätzliche Beiträge bei der Abrechnung ergeben, eine „zweite Chance“ zur Überprüfung der unverändert gebliebenen Wirtschaftsplanung bekommen sollten, ist nicht ersichtlich.
109Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Erwägung, mit der Abrechnung kämen die in der der grundsätzlichen Beitragspflicht des Mitglieds zugrunde liegenden Wirtschaftssatzung und Wirtschaftsplanung festgesetzten „Beitragstarife“ erneut zur Anwendung und es bestehe bei der Abrechnung im Hinblick auf diese „Beitragstarife“ auch keine Bindungswirkung, da diese nicht an der Regelungswirkung des vorläufigen Bescheides teilhätten, sondern lediglich Teil der Begründung des Bescheides seien,
110vgl. OVG Niedersachsen, Urteil vom 17. September 2018 – 8 LB 129/17 –, juris Rn. 69 ff.; bestätigt durch BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 11/19 –, juris Rn. 12.
111Zum einen scheinen zumindest ausgehend von den Entscheidungsbegründungen schon die in den vorzitierten Entscheidungen zu überprüfenden Abrechnungsbescheide in dieser Hinsicht nicht mit den im hiesigen Verfahren zu überprüfenden Abrechnungsbescheiden vergleichbar zu sein. Denn ausweislich der vorzitierten Entscheidungen wurden bei den dortigen vorläufigen Bescheiden, welche den dort angefochtenen Abrechnungsbescheiden zugrunde lagen, die „Beitragstarife“ weder angegeben noch angewendet. Dies ist bei den den angefochtenen Abrechnungsbescheiden zugrunde liegenden vorläufigen Bescheiden der Beklagten anders. Diese weisen in einer Tabelle – ebenso wie die darauffolgenden Abrechnungsbescheide – den nach Gewerbeertrag gestaffelten Grundbeitrag, den Hebesatz für die Umlage sowie die sich hieraus ergebende Umlage aus.
112Zum anderen lässt sich allein aus der Tatsache, dass bei der Abrechnung eines Wirtschaftsjahres die in der Wirtschaftssatzung und Wirtschaftsplanung für das jeweilige Beitragsjahr festgelegten „Beitragstarife“ erneut angewendet werden, nicht folgern, dass diese „Beitragstarife“ erneut im Rahmen der Abrechnung anfechtbar sein müssen. Denn vor dem Hintergrund des zuvor dargestellten Verhältnisses von vorläufiger Veranlagung zur Abrechnung sowie der ebenfalls zuvor zitierten Regelungen, handelt es sich bei dieser erneuten Anwendung der „Beitragstarife“ lediglich um eine wiederholende Anwendung derselben „Beitragstarife“ auf einen lediglich gegebenenfalls veränderten Gewerbeertrag,
113vgl. zur Unanfechtbarkeit wiederholender Verfügungen: Sachs, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 9. Auflage 2018, § 51 Rn. 57.
114Ein hinreichender Rechtsschutz der Beitragspflichtigen gegen die Anwendung der in der Wirtschaftssatzung und Wirtschaftsplanung für das jeweilige Beitragsjahr festgelegten „Beitragstarife“ ist bereits dadurch gegeben, dass diese bei der erstmaligen Anwendung im Rahmen der vorläufigen Veranlagung Klage erheben können.
115C. Soweit sich die Klage gegen vorläufige Veranlagungen für die Jahre 2020 und 2021 richten, sind sie nach den vorangegangenen Ausführungen zulässig, aber unbegründet. Die angefochtenen Beitragsbescheide sind insoweit rechtmäßig und verletzen die Kläger nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO).
116I. Rechtsgrundlage für die vorläufige Festsetzung des Mitgliedsbeitrags ist – wie bereits ausgeführt – § 3 Abs. 2 und 3 IHKG in Verbindung mit der für das Beitragsjahr jeweils geltenden Beitragsordnung sowie der für das Beitragsjahr jeweils erlassenen Wirtschaftssatzung der Beklagten.
117II. Die Voraussetzungen für eine Heranziehung der Kläger zu Beiträgen liegen vor.
1181. Die Kammerzugehörigkeit der Kläger ergibt sich aus § 2 Abs. 1 IHKG. Sie sind natürliche oder juristische Person, die im Bezirk des Beklagten eine Betriebsstätte unterhalten und dem Grunde nach zur Gewerbesteuer veranlagt werden.
1192. Auch ist die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Pflichtmitgliedschaft in einer IHK höchstrichterlich geklärt. Insoweit wird auf die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verwiesen,
120BVerfG, Beschluss vom 12. Juli 2017 – 1 BvR 2222/12 –, juris, BVerfG, Beschluss vom 7. Dezember 2001 – 1 BvR 1806/98 –, juris; ; BVerfG, Urteil vom 18. Dezember 1974 – 1 BvR 430/65 und 1 BvR 259/66 –, juris; BVerfG, Urteil vom 19. Dezember 1962 – 1 BvR 541/57 –, juris.
121III. Die Beitragserhebung in den Jahren 2020 und 2021 entspricht den an sie zu stellenden rechtlichen Anforderungen.
122§ 3 Abs. 2 IHKG ermächtigt die Kammern, zur Deckung der Kosten ihrer Errichtung und Tätigkeit nach Maßgabe ihres Wirtschaftsplans von den Kammerzugehörigen gemäß einer Beitragsordnung Beiträge zu erheben, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind. Die Heranziehung zu Kammerbeiträgen ist rechtmäßig, wenn die Feststellung des Mittelbedarfs der Kammer im Wirtschaftsplan den an sie zu stellenden rechtlichen Anforderungen genügt, der Mittelbedarf in rechtmäßiger Weise durch eine Beitragsordnung auf die Kammerzugehörigen umgelegt wird und diese Beitragsordnung im Einzelfall ohne Rechtsfehler angewendet wurde,
123vgl. BVerwG, Urteil vom 9. Dezember 2015 – 10 C 6.15 –, juris Rn. 12 ff.; BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 11/19 –, juris Rn. 13.
1241. Die für die Beitragserhebung in den Jahren 2020 und 2021 maßgebliche Wirtschaftsplanung für diese Jahre entspricht auf der ersten Stufe den rechtlichen Anforderungen.
125Die verwaltungsgerichtliche Kontrolle ist hierbei darauf beschränkt, ob die IHK bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes den ihr zustehenden weiten Gestaltungsspielraum überschritten hat. § 3 Abs. 2 Satz 2 IHKG verpflichtet die Kammern, vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen und ihre Tätigkeit im betreffenden Wirtschaftsjahr an ihm auszurichten. Bei Aufstellung des Wirtschaftsplans muss die Kammer vor dem Hintergrund der von ihr im kommenden Wirtschaftsjahr beabsichtigten Tätigkeiten unter Berücksichtigung der zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben den durch Beiträge zu deckenden Bedarf prognostizieren. Dabei hat sie zu beachten, dass die Kammern zur sparsamen und wirtschaftlichen Finanzgebarung sowie zur pfleglichen Behandlung der Leistungsfähigkeit der Kammerzugehörigen verpflichtet sind. Vermögen zu bilden, ist den Kammern verboten. Das schließt die Bildung von Rücklagen aber nicht aus, welche nach ständiger Rechtsprechung zu den Kosten der IHKen im Sinne des § 3 Abs. 2 Satz 1 IHKG zählen und in Ermangelung anderer Finanzquellen durch Beiträge zu decken sind. Voraussetzung ist jedoch, dass sie an einen sachlichen Zweck im Rahmen zulässiger Kammertätigkeit gebunden sind und auch das Maß der Rücklage noch von diesem sachlichen Zweck gedeckt ist. Ferner sind über die Verweisung in § 3 Abs. 7a IHKG die Grundsätze kaufmännischer Rechnungslegung und Buchführung, das durch Beschluss der Vollversammlung (§ 4 S. 2 Nr. 8 IHKG) erlassene Finanzstatut sowie die Grundsätze des staatlichen Haushaltsrechts zu beachten. Zu den Grundsätzen des staatlichen Haushaltsrechts zählt das Gebot der Haushaltswahrheit, aus dem in Ansehung von Prognosen das Gebot der Schätzgenauigkeit folgt. Danach müssen Mittelbedarfs- und Einnahmenprognosen aus ex-ante-Sicht sachgerecht und vertretbar ausfallen. Diese rechtlichen Vorgaben gelten auch nach der Einführung der doppischen Rechnungslegung gemäß § 3 Abs. 7a IHKG unverändert fort,
126vgl. BVerwG, Urteil vom 9. Dezember 2015 – 10 C 6.15 –, juris Rn. 16 f.; BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 11/19 –, juris Rn. 14.
127Hiervon ausgehend entspricht die für die Beitragserhebung in den Beitragsjahren 2020 und 2021 maßgebliche Wirtschaftsplanung auf der ersten Stufe den rechtlichen Anforderungen.
128a. Dies gilt zunächst im Hinblick auf die Ausgleichsrücklage.
129aa. Die Rügen der Kläger im Hinblick auf die Höhe der Ausgleichsrücklage gehen für das Beitragsjahr 2020 ins Leere.
130Nach dem in der Sitzung der Vollversammlung am 1. Dezember 2020 beschlossenen Nachtragswirtschaftsplan für das laufende Beitragsjahr 2020 wurde die ursprünglich für das Jahr 2020 in Höhe von 5.383.000,00 Euro dotierte Ausgleichsrücklage aufgelöst.
131Eine solche Verabschiedung eines Nachtragswirtschaftsplans ist auch zulässig. Gem. § 10 Abs. 2 des Finanzstatuts kann eine geänderte Wirtschaftssatzung und gegebenenfalls ein Nachtragswirtschaftsplan bis zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres beschlossen werden,
132vgl. BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 11/19 –, juris Rn. 23 ff., welches die Zulässigkeit einer Nachtragswirtschaftsplanung am Ende des jeweiligen Geschäftsjahres als zulässig voraussetzt.
133Nicht zu beanstanden ist in diesem Zusammenhang auch, die Rechtmäßigkeit des an die Klägerin zu 1. gerichteten Bescheides vom 24. Januar 2020 an dem nach dessen Erlass beschlossenen Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2020 zu messen. Der Nachtragswirtschaftsplan tritt gem. § 10 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 Finanzstatut an die Stelle des bisherigen Wirtschaftsplans. Der rückwirkende Erlass von Beitragssatzungen wird grundsätzlich nur dann als unzulässig angesehen, wenn der Vertrauensschutz der Beitragsschuldner entgegensteht. Da der Nachtragswirtschaftsplan noch innerhalb des betreffenden Geschäftsjahres beschlossen wurde, ist bereits fraglich, ob überhaupt von einer solchen am Vertrauensschutz zu messenden Rückwirkung auszugehen ist. Jedenfalls aber sind im Fall der Klägerin zu 1. keine einer Nachtragswirtschaftsplanung entgegenstehenden Vertrauensschutzgesichtspunkte ersichtlich oder vorgetragen worden,
134vgl. VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 20. Juli 2017 – 6 S 860/17 –, juris Rn. 11.
135bb. Das im Wirtschaftsplan 2021 geplante Vorhalten einer Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.655.000,00 Euro ist gerechtfertigt.
136Wie bereits ausgeführt, ist das Bilden von angemessenen Rücklagen für die IHKen trotz des Verbots der Vermögensbildung zulässig, sofern sie an einen sachlichen Zweck im Rahmen zulässiger Kammertätigkeit gebunden sind und auch das Maß der Rücklage noch von diesem sachlichen Zweck gedeckt ist. Insbesondere ist die Bildung einer Ausgleichsrücklage zur Absicherung von Beitragsschwankungen durch einen sachlichen Zweck im Rahmen zulässiger Kammertätigkeit grundsätzlich gerechtfertigt,
137vgl. BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 11/19 –, juris Rn. 16.
138(1) Die Ausgleichsrücklage in dieser Höhe hält sich zum einen in dem durch das Finanzstatut der Beklagten vorgegebenen Rahmen. Gem. § 15a Abs. 2 Finanzstatut der Beklagten kann die Ausgleichsrücklage bis zu 50% der geplanten Aufwendungen betragen. Mit 1.655.000,00 Euro macht die für das Jahr 2021 geplante Ausgleichsrücklage 6,84 % des in der Plan-GuV 2021 vorgesehenen Betriebsaufwands in Höhe von 24.194.000,00 Euro bzw. 6,69 % der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Aufwendungen in Höhe von 24.742.000,00 Euro aus.
139(2) Darüber hinaus wurden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans für das Jahr 2021 hinsichtlich des Vorhaltens einer Ausgleichsrücklage die Grundsätze staatlichen Haushaltsrechts gewahrt.
140In Betracht kommt im gegebenen Fall nach dem Vortrag der Kläger allein eine Verletzung des Gebots der Schätzgenauigkeit. Das Gebot der Schätzgenauigkeit ist nicht schon dann verletzt, wenn sich eine Prognose im Nachhinein als falsch erweist. Das Gebot der Schätzgenauigkeit verpflichtet aber dazu, den im Haushalt für einen bestimmten Zweck veranschlagten Mittelbedarf aufgrund der bei der Aufstellung des Haushaltsplans (Wirtschaftsplans) verfügbaren Informationen sachgerecht und vertretbar zu prognostizieren. Was dabei als vertretbar zu gelten hat, kann nur aufgrund einer Gesamtbewertung der konkreten Entscheidungssituation unter Berücksichtigung des betroffenen Sach- und Regelungsbereichs, der Bedeutung der zu treffenden Entscheidung und deren Folgen sowie der verfügbaren Tatsachengrundlagen für die Prognose bestimmt werden. Ziel ist eine möglichst realitätsgerechte Schätzung der künftigen Einnahmen und Ausgaben der Kammer. Unvertretbar sind jedenfalls bewusst falsche Etatansätze und gegriffene Ansätze, die trotz naheliegender Möglichkeit besserer Informationsgewinnung ein angemessenes Bemühen um realitätsgerechte Prognosen zu erwartender Einnahmen oder Ausgaben vermissen lassen,
141vgl. BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 11/19 –, juris Rn. 21 ff.
142Gerade weil die in die Zukunft bezogenen Aussagen zwangsläufig mit Ungewissheiten behaftet sind, fordert der Grundsatz der Schätzgenauigkeit, dass die Beklagte eine nachvollziehbare Prognose dahingehend aufstellt, dass ergebniswirksame Schwankungen im Rahmen einer geordneten Haushaltsführung in einer Höhe drohen, die die konkrete Höhe der Ausgleichsrücklage rechtfertigen, um sie verantwortungsbewusst abzusichern,
143vgl. BVerwG, Urteil vom 9. Dezember 2015 – 10 C 6.15 –, juris Rn. 20.
144Unabhängig davon, ob die Höhe der Ausgleichsrücklage im verfahrensgegenständlichen Beitragsjahr das rechtsaufsichtlich genehmigte Finanzstatut der Beklagten wahrt, obliegt es danach der Beklagten, im Einzelnen darzulegen, dass sie im Rahmen des ihr aus dem Selbstverwaltungsrecht erwachsenen weiten Gestaltungsspielraums die Grenzen des Vertretbaren eingehalten hat, die Ausgleichsrücklage also nicht völlig willkürlich – „ins Blaue hinein“ – vorgehalten wird, sondern plausibel und nachvollziehbar ist. Die Darlegungslast trifft die Beklagte nicht nur, wenn sie den satzungsrechtlich gesteckten Rahmen hinsichtlich der Höhe der Ausgleichsrücklage voll oder nahezu ausschöpft. Nach den haushaltsrechtlichen Grundsätzen ist die Beklagte vielmehr stets gehalten, das Bedürfnis für die Ausgleichsrücklage in ihrer konkreten Höhe nachvollziehbar zu begründen und alle voraussichtlich zu erwartenden ergebniswirksamen Schwankungen möglichst zutreffend zu prognostizieren. Für die Annahme einer Vermutung, das Gebot der Schätzgenauigkeit sei eingehalten, wenn der satzungsrechtlich gesteckte Rahmen hinsichtlich der Höhe der Ausgleichsrücklage nicht ausgeschöpft werde, lassen die vorgenannten haushaltsrechtlichen Grundsätze keinen Raum,
145vgl. BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 11/19 –, juris Rn. 19; VG Düsseldorf, Urteil vom 30. März 2017 – 20 K 3225/15 –, juris Rn. 345 f.
146Verfahrensrechtlich muss die Beklagte die Entscheidung über das Vorhalten einer Rücklage und über deren Höhe bei jedem Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) – und damit jährlich – erneut treffen. Ein Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) kann deshalb nicht nur dann rechtswidrig sein, wenn er eine überhöhte Rücklagenbildung vorsieht, sondern auch dann, wenn er eine überhöhte Rücklage beibehält. Eine in ihrer Höhe nicht mehr gedeckte Rücklage wäre nicht mehr angemessen und würde einer unzulässigen Vermögensbildung gleichkommen,
147vgl. BVerwG, Urteil vom 9. Dezember 2015 – 10 C 6.15 –, juris Rn. 18.
148Allerdings muss die Beklagte ihre Mittelbedarfsprognose bei Verabschiedung des Wirtschaftsplans nicht ausdrücklich begründen. Die Regelungen über die Aufstellung von Wirtschaftsplänen,
149gem. § 2 Abs. 2 Buchst. c) der Satzung der Beklagten bleibt der Vollversammlung ausdrücklich die Beschlussfassung über die Wirtschaftssatzung, in der der Wirtschaftsplan festgestellt und der Maßstab für die Beiträge und Sonderbeiträge festgesetzt wird, vorbehalten; dies entspricht den gesetzlichen Vorgaben in § 4 Nr. 3 IHKG, wonach die Feststellung des Wirtschaftsplanes der Vollversammlung obliegt,
150sehen keine besonderen Verfahrens-, Anhörungs- oder Begründungspflichten vor. Der Kontrolle der Mittelbedarfsprognosen sind daher alle Erwägungen der Beklagten zugrunde zu legen, die sie zu den im Zeitpunkt des Beschlusses ihrer Vollversammlung über den betreffenden Wirtschaftsplan vorliegenden Tatsachen bis zum Schluss der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung prozessordnungsgemäß vorgebracht hat,
151vgl. BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 11/19 –, juris Rn. 24; anders noch: VG Düsseldorf, Urteil vom 30. März 2017 – 20 K 3225/15 –, juris Rn. 350.
152Diesen Anforderungen wird das Vorhalten einer Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.655.000,00 Euro im Wirtschaftsplan 2021 gerecht. Es beruht nach den dem Gericht vorliegenden Unterlagen auf einer dem Gebot der Schätzgenauigkeit genügenden Prognoseentscheidung.
153Einen Ausdruck der durchgeführten Risikosimulation hat die Beklagte dem Gericht vorgelegt und ist durch das Gericht allen Klägern zu deren Kenntnisnahme übersandt bzw. im Wege der Möglichkeit zur Akteneinsicht zur Verfügung gestellt worden. Die für das Jahr 2021 eingeplante Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.655.277,00 Euro entspricht exakt dem Ergebnis der Schadenssumme der von der Beklagten mit den von ihr festgelegten Parametern durchgeführten Risikosimulation. Dass die von der Beklagten vorgelegte Risikosimulation oder die ihr durch die Beklagte zugrunde gelegten Parameter fehlerhaft wären, haben die Kläger weder substantiiert vorgetragen noch ist dies angesichts dessen, dass der Beklagten bei der Aufstellung ihres Wirtschaftsplanes ein weiter Gestaltungsspielraum zusteht und die Bildung von angemessenen Rücklagen gerade Bestandteil einer geordneten Haushaltsführung ist, sonst ersichtlich,
154vgl. VG Düsseldorf, Urteil vom 15. November 2017 – 20 K 5579/17 –, juris Rn.74 ff.; VG Köln, Urteil vom 15. Februar 2017 – 1 K 1473/16 –, juris Rn. 82.
155Dass diese Risikosimulation mit der Jahreszahl „2020“ überschrieben ist, worauf auch die Kläger hinweisen, ist – auch schon vor der Klarstellung der Beklagten mit Schriftsatz vom 3. Mai 2022 – offensichtlich darauf zurückzuführen, dass diese am Ende des Jahres 2020 im Rahmen der Wirtschaftsplanung für das darauffolgende Wirtschaftsjahr 2021 erfolgte. Denn der aufgrund dieser Risikosimulation ermittelte Wert in Höhe von 1.655.277,00 Euro entspricht exakt der Höhe der für das Jahr 2021 bemessenen Ausgleichsrücklage, welche im Protokoll der Vollversammlung am 1. Dezember 2020 ausführlich begründet wurde. Wenn die Kläger sich vor diesem Hintergrund im Rahmen ihrer Klagebegründung darauf zurückziehen, für das Jahr 2021 lägen keine Unterlagen über eine Risikosimulation vor, so zeugt dies davon, dass sie sich offensichtlich nicht im Einzelnen mit der von der Beklagten vorgenommenen Risikosimulation auseinandersetzen konnten oder wollten. Ihr Einwand, dass, sofern sich die vorgelegten Unterlagen auf das Jahr 2021 bezögen, diese bereits auf den „13. August 2020“ datiert seien, lässt ebenfalls jegliche inhaltliche Auseinandersetzung mit der Risikosimulation selbst vermissen. Beispielsweise benennen die Kläger keine Umstände, die aus ihrer Sicht durch die Beklagte hätten berücksichtigt werden müssen.
156Des Weiteren ergibt sich ein Verstoß gegen das Gebot der Schätzgenauigkeit auch nicht aus dem von den Klägern bemühten Vergleich zu den Entscheidungen anderer Verwaltungsgerichte zu anderen IHKen sowie der Rechtsprechung der hiesigen Kammer zu früheren Beitragsjahren der Beklagten. Denn aufgrund des der Beklagten und anderen IHKen grundsätzlich zukommenden Gestaltungsspielraums bei der Wirtschaftsplanung, lässt sich aus der Dotierung der Ausgleichsrücklage bei anderen IHKen kein Rückschluss auf die Rechtmäßigkeit der Dotierung der Ausgleichsrücklage bei der Beklagte herleiten. Auch lässt sich angesichts der massiven Anpassungen der Höhe und der Praxis der Rücklagenbildung bei der Beklagten aus dem Vorhalt einer überhöhten Rücklagenbildung in der Vergangenheit für die Gegenwart nicht pauschal der Schluss ziehen, die Rücklagen seien immer noch überhöht.
157Soweit die Kläger vortragen, das Bundesverwaltungsgericht habe das von der Beklagten genutzte „risk-tool“ als Maßstab für die gerichtliche Kontrolle behördlicher Prognosen in seiner aktuellen Rechtsprechung als ungeeignet bezeichnet, beruht dies nach Auffassung der Kammer auf einer nicht zutreffenden Leseart dieser Entscheidungen. Denn die aktuellen Entscheidungen thematisieren die von der Beklagten genutzte Simulationssoftware nicht. Die den Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts zugrunde liegenden Entscheidungen des Berufungsgerichts schätzen die Nutzung der allen IHKs vom DIHK zur Verfügung gestellten Simulationssoftware als grundsätzlich geeignete Prognosemethode ein,
158vgl. OVG Niedersachsen, Urteil vom 17. September 2018 – 8 LB 128/17 –, juris Rn. 188.
159Die in den Entscheidungen festgestellten Fehler bei der Bemessung der Ausgleichsrücklage –
160- Übersteigen des prognostizierten Bedarfs,
161vgl. BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 10/19 –, juris Rn. 25,
162- Nichtausschöpfen der naheliegenden Möglichkeiten der Informationsgewinnung, z.B. in Form eines Anknüpfens an die konkrete Verwirklichung dieser Risiken in der Vergangenheit und Übertragung auf das kommende Wirtschaftsjahr,
163vgl. BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 11/19 –, juris Rn. 25; BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 10/19 –, juris Rn. 27, 30; BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 9/19 –, juris Rn. 23,
164- Berechnung nach dem Dreifachen des prognostizierten Beitragsausfalls zur mit dem Jährlichkeitsprinzip nicht vereinbaren Vorsorge für Beitragsausfälle in den Folgejahren,
165vgl. BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 11/19 –, juris Rn. 27; BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 10/19 –, juris Rn. 28; BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 9/19 –, juris Rn. 25,
166- doppelte Berücksichtigung bestimmter Ausfälle in mehreren zugrunde gelegten Risikofaktoren,
167vgl. BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 11/19 –, juris Rn. 17; BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 9/19 –, juris Rn. 24) –
168wurden von der Beklagten bei ihrer Risikosimulation zur Bemessung der Höhe der Ausgleichsrücklage vermieden. Wie bereits ausgeführt, entspricht die für das Jahr 2021 eingeplante Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.655.277,00 Euro exakt dem prognostizierten Bedarf für dieses Jahr. Eine von der Beklagten zwar als betriebswirtschaftlich sinnvoll eingestufte finanzielle Risikovorsorge für mehrere Jahre sollte explizit nicht mehr vorgenommen werden. Zur Informationsgewinnung hat die Beklagte nach ihren unwidersprochenen Ausführungen die Historie der letzten zwölf Jahre herangezogen und hieraus den Schluss gezogen, dass sich die sehr teuren Schadensereignisse über 90% des Konfidenzniveaus bei der Beklagten bisher nicht annähernd realisiert hätten. Die von der Beklagten berücksichtigten Risikofaktoren, konjunkturelle Änderungen bei den IHK-Beiträgen, Ertragsausfälle bei den Gebühren und Rückgang bei den Entgelten, sind zudem klar voneinander abgrenzbar, betreffen sie doch drei unterschiedliche Einnahmequellen der Beklagten. Insbesondere die konjunkturellen Änderungen bei den IHK-Beiträgen wurden in den aktuellen Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts ausdrücklich als zulässiger Risikofaktor bestätigt, während die Zulässigkeit der Berücksichtigung anderer Faktoren ausdrücklich offen gelassen wurde,
169vgl. BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 11-19 –, juris Rn. 16 f.; BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 10-19 –, juris Rn. 18 f.; BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 9-19 –, juris Rn. 14.
170Das Gericht hat auch keinerlei Zweifel an der Zulässigkeit der Berücksichtigung von Ertragsausfällen bei den Gebühren und Rückgängen bei den Entgelten bei der Bemessung der Höhe der Ausgleichsrücklage. Denn diese stellen neben den Beiträgen weitere signifikante Einnahmequellen der Beklagten dar.
171b. Baurücklage
172aa. Auch das im Nachtragswirtschaftsplan 2020 geplante Aufstocken der Baurücklage auf 5.298.000,00 Euro ist gerechtfertigt.
173Nach § 15a Abs. 2 Finanzstatut ist neben dem zwingenden Vorhalten einer Ausgleichsrücklage die Bildung zweckbestimmter Rücklagen zulässig. Sie sind in der Bilanz als „andere Rücklagen“ auszuweisen. Der Verwendungszweck und der Umfang sind hinreichend zu konkretisieren, wie auch der Zeitpunkt der voraussichtlichen Inanspruchnahme.
174§ 15a Finanzstatut gilt zwar unmittelbar nur für den Jahresabschluss, der nicht Grundlage für die streitigen Beitragsbescheide ist. Dies ist der Wirtschaftsplan, für den das Finanzstatut eine Konkretisierungspflicht wie für den Jahresabschluss nicht ausdrücklich vorsieht. Da jedoch gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 des Finanzstatuts die Rücklagenveränderungen im Wirtschaftsplan getrennt anzusetzen und auszuweisen sind, gelten die Anforderungen für die Konkretisierung der Rücklagen im Jahresabschluss auch für den Wirtschaftsplan,
175vgl. OVG Schleswig-Holstein, Beschluss vom 24. September 2020 – 5 LA 184/20 –, juris Rn. 31.
176Diese Anforderungen entsprechen zugleich den bereits dargestellten Anforderungen des Bundesverwaltungsgerichts an die hinreichend bestimmte sachliche Zweckbindung von Rücklagen,
177vgl. VG Köln, Urteil vom 16. Juni 2016 – 1 K 1188/15 –, juris Rn. 52.
178Das vorgesehene Aufstocken der Baurücklage auf 5.298.000,00 Euro wird diesen Anforderungen wiederum gerecht. In den Erläuterungen zum Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird hierzu ausgeführt, die Dotierung der Baurücklage sei im Hinblick auf den geplanten Neubau der IHK-Geschäftsstelle O. mit einem Prüfungs- und Weiterbildungszentrum erfolgt. Für diesen seien nach den Ende 2010 erstellten und Ende 2020 aktualisierten Entwürfen eines Architekturbüros Kosten von rund 9.500.000,00 Euro vorgesehen. Die Fertigstellung solle zwischen 2024 und 2025 erfolgen. Im Rahmen dieser zeitlichen Perspektive solle die Baurücklage in einem ersten Schritt mit 5.298,00,00 Euro dotiert werden. Die fehlenden Mittel zur vollständigen Finanzierung seien noch aus dem erwarteten Verkaufserlös des alten IHK-Gebäudes O. (laut Wertgutachten 2.900.000,00 Euro) sowie durch weitere Zuführungen zur Baurücklage in Höhe von 1.300.000,00 Euro in den Folgejahren nach Haushaltsverfügbarkeit aufzubringen. Aus diesen Erläuterungen sind sowohl Zweck als auch Zeitpunkt der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Rücklage hinreichend konkret ersichtlich. Die zugrunde liegenden Entwürfe des Architekturbüros wurden nach den Erläuterungen Ende 2020 aktualisiert und waren damit bei Beschluss des Nachtragswirtschaftsplans im Dezember 2020 aktuell. Addiert man die im Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2020 vorgesehene Aufstockung der Baurücklage auf 5.298.000,00 Euro zu dem erwarteten Verkaufserlös des alten IHK-Gebäudes O. (laut Wertgutachten 2.900.000,00 Euro) sowie zu den geplanten weiteren Dotierungen in Höhe von 1.300.000,00 Euro, ergibt sich mit 9.498.052,00 Euro auch ein den veranschlagten Kosten in Höhe von rund 9.500.000,00 Euro entsprechender Wert.
179Der hinreichenden Konkretisierung der Rücklagenbildung steht dabei nicht entgegen, dass über die Realisierung der Neubaumaßnahmen die Vollversammlung gegebenenfalls jeweils gesondert entscheiden wird. Nach Auffassung des Gerichts darf eine Rücklagenbildung nicht erst erfolgen, nachdem ein Beschluss der Vollversammlung über die Durchführung der betreffenden Neubaumaßnahmen ergangen ist. Die Beklagte ist zwar verpflichtet, ihre Haushaltsplanung gegenüber den Mitgliedern offenzulegen und sich für erforderlich gehaltene Rücklagen zu rechtfertigen. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan samt der Entscheidung über die Rücklagenbildung dient jedoch nicht dazu, die konkrete Planung und Entscheidung für Bauvorhaben, die erst Jahre später realisiert werden sollen, vorwegzunehmen. Zudem dürfte es gerade bei umfassenden Bauvorhaben erforderlich sein, mit der Rücklagenbildung bereits vor der Durchführung der entsprechenden Baumaßnahmen zu beginnen, um die erforderlichen Rücklagen überhaupt ansammeln zu können. Es bedarf daher keiner fertigen Baupläne, um für Neubaumaßnahmen Rücklagen bilden zu dürfen,
180vgl. VG Düsseldorf, Urteil vom 15. November 2017 – 20 K 5579/17 –, juris Rn. 89.
181Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den Einwänden der Kläger, die Erhöhung der Baurücklage, die die Beklagte mit Beschluss vom 1. Dezember 2020 vorgenommen habe, verstoße gegen das Äquivalenzprinzip und den Gleichheitsgrundsatz, da die dafür benötigten Mittel zum großen Teil ad hoc in Abweichung von der bisherigen Wirtschaftsplanung bereitgestellt worden seien. Hierdurch seien die Beitragszahler ganz weniger Jahre zur Finanzierung eines Gebäudes herangezogen worden, welches über Jahrzehnte künftigen Kammermitgliedern zur Verfügung stehen werde, die gar nicht oder nur in ganz geringem Maße zur Mitfinanzierung herangezogen worden seien.
182Nach dem Äquivalenzprinzip darf die Höhe des Beitrags nicht in einem Missverhältnis zu den abgegoltenen Vorteilen stehen; nach dem Gleichheitssatz sind die Beiträge im Verhältnis der Beitragspflichtigen zueinander grundsätzlich vorteilsgerecht zu bemessen,
183vgl. OVG Niedersachsen, Urteil vom 18. Juni 2015 – 8 LB 191/13 –, juris Rn. 31 f., 35 m.w.N.; OVG NRW, Beschluss vom 29. November 2012 – 17 A 1696/12 –, juris Rn. 23; OVG Niedersachsen, Urteil vom 25. September 2008 – 8 LC 31/07 –, juris Rn. 40 m.w.N.; VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 14. September 2001 – 14 S 2726/00 –, juris Rn. 26.
184Eine Verletzung der Äquivalenzprinzips oder des Gleichheitssatzes ist nach dem Vortrag der Kläger nicht ersichtlich. Die zugrunde liegende Annahme der Kläger, die für die Aufstockung der Baurücklage benötigten Mittel seien zum großen Teil ad hoc in Abweichung von der bisherigen Wirtschaftsplanung bereitgestellt worden, sodass die Beitragszahler ganz weniger Jahre zur Finanzierung eines Gebäudes herangezogen worden seien, ist für das Gericht nicht nachvollziehbar. Die Aufstockung der Baurücklage auf 5.298.000,00 Euro wurde im Wesentlichen durch die Zuführung von frei werdenden Mitteln in Höhe von 4.900.000,00 Euro aufgrund der Auflösung der Ausgleichsrücklage erzielt. Aufgrund der beigezogenen Verfahren 20 K 3225/15 und 20 K 338/18 ist gerichtsbekannt, dass die zur Aufstockung der Baurücklage verwendete aufgelöste Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2009 auf einen Betrag von 8.904.800,00 Euro aufgestockt, sie zunächst über mehrere Jahre in dieser bzw. nur geringfügig verminderter Höhe beibehalten, bevor sie im November 2017 im Wege einer rückwirkend erlassenen Wirtschaftssatzung auf 5.488.000,00 Euro abgesenkt und auch im Anschluss hieran bis zur Auflösung im Jahr 2020 im Wesentlichen in unveränderter Höhe beibehalten wurde. Hiervon ausgehend wurden die Mittel zum Aufbau und Erhalt der zur Aufstockung der Baurücklage verwendeten aufgelösten Ausgleichsrücklage nicht von den Beitragszahlern ganz weniger Jahre „erwirtschaftet“, sondern von den Beitragszahlern von über zehn Jahren. Auch betragen die Kosten für den geplanten Neubau der IHK-Geschäftsstelle O. mit einem Prüfungs- und Weiterbildungszentrum insgesamt rund 9.500.000,00 Euro. Die im Jahr 2020 aufgrund der Auflösung der Ausgleichsrücklage durchgeführte Aufstockung der Baurücklage um 4.900.000,00 Euro auf 5.298.000,00 Euro beläuft sich dementsprechend nur auf etwas mehr als die Hälfte der Gesamtkosten. Die weiteren benötigten Mittel in Höhe von immer noch rund 4.302.000,00 Euro sollen noch in den Folgejahren angespart werden, also von den Beitragszahlern zukünftiger Jahre „erwirtschaftet“ werden. Dies gilt auch im Hinblick darauf, dass 2.900.000,00 Euro dieser weiteren benötigten Mittel aus dem erwarteten Verkaufserlös des alten IHK-Gebäudes O. stammen sollen. Denn würde der in der Zukunft noch zu erzielende Verkaufserlös nicht der Baurücklage zugeführt, würde auch er die Beitragszahler zukünftiger Jahre „schonen“, da der Finanzbedarf der IHK in dieser Höhe nicht durch Mitgliedsbeiträge gedeckt werden dürfte.
185Hiervon ausgehend ist der Sachverhalt im hiesigen Fall nicht mit den von den Klägern zitierten Quellen vergleichbar. In den Gerichtsentscheidungen ging es um die Kosten für sukzessive in den nächsten zehn Jahren erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen, die durch eine einmalige Erhöhung der Instandhaltungsrücklage im Vorhinein vollständig abgedeckt werden sollten,
186vgl. VG Magdeburg, 27.06.2018 – 3 A 74/1 –, juris; OVG Sachsen-Anhalt, 14.09.2020 – 1 L 98/18 –, juris,
187In dem Jahresbericht des Niedersächsischen Landesrechnungshofes ging es um die Finanzierung von Gesamtkosten in Höhe von 19.800.000,00 Euro für eine Neubaumaßnahme, die über einen Sonderbeitrag über nur drei Jahre finanziert werden sollte,
188vgl. Niedersächsischer Landesrechnungshof, Jahresbericht 2021, Seite 154 f.
189Sollten die Kläger mit ihren Einwänden darauf abzielen, dass die Kosten für solche Neubaumaßnahmen aus dem laufenden Haushalt zu finanzieren seien, ist dies nach Auffassung des Gerichts nicht erforderlich. Die Entscheidung, ob die Finanzierung solcher Maßnahmen aus dem laufenden Haushalt, ggf. unter Inanspruchnahme von Krediten, oder durch die Bildung von Rücklagen erfolgen soll, ist Bestandteil des Gestaltungsspielraums der Beklagten bei der Wirtschaftsplanung. Zudem ist fraglich, ob gerade bei umfassenden Bauvorhaben eine Finanzierung aus dem laufenden Haushalt ohne die Bildung von Rücklagen überhaupt realisierbar wäre,
190vgl. VG Düsseldorf, Urteil vom 15. November 2017 – 20 K 5579/17 –, juris Rn. 91.
191In seiner aktuellen Rechtsprechung führt das Bundesverwaltungsgericht im Zusammenhang mit der Höhe der Nettoposition aus, dass Vorkehrungen für einen Finanzbedarf künftiger Jahre durch angemessene Rücklagen getroffen werden können,
192vgl. BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 10/19 –, juris Rn. 36,
193was die Zulässigkeit der Bildung einer zweckgebundenen Rücklage zur Finanzierung eines erst in Zukunft zu realisierenden Bauvorhabens anstelle einer Finanzierung aus dem laufenden Haushalt bestätigt.
194Soweit die Kläger bestreiten, dass die für die Bildung einer Baurücklage in Höhe von 5.3000.00,00 Euro notwendigen Voraussetzungen vorlägen, weil die Beklagte hierzu keinerlei Unterlagen vorgelegt habe, ist dies unbeachtlich. Auch im Hinblick auf die gerichtliche Amtsermittlungspflicht nach § 86 Abs. 1 VwGO gilt selbst für Fälle, in denen – wie hier im Hinblick auf die veranschlagten Kosten für den geplanten Neubau der IHK-Geschäftsstelle O. mit einem Prüfungs- und Weiterbildungszentrum – tatsächliche Umstände aus dem Bereich des Beklagten in Rede stehen, deren Überprüfung dem Kläger mangels eigener Kenntnis gar nicht möglich ist, das Gericht verlangen kann, dass der Kläger sein Bestreiten substantiiert, also Gründe für seine Zweifel anführt,
195vgl. BVerwG, Beschluss vom 25. August 2008 – 2 B 18/08 –, juris Rn. 13; BVerwG, Beschluss vom 2. November 2007 – 3 B 58/07 –, juris Rn. 6.
196Das ist hier aber nicht geschehen, obwohl den Klägern dies durchaus möglich gewesen wäre. Die Beklagte hat im hiesigen Verfahren substantiiert die veranschlagten Kosten für den geplanten Neubau der IHK-Geschäftsstelle O. mit einem Prüfungs- und Weiterbildungszentrum sowie ihre zeitlichen Pläne zur Finanzierung dieser Kosten vorgetragen. Die hierbei genannten Zahlen und Zeiträume entsprechen den in den vorgelegten Erläuterungen zum Nachtragswirtschaftsplan 2020 und Protokoll der Vollversammlung der Beklagten am 1. Dezember 2020 genannten Zahlen und Zeiträumen. Die Kläger haben hingegen die Notwendigkeit einer Baurücklage in Höhe von 5.300.00,00 Euro lediglich pauschal ohne Angabe von Gründen bestritten.
197bb. Für das Jahr 2021 wurden im Hinblick auf die Baurücklage keinerlei Rügen der Kläger vorgetragen. Die Rügen beschränken sich allein auf die Aufstockung der Baurücklage auf 5.298.000,00 Euro im Jahr 2020.
198c. Das Vorhalten einer Nettoposition in Höhe von 6.014.000,00 Euro in den Wirtschaftsplänen 2020 und 2021 ist nicht zu beanstanden. Hierdurch ist kein zweckfreies und zur Beitragsreduzierung zur Verfügung stehendes Vermögen im Sinne von § 3 Abs. 2 IHKG gebildet worden.
199Nach dem Verständnis der Nettoposition in der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gelten für die Höhe der Nettoposition dieselben Regelungen wie für die Rücklagenbildung. Wird eine Einstellung in die Nettoposition geplant, so bewirkt dies, dass der Erfolgsplan einen geringeren Bilanzgewinn ausweist, als dies ohne die Einstellung der Fall wäre. Wird ein geringerer Bilanzgewinn ausgewiesen, so steht er der Finanzierung der Aufgabenerfüllung der IHK nicht zur Verfügung. Dies hat einen erhöhten Mittelbedarf zur Folge, welcher durch die Erhebung von Beiträgen gedeckt werden muss. Die Festsetzung höherer Beiträge ist aber rechtswidrig, wenn die Einstellung in die Nettoposition zu Unrecht erfolgt. Denn in diesem Fall wären die Kosten der Tätigkeit im Sinne des § 3 Abs. 2 Satz 1 IHKG anderweitig gedeckt, wenn der Bilanzgewinn die zutreffende Höhe hätte,
200vgl. OVG Niedersachsen, Urteil vom 17. September 2018 – 8 LB 128/17 –, juris Rn. 146; bestätigt durch BVerwG, Urteil vom 22. Januar 20220 – 8 C 10-19 –, juris Rn. 32 ff.; a.A. noch VG Düsseldorf, Urteil vom 19. Juni 2018 – 20 K 6513/16 –, n.v.; VG Köln, Urteil vom 15. Februar 2017 – 1 K 1473/16 –, Rn. 95 ff.
201Die Nettoposition ist als Rechnungsposition in der Eröffnungsbilanz entstanden. Bei der Bilanzaufstellung wurde keine Rücksicht darauf genommen, welche Ursachen die Höhe der Differenz zwischen Aktivvermögen und Schulden hatte. Dass sie den Zweck gehabt hätte, das zur Erfüllung der Aufgaben der IHK notwendige, in Sachanlagen gebundene Vermögen zu ermitteln, lässt sich nicht sagen. Nach der ursprünglichen Funktion beim Ausgleich der Eröffnungsbilanz war sie unabhängig von Erwägungen einer angemessenen Eigenkapitalausstattung. Dass sie sich in den Folgebilanzen in der Regel nicht ändert, steht mit den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltswirtschaft im Zusammenhang. Der Verwaltungsträger bestand bereits vor der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und nahm seine Aufgaben wahr. War dies mit der Vermögens- und Kapitalausstattung möglich, die in der Eröffnungsbilanz abgebildet wurde, so besteht grundsätzlich kein Anlass, daran später etwas zu ändern. Aus alldem ergibt sich als Grundsatz des staatlichen Haushaltsrechts, dass die in der Eröffnungsbilanz ermittelte Nettoposition später grundsätzlich nicht geändert wird. Ausnahmen aus sachlichen Gründen sind möglich. Dies ist insbesondere bei einer Änderung der Verhältnisse, die der Ermittlung der Nettoposition zugrunde lagen, denkbar, so bei einer Änderung im Vermögensbestand und wohl auch beim Übergang von Fremd- zu Eigenfinanzierung des Immobilienvermögens durch Tilgung eines Immobiliendarlehens. § 3 Abs. 7a IHKG nimmt die Industrie- und Handelskammern von der Befolgung dieses Grundsatzes nicht aus,
202vgl. OVG Niedersachsen, Urteil vom 17. September 2018 – 8 LB 128/17 –, juris Rn. 152 ff.; bestätigt durch BVerwG, Urteil vom 22. Januar 20220 – 8 C 10-19 –, juris Rn. 32 ff.; a.A. noch VG Düsseldorf, Urteil vom 19. Juni 2018 – 20 K 6513/16 –, n.v.; VG Köln, Urteil vom 15. Februar 2017 – 1 K 1473/16 –, Rn. 95 ff.
203Dementsprechend regelt § 15a Abs. 1 Finanzstatut, dass die Nettoposition dem Unterschiedsbetrag zwischen Vermögen und Schulden unter Berücksichtigung von Rücklagen zum Stichtag der Eröffnungsbilanz entspricht. Sie kann bei erheblicher Änderung der aktuellen Verhältnisse beim unbeweglichen Sachanlagevermögen im Vergleich zum Eröffnungsbilanzstichtag angepasst werden. Sie darf im Regelfall nicht größer sein als das zur Erfüllung der Aufgaben der IHK notwendige um Sonderposten verminderte unbewegliche Sachanlagevermögen.
204Voraussetzung für eine zulässige Erhöhung der Nettoposition aufgrund einer Änderung der Verhältnisse ist hiernach allein, dass diese durch einen sachlichen Grund im Rahmen zulässiger Kammertätigkeit gedeckt ist. Einen solchen stellt jedoch insbesondere der Wunsch, langfristig gebundenes Anlagevermögen durch eine Erhöhung der Nettoposition dauerhaft in seinem Bestand zu sichern, nicht dar. So wenig die Kammern Vermögen bilden dürfen, so wenig dürfen sie es um seiner selbst willen bewahren. Auch das Anlagevermögen dient der Aufgabenerfüllung; auch sein Umfang muss durch einen sachlichen, aufgabenbezogenen Zweck gerechtfertigt sein. Das Anliegen, Vorkehrungen für einen noch nicht konkret absehbaren Finanzbedarf künftiger Jahre zu treffen, reicht dazu nicht aus. Ihm kann durch Rückstellungen mit zulässigem Zweck und Umfang und durch angemessene Rücklagen entsprochen werden. Dagegen legitimiert es weder eine Erhöhung der Nettoposition noch das Beibehalten ihrer unzulässigen Erhöhung,
205vgl. BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 10/19 –, juris Rn. 36.
206Diesen Vorgaben entspricht jedenfalls die mit der Nachtragswirtschaftsplanung für das Jahr 2020 auf 6.014.000,00 Euro reduzierte Nettoposition der Beklagten.
207Ausweislich der von der Beklagten überreichten Übersicht „IHK-Gebäude und Nettoposition zum Bilanzstichtag“ wurde die Nettoposition in der Eröffnungsbilanz mit 2.440.926,21 Euro ausgewiesen und blieb in dieser Höhe zunächst unverändert. Zum 31. Dezember 2017 wurde die Nettoposition um 4.529.073,79 Euro auf 6.970.000,00 Euro erhöht. Im Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2020 wurde die Nettoposition um 956.000,00 Euro auf 6.014.000,00 Euro reduziert. Dieser Betrag von 6.014.000,00 Euro entspricht gerundet einer Erhöhung der in der Eröffnungsbilanz mit 2.440.926,21 Euro ausgewiesen Nettoposition um den 2016 aktivierten Wert des Prüfungs- und Weiterbildungszentrums in Höhe von 3.572.816,12 Euro (2.440.926,21 Euro + 3.572.816,12 Euro = 6.013.742,33 Euro).
208Die Erhöhung der in der Eröffnungsbilanz mit 2.440.926,21 Euro ausgewiesen Nettoposition erfolgte um den 2016 aktivierten Wert des Prüfungs- und Weiterbildungszentrums in Höhe von 3.572.816,12 Euro auch zulässigerweise. Denn insoweit erfolgte sie aufgrund einer Änderung der Verhältnisse, die durch einen sachlichen Grund im Rahmen zulässiger Kammertätigkeit gedeckt war. Die Prüfung und Weiterbildung gehört zu den Kernaufgaben der IHKen; dementsprechend gehört auch das Vorhalten der hierfür erforderlichen Gebäude zu ihren Aufgaben.
209Die zwischenzeitlich darüber hinausschießende Erhöhung zum 31. Dezember 2017 um 956.257,67 Euro (4.529.073,79 Euro (tatsächliche Erhöhung) - 3.572.816,12 Euro (Wert des Prüfungs- und Weiterbildungszentrums)) wurde mit der Nachtragswirtschaftsplanung 2020 abgeschmolzen, da diese allein dem – nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts – unzulässigen Zweck, langfristig gebundenes Anlagevermögen dauerhaft in seinem Bestand zu sichern, gedient habe.
210Die Einwände der Kläger, die Erhöhung der Nettoposition zum 31. Dezember 2017 habe insgesamt nur dem unzulässigen Zweck, langfristig gebundenes Anlagevermögen dauerhaft in seinem Bestand zu sichern, gedient und die Beklagte habe die Erhöhung der Nettoposition anlässlich der Aktivierung des Prüfungs- und Weiterbildungszentrums lediglich nachträglich erdacht, was sich an der Bilanz zeige, ändern hieran nichts. Selbst unterstellt, diese Einwände träfen zu, hätte die Beklagte diese Fehler mit dem Nachtragswirtschaftsplan 2020 – wie bereits ausgeführt – korrigiert. Dieser war ausweislich seiner Erläuterungen und dem Protokoll der Vollversammlung vom 1. Dezember 2020 von dem Bestreben getragen, die Nettoposition auf ein zulässiges Maß zurückzuführen und sie der Höhe nach an die tatsächlich eingetretene Veränderung der Verhältnisse durch die Aktivierung des Wertes des Prüfungs- und Weiterbildungszentrums in Höhe von 3.572.816,12 Euro im Jahr 2016 anzupassen. Gelten – wie auch die Kläger selbst ausführen – für die Höhe der Nettoposition dieselben Regelungen wie für die Rücklagenbildung und ist deshalb ein Wirtschaftsplan nicht nur dann rechtswidrig, wenn er eine unzulässige Erhöhung der Nettoposition vorsieht, sondern auch dann, wenn er die Nettoposition in rechtswidriger Höhe beibehält,
211vgl. OVG Niedersachsen, Urteil vom 17. September 2018 – 8 LB 128/17 –, juris Rn. 146,
212so muss es der Beklagten im Rahmen ihrer jährlichen Wirtschaftsplanung möglich sein, die Nettoposition in dieser Form für die Zukunft wieder auf ein zulässiges Maß zurückzuführen, selbst wenn sich hierdurch ein zeitlicher Versatz zwischen der Anpassung der Nettoposition und der sie rechtfertigenden Veränderungen ergibt.
213Dies wird – wie die Beklagte zutreffend vorträgt – auch durch die Berichte des Landesrechnungshofes des Landes Nordrhein-Westfalen 15. Mai 2019 und 4. März 2020 bestätigt. In den Berichten wurde die Möglichkeit einer Erhöhung der Nettoposition gem. § 15a Abs. 1 Finanzstatut aufgrund erheblicher Veränderungen beim unbeweglichen Sachanlagevermögen grundsätzlich anerkannt. Lediglich in Höhe von „rd. 1 Mio. €“ wurde die von der Beklagten zum 31. Dezember 2017 durchgeführte Erhöhung als überhöht betrachtet. Dieser Betrag entspricht dem mit der Nachtragswirtschaftsplanung 2020 abgeschmolzenen Betrag.
214Dass das Vorhalten der Nettoposition gegen Bilanzrecht verstieße, an das die Beklagte gem. § 3 Abs. 7a IHKG und §§ 238 ff. Handelsgesetzbuch gebunden ist,
215vgl. BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 10/19 –, juris Rn. 37,
216haben die Kläger nicht vorgetragen und ist auch sonst nicht ersichtlich.
217d. Schließlich begegnet die Verwendung der aufgrund des Nachtragswirtschaftsplanes für das Jahr 2020 frei werdenden Mittel für die im Wirtschaftsplan 2021 vorgesehene Dotierung der Ausgleichsrücklage sowie den Ausgleich des im Wirtschaftsplan 2021 vorgesehenen negativen Planergebnisses 2021 keinen Bedenken.
218Nach § 15a Abs. 3 Finanzstatut können Ergebnisse auf neue Rechnung vorgetragen werden. Sie sind spätestens im zweiten der Entstehung folgenden Geschäftsjahr den Rücklagen zuzuführen oder im darauf folgenden Geschäftsjahr für den Ausgleich des Erfolgsplanes heranzuziehen. Dieser für den Haushalt der Beklagten in § 15a Abs. 3 Finanzstatut niedergelegte haushaltsrechtliche Grundsatz entspricht auch den Bestimmungen des staatlichen Haushaltsrechts, wonach ein Haushaltsüberschuss in den nächsten festzustellenden Haushaltsplan einzustellen ist (vgl. § 25 Abs. 2 Bundeshaushaltsordnung). Für die IHKen folgt dieser Grundsatz auch aus dem aus § 3 Abs. 2 Satz 1 IHKG folgenden Verbot der Vermögensbildung. Dementsprechend nimmt auch die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung als für IHKen allgemein – unabhängig vom Finanzstatut – geltenden haushaltsrechtlichen Grundsatz an, dass ein ungeplanter Bilanzgewinn zeitnah für die Finanzierung der gesetzlichen Aufgaben der IHK einzusetzen ist. In der Regel dürfte sie diesen spätestens in den nächsten zeitlich auf die Feststellung des Gewinns nachfolgenden Wirtschaftsplan einstellen müssen,
219vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 23. September 2014, – 6 A 11345/13 –, juris, Rn. 21; VG Köln, Urteil vom 15. Februar 2017 – 1 K 1473/16 –, juris Rn. 88 ff.; VG München, Urteil vom 20. Januar 2015, – M 16 K 13.2277 –, juris, Rn. 25.
220Die vorzitierten Bestimmungen und Grundsätze gelten unmittelbar zwar nur für den Jahresabschluss, also die Verwendung eines positiven Ergebnisses des Jahresabschlusses. Nach Auffassung des Gerichts ist jedoch kein Grund ersichtlich, weshalb sie nicht jedenfalls auch für nahezu am Ende eines Wirtschaftsjahres aufgrund eines Nachtragswirtschaftsplans frei werdenden Mittel gelten sollten. Der Jahresabschluss vollzieht lediglich ein bereits vollständig abgeschlossenes Wirtschaftsjahr nach. Er erfolgt üblicherweise im Folgejahr zu einem Zeitpunkt, zu dem auch die Wirtschaftsplanung für dieses Folgejahr bereits abgeschlossen ist, sodass – wie die Beklagte vorträgt – das im Jahresabschluss festgestellte positive Ergebnis erst in der Wirtschaftsplanung für das darauffolgende Jahr verplant werden kann. Bei der Nachtragswirtschaftsplanung ist das betroffene Wirtschaftsjahr zwar noch nicht abgeschlossen (vgl. § 10 Abs. 2 Satz 1 Finanzstatut); vielmehr wird die bestehende Wirtschaftsplanung für das laufende Jahr überarbeitet. Erfolgt die Nachtragswirtschaftsplanung jedoch – wie hier – zu einem Zeitpunkt, zu dem das Wirtschaftsjahr nahezu abgeschlossen ist, bestehen ähnlich wie im Falle eines Jahresabschlusses kaum mehr Möglichkeiten, hierbei frei werdende Mittel ohne Weiteres im Rahmen der Nachtragsplanung für dieses Wirtschaftsjahr zu verwenden.
221Für die Übertragbarkeit der Regelungen zum Gewinnvortrag spricht auch die Regelung in § 10 Abs. 2 Satz 2 Finanzstatut, wonach im Rahmen eines Nachtragswirtschaftsplans ein positives Ergebnis geplant werden kann. Ein solches positives Ergebnis könnte dann wiederrum nach § 15a Abs. 3 Finanzstatut vorgetragen werden.
222Hiervon ausgehend genügt der Nachtragswirtschaftsplan 2020 bzw. der Wirtschaftsplan 2021 diesem haushaltsrechtlichen Grundsatz bzw. der Bestimmung des § 15a Abs. 3 Finanzstatut. Denn die Beklagte hat die ihr zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehenden frei gewordenen Mittel unmittelbar für die Dotierung der Ausgleichsrücklage und den Ausgleich des negativen Jahresergebnisses im Jahr 2021 eingesetzt. Sowohl in den Erläuterungen zum Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2020 als auch in dem Protokoll der Hauptversammlung am 1. Dezember 2020 wird ausgeführt, dass sich das aufgrund der Nachtragswirtschaftsplanung im Jahr 2020 ergebende positive Ergebnis in Höhe von 2.779.000,00 Euro (bestehend aus 5.830.000,00 Euro aufgelöster Ausgleichsrücklage 2020, 956.000,00 Euro reduzierter Nettoposition sowie sonstigen Überschüssen) für die Dotierung der Ausgleichsrücklage 2021 in Höhe von 1.655.000,00 Euro sowie die Senkung des Umlagehebesatzes 2021 um 350.000,00 Euro und des Ausgleichs der Plan-Guv 2021 in Höhe von 774.000,00 Euro (letztere zusammen 1.124.000,00 Euro) verwendet werde.
223Der Einwand der Kläger, ein Verstoß gegen das Gebot der Jährlichkeit liege darin, ein für das Folgejahr geplantes negatives Ergebnis durch Einnahmen aus dem Vorjahr zu decken, da durch eine Verwendung dieser freiwerdenden Mittel zur Vermeidung zukünftiger Beitragserhöhungen der Zeitpunkt der Beitragsbelastung verschoben werde, obgleich die Beklagte nur so viel an Beiträgen erheben dürfe wie erforderlich,
224vgl. VG Stuttgart, Urteil vom 8. November 2018 – 4 K 17366/17 –, juris Rn. 71,
225greift nicht durch. Hierin kommt ein zu enges Verständnis des Jährlichkeitsgebots zum Ausdruck. Das Prinzip der Jährlichkeit besagt nicht, dass in einem Wirtschaftsjahr frei werdende Mittel zwingend denjenigen Mitgliedern der IHK zugutekommen müssen, die im Jahr ihrer Entstehung Mitglieder waren. Die körperschaftliche Struktur der IHK begründet gerade eine Trennung zwischen der kontinuierlichen Aufgabenwahrnehmung durch die Körperschaft des öffentlichen Rechts und dem fluktuierenden Mitgliederbestand. Die Mitglieder haben einen die Beitragserhebung rechtfertigenden Vorteil durch die in den Mitgliedschaftsrechten stets gebotene Möglichkeit, die eigenen Interessen in das Kammergeschehen einzubringen. Ein Verhältnis von Leistung und Gegenleistung besteht nicht. Vor diesem Hintergrund erscheint es ausreichend, wenn die freiwerdenden Mittel in solchen zeitlichen Grenzen, innerhalb derer noch von einer Finanzierung der Kammertätigkeit gesprochen werden kann, verwendet werden. Hiervon ist bei dem in § 15a Abs. 3 Finanzstatut genannten Zeitrahmen auszugehen,
226vgl. OVG Niedersachsen, Urteil vom 17. September 2018 – 8 LB 128/17 –, juris Rn. 209.
227In diesem Zusammenhang entbehren auch die Vorwürfe der Kläger, ein negatives Ergebnis für das Jahr 2021 sei bewusst geplant worden, um die im Jahr 2020 frei werdenden Mittel nicht auskehren zu müssen, jeder Grundlage. Im Wirtschaftsplan 2021 nebst zugehöriger Plan-GuV für das Jahr 2021 wird der Mittelbedarf für das Jahr 2021 detailliert dargestellt. Dass dieser Bedarf fehlerhaft prognostiziert worden wäre, tragen die Kläger nicht vor und ist auch sonst nicht ersichtlich. Gleiches gilt für den Einwand der Kläger, die Beklagte habe die aufgrund der notwendigen Neudotierung der Ausgleichsrücklage frei werdenden Mittel in andere Rücklagen „umgetopft“, ohne dass hierfür eine Rechtfertigung bestanden habe.
228Bei dieser Vorgehensweise besteht auch ein deutlicher Unterschied zu der vom Bundesverwaltungsgericht in seiner aktuellen Rechtsprechung im Hinblick auf die Ausgleichsrücklage für unzulässig erachtete finanzielle Risikovorsorge für mehrere Jahre. Diesbezüglich führte das Bundesverwaltungsgericht aus:
229„Darüber hinaus ist die angesetzte Höhe der Ausgleichsrücklage […] unangemessen, weil sie nach dem Dreifachen des prognostizierten Beitragsausfalls berechnet wurde. Die Höhe der Rücklage hätte nur mit der Prognose gerechtfertigt werden können, dass es im jeweiligen Haushaltsjahr realistischer Weise zu Ausfällen von Beitragszahlungen in der angenommenen Gesamthöhe kommen könne […]. Den prognostizierten Ausfall zu verdreifachen, nimmt einen Beitragsausfall in den beiden Folgejahren vorweg, der wegen des haushaltsrechtlichen Grundsatzes der Jährlichkeit der Haushalts- und Wirtschaftsplanung noch nicht zu prognostizieren war und nach § 3 Abs. 2 IHKG nicht auf die Beitragszahler des verfahrensgegenständlichen Wirtschaftsjahres umgelegt werden durfte.“ (BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 11/19 –, juris Rn. 27; BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 10/19 –, juris Rn. 28; BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 9/19 –, juris Rn. 25).
230Allerdings wurde in den vom Bundesverwaltungsgericht entschiedenen Fällen zu Beginn eines Wirtschaftsjahres die Höhe der Ausgleichsrücklage pauschal in dreifacher Höhe des prognostizierten Ausfalls festgesetzt, um Beitragsausfälle in den folgenden Beitragsjahren vorwegzunehmen und so Beitragsschwankungen zu vermeiden. Hingegen ist die Beklagte hier – aufgrund einer vom Bundesverwaltungsgericht ebenfalls geforderten Ausschöpfung aller naheliegenden Möglichkeiten der Informationsgewinnung – bei der Nachtragswirtschaftsplanung insbesondere aufgrund der Erkenntnisse aus dem bereits abgelaufenen Teil des Wirtschaftsjahres zu der Erkenntnis gelangt, für das laufende Wirtschaftsjahr bestünden keine Risiken mehr, die Mittel könnten jedoch zur Absicherung der Risiken im unmittelbar darauffolgenden Wirtschaftsjahr verwendet werden, dessen Wirtschaftsplanung ebenfalls bereits schon erstellt wurde. Beide Konstellationen sind nicht miteinander vergleichbar und daher auch rechtlich unterschiedlich zu bewerten.
231e. Eine weitere, ins Einzelne gehende Überprüfung der Rücklagenbildung, der Mittelverwendung und der Nettoposition war aufgrund des Vorbringens der Kläger nicht angezeigt. Die Kläger haben, obwohl sie mit gerichtlichem Hinweis vom 15. Februar 2022 darauf hingewiesen wurden, dass in die von der Beklagten übersandten Verwaltungsvorgänge Einsicht genommen werden kann, hiervon keinen Gebrauch gemacht. Zahlreiche für die Wirtschaftsplanung der Beklagten für die Jahre 2020 und 2021 maßgebliche Dokumente sind auf der Homepage der Beklagten für jedermann abrufbar: Die Wirtschaftssatzung und der Wirtschaftsplan 2020, die Wirtschaftssatzung und der Wirtschaftsplan 2021, die Nachtragswirtschaftssatzung 2020 und der Nachtragswirtschaftsplan 2020,
232https://www.ihk-L. .de/de/wir-ueber-uns/rechtsgrundlagen/index.html, Datum des Abrufs: 16. Mai 2022
233das Protokoll der Vollversammlung der Beklagten am 1. Dezember 2020,
234https://www.ihk-L. .de/de/ehrenamt/protokoll-zur-sitzung-der-vollversammlung-am-01.12.2020-stand-09.12.2020-mit-er.pdf, Datum des Abrufs: 16. Mai 2022.
235Die verwaltungsgerichtliche Amtsermittlungspflicht geht vor diesem Hintergrund nicht so weit, dass pauschalen Verdachtsäußerungen nachgegangen werden muss. Denn die Untersuchungsmaxime ist keine prozessuale Hoffnung, das Gericht werde mit ihrer Hilfe die klagebegründenden Tatsachen ermitteln. Auch die grundsätzliche Gestaltungsfreiheit der IHKen bei der Aufstellung ihres Haushaltes verbietet es, aus Anlass eines Beitragsbescheides die gesamte Wirtschaftsführung der Kammer im Detail zu durchleuchten,
236vgl. OVG NRW, Urteil vom 13. April 2005 – 9 A 3120/03 –, juris Rn. 77; VG Ansbach, Urteil vom 30. November 2017 – AN 4 K 17.00537 –, juris Rn. 22 ff.; VG Düsseldorf, Urteil vom 15. November 2017 – 20 K 5579/17 –, juris Rn. 98; VG Düsseldorf, Gerichtsbescheid vom 10. Februar 2016 – 20 K 3039/15 –, juris Rn. 30.
2372. Dass die konkrete Beitragsfestsetzung für die Kläger in den Jahren 2020 und 2021 auf der zweiten Stufe aufgrund der Umlegung des im Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) festgesetzten Mittelbedarfs durch die Beitragsordnung auf die Kammerzugehörigen rechtswidrig wäre, wurde von den Klägern nicht vorgetragen und ist auch sonst nicht ersichtlich.
238D. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Hierbei war zu berücksichtigen, dass hinsichtlich der außergerichtlichen Kosten der Kläger getrennte Prozessrechtsverhältnisse zwischen den einzelnen Klägern und der Beklagten bestehen und lediglich hinsichtlich der Gerichtskosten sowie der außergerichtlichen Kosten der an allen Prozessrechtsverhältnissen beteiligten Beklagten eine gemeinsame Kostenquote zu bilden war. Die Kostenquoten der einzelnen Kläger entsprechen dem Anteil des Streitwertes ihrer ursprünglich erhobenen Einzelklagen an dem Gesamtstreitwert nach der Verbindung der Verfahren. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit findet im Verhältnis der Beklagten zu den Klägern zu 1. bis 5. sowie zu der Klägerin zu 8. ihre Grundlage in § 167 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 VwGO in Verbindung mit §§ 708 Nr. 11, 709 Satz 2, 711 Zivilprozessordnung (ZPO), im Verhältnis der Beklagten zu den Klägerinnen zu 6. und 7. in § 167 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 VwGO in Verbindung mit § 709 ZPO.
239Die Berufung ist von Amts wegen gem. § 124a Abs. 1 Satz 1 VwGO zuzulassen, da die Voraussetzungen des § 124 Abs. 2 Nr. 3 und 4 VwGO vorliegen.
240Rechtsmittelbelehrung:
241Gegen dieses Urteil kann innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils bei dem Verwaltungsgericht Düsseldorf (Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf oder Postfach 20 08 60, 40105 Düsseldorf) schriftlich Berufung eingelegt werden. Die Berufung muss das angefochtene Urteil bezeichnen.
242Auf die ab dem 1. Januar 2022 unter anderem für Rechtsanwälte, Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts geltende Pflicht zur Übermittlung als elektronisches Dokument nach Maßgabe der §§ 55a, 55d Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – und der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV –) wird hingewiesen.
243Die Berufung ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils zu begründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich mit der Einlegung der Berufung erfolgt, bei dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster oder Postfach 6309, 48033 Münster) schriftlich einzureichen.
244Die Begründungsfrist kann auf einen vor ihrem Ablauf gestellten Antrag von dem Vorsitzenden des Senats verlängert werden. Die Begründung muss einen bestimmten Antrag enthalten sowie die im Einzelnen anzuführenden Gründe der Anfechtung (Berufungsgründe).
245Im Berufungsverfahren müssen sich die Beteiligten durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die das Verfahren eingeleitet wird. Die Beteiligten können sich durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt besitzt, als Bevollmächtigten vertreten lassen. Auf die zusätzlichen Vertretungsmöglichkeiten für Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse wird hingewiesen (vgl. § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO und § 5 Nr. 6 des Einführungsgesetzes zum Rechtsdienstleistungsgesetz – RDGEG –). Darüber hinaus sind die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisationen unter den dort genannten Voraussetzungen als Bevollmächtigte zugelassen.
246Die Berufungsschrift und die Berufungsbegründungsschrift sollen möglichst dreifach eingereicht werden. Im Fall der Einreichung als elektronisches Dokument bedarf es keiner Abschriften.Beschluss
247Der Streitwert wird für die Zeit bis zur Verbindung der Verfahren zur gemeinsamen Entscheidung mit Beschluss vom 18. Mai 2022
248- im Verfahren 20 K 730/20 auf 176,00 Euro,
249- im Verfahren 20 K 2227/21 auf 176,00 Euro,
250- im Verfahren 20 K 2311/21 auf 352,00 Euro,
251- im Verfahren 20 K 1527/21 auf 135,69 Euro,
252- im Verfahren 20 K 1926/21 auf 254,68 Euro,
253- im Verfahren 20 K 2222/21 auf 2.162,54 Euro,
254- im Verfahren 20 K 2223/21 auf 11.720,43 Euro,
255- im Verfahren 20 K 2224/21 auf 1.036,94 Euro,
256- im Verfahren 20 K 2225/21 auf 5.629,64 Euro,
257- im Verfahren 20 K 2226/21 auf 764,00 Euro
258sowie für die Zeit nach der Verbindung auf 22.407,92 Euro festgesetzt.
259Gründe:
260Die Festsetzung des Streitwertes ist nach § 52 Abs. 3 Satz 1 GKG in dem Umfang, in dem die Kläger die an sie gerichteten Beitragsbescheide angefochten haben, erfolgt.
261Rechtsmittelbelehrung:
262Gegen den Streitwertbeschluss kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle bei dem Verwaltungsgericht Düsseldorf (Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf oder Postfach 20 08 60, 40105 Düsseldorf) Beschwerde eingelegt werden, über die das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster entscheidet, falls ihr nicht abgeholfen wird. § 129a der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.
263Auf die ab dem 1. Januar 2022 unter anderem für Rechtsanwälte, Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts geltende Pflicht zur Übermittlung als elektronisches Dokument nach Maßgabe der §§ 55a, 55d Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – und der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV –) wird hingewiesen.
264Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten eingelegt wird, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat; ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann sie noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden.
265Die Beschwerde ist nicht gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- Euro nicht übersteigt.
266Die Beschwerdeschrift soll möglichst dreifach eingereicht werden. Im Fall der Einreichung als elektronisches Dokument bedarf es keiner Abschriften.
267War der Beschwerdeführer ohne sein Verschulden verhindert, die Frist einzuhalten, ist ihm auf Antrag von dem Gericht, das über die Beschwerde zu entscheiden hat, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren, wenn er die Beschwerde binnen zwei Wochen nach der Beseitigung des Hindernisses einlegt und die Tatsachen, welche die Wiedereinsetzung begründen, glaubhaft macht. Nach Ablauf eines Jahres, von dem Ende der versäumten Frist angerechnet, kann die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt werden.