 Seite drucken
Seite drucken
 Entscheidung als PDF runterladen
Entscheidung als PDF runterladen
 Seite drucken
Seite drucken
 Entscheidung als PDF runterladen
Entscheidung als PDF runterladen

1. In Fortführung des Grundsatzes, wonach gleichen Begriffen im Rahmen eines Patentanspruchs im Zweifel auch die gleiche Bedeutung beizumessen ist (BGH, GRUR 2017, 152 Rn. 17 – Zungenbett), kommt unterschiedlichen Begriffen im Zweifel auch eine unterschiedliche Bedeutung zu und deutet eine sprachliche Differenzierung somit auf ein unterschiedliches Verständnis hin. Wie es aber auch nach dem erstgenannten Grundsatz nicht ausgeschlossen ist, dass gleichen Begriffen in unterschiedlichen Zusammenhängen doch unterschiedliche Bedeutungen zukommen, ist es ebenso wenig ausgeschlossen, dass unterschiedliche Begriffe in einem Patentanspruch die gleiche Bedeutung haben oder dass einer sprachlichen Differenzierung nicht mehr als eine klarstellende Wirkung zukommt. Dies ist anzunehmen, wenn die Auslegung des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit unter Berücksichtigung auch der Beschreibung und der Kennzeichnungen ein solches Verständnis ergibt.
2. Offenbarung und Schutzbereich haben unmittelbar nichts miteinander zu tun. Dass eine bestimmte Ausgestaltung nicht in der Patentschrift beschrieben ist, bedeutet daher nicht, dass sie nicht unter den Patentanspruch fallen kann.
3. Es hat bei der Auslegung des Patentanspruchs außer Betracht zu bleiben, ob diese zu einem Ergebnis führt, bei dem der Patentanspruch eine unzulässige Erweiterung gegenüber den Ursprungsunterlagen enthält.
4. Sowohl der Verfahrensanspruch als Ganzes als auch der technische Zusammenhang, in dem die einzelnen Verfahrensschritte in der Beschreibung des Patents geschildert werden, kann zu einer Vorgabe für die Abfolge der Verfahrensschritte führen. Insoweit kommt es unter anderem darauf an, ob der Patentanspruch zusammen mit der Beschreibung zum Ausdruck bringt, dass für einzelne Verfahrensschritte eine bestimmte, durch andere vorangegangene Verfahrensschritte hervorgebrachte technische Situation vorausgesetzt wird, oder ob aufgrund des Fehlens eines solchen technischen Zusammenhangs einzelne Verfahrensschritte technisch getrennt sowie in zeitlicher Hinsicht unabhängig voneinander und demnach ohne die Einhaltung einer bestimmten Reihenfolge vorgenommen werden können.
I. Die Berufung der Beklagten gegen das am 15.08.2023 verkündete Urteil der 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf, ergänzt mit Ergänzungsurteil vom 17.10.2023, wird mit den Maßgaben zurückgewiesen, dass
im Tenor zu I. 1. a) nach dem ersten Wort „Elemente“ der Zusatz „insbesondere Elemente“ gestrichen wird;
im Tenor zu I. 1. b) (1) nach den Wörtern „zwischen dem 02.05.2007 und dem 20.03.2021“ das Wort „hergestellt“ gestrichen wird.
II. Die Anschlussberufung der Klägerin wird zurückgewiesen.
III. Von den Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Beklagte zu 1) 80 % und die Beklagte zu 2) 20 %.
VI. Dieses Urteil und das Urteil des Landgerichts sind vorläufig vollstreckbar.
Die Beklagte zu 1) darf die Zwangsvollstreckung der Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 350.000,- EUR abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Die Beklagte zu 2) darf die Zwangsvollstreckung der Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 100.000,- EUR abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Die Klägerin darf die Zwangsvollstreckung der Beklagten gegen Sicherheitsleistung in Höhe des aufgrund des Urteils des Landgerichts zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagten vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leisten.
V. Die Revision wird nicht zugelassen.
VI. Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 460.000,- EUR festgesetzt.
Davon entfallen 350.000,- EUR auf die Berufung der Beklagten zu 1), 100.000,- EUR auf die Berufung der Beklagten zu 2) und bis zu 10.000,- EUR auf die Anschlussberufung der Klägerin.
G r ü n d e :
Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des deutschen Teils des in englischer Verfahrenssprache erteilten europäischen Patents EP …..192 (englischsprachige B1-Schrift nebst der als DE …..214 T2 veröffentlichten deutschen Übersetzung sowie der als DE …..214 C5 veröffentlichten geänderten Patentschrift vorgelegt als Anlage CBH 5; nachfolgend: Klagepatent) auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch.
3Das Klagepatent, dessen eingetragene Inhaberin die Klägerin ist, wurde am 20.03.2001 unter Inanspruchnahme einer britischen Priorität vom 15.04.2000 angemeldet. Der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents wurde am 02.05.2007 veröffentlicht. Das Klagepatent ist mit Ablauf des 20.03.2021 infolge Zeitablaufs erloschen.
4In einem von der Beklagten zu 1) und der A. GmbH gegen das Klagepatent geführten Nichtigkeitsverfahren vernichtete das Bundespatentgericht das Klagepatent in erster Instanz (Urt. v. 23.01.2013 – 1 Ni 1/12 (EP), 1 Ni 25/12, Anlage ES 3, BeckRS 2013, 5484, nachfolgend nach der BeckRS-Fundstelle zitiert als: Urteil BPatG I). Auf die dagegen gerichtete Berufung hob der Bundesgerichtshof die Entscheidung des Bundespatentgerichts auf und verwies die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung zurück (Urt. v. 12.05.2015 – X ZR 43/13, Anlage CBH 3, GRUR 2015, 875 – Rotorelemente; nachfolgend nach der GRUR-Fundstelle zitiert als: BGH-Urteil „Rotorelemente“).
5Nach Zurückverweisung der Sache hielt das Bundespatentgericht das Klagepatent in eingeschränkter Fassung aufrecht (Urt. v. 21.09.2016 – 6 Ni 16/15 (EP), 6 Ni 17/15 (EP), BeckRS 2016, 113911, nachfolgend nach der BeckRS-Fundstelle zitiert als: Urteil BPatG II). Die dagegen gerichtete Berufung der Nichtigkeitsklägerinnen wies der Bundesgerichtshof zurück (Urt. v. 06.11.2018 – X ZR 18/17, Anlage CBH 4, BeckRS 2018, 36496, nachfolgend nach der BeckRS-Fundstelle zitiert als: BGH-Urteil „Stanzanordnung in Schenkelpolmaschine“).
6Mit Schriftsatz vom 25.03.2024 (Anlage ES 6) hat die Beklagte zu 2) eine weitere das Klagepatent betreffende Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht eingereicht (4 Ni 13/24 (EP)).
7Das Klagepatent trägt die Bezeichnung „………………..“. Die Klägerin macht die Ansprüche 1 (Vorrichtungsanspruch) und 6 (Verfahrensanspruch) in der eingeschränkt aufrechterhaltenen Fassung geltend, die in der englischen Verfahrenssprache wie folgt lauten, wobei Änderungen gegenüber der erteilten Fassung durch Unterstreichungen gekennzeichnet sind:
8Anspruch 1:
9„A machine for the manufacture of elements (8) from strip stock, the elements (8) in use being stacked to provide an assembly of stacked elements (8) for an electrical motor, each element (8) including body (10) and pole (12) portions which are integrally formed, the machine including a die assembly including a first die member (22) for providing by punching at least parts of the body portions (10) of each element and a second die member (32) for providing by punching, the pole portions (12) of each element (8), and characterised in that the body and pole die members (22, 32) are relatively moveable between successive punching operations when the body and pole portions (10, 12) of the elements (8) are provided, whereby incremental adjustment of the position of the second die member (32) relative to the first die member (22) is effected so that whilst each of the body portions (10) of the elements (8) is provided along a common centre line, the pole portion (12) of each of the successive elements (8) is incrementally offset relative to the pole portion (12) of each of the respective previous elements (8) with respect to the said common centre line of the body portion (10) and in that the first die member (22) is maintained stationary relative to a base (20) of the machine, and the second die member (32) is moved incrementally between successive punching operations relative to the first die member (22) and the base (20).“
10Anspruch 6:
11„A method of manufacturing elements (8) using a machine according to any one of the preceding claims, from strip stock, the elements (8) in use being stacked to provide an assembly of stacked elements (8) for an electrical motor, each element (8) including body (10) and pole (12) portions which are integrally formed, the machine including a die assembly including a first die member (22) for providing by punching at least parts of the body portions (10) of each element and a second die member (32) for providing by punching, the pole portions (12) of each element (8), and characterised in that the method includes relatively moving the first and second die members (22, 32) between successive punching Operations when the body and pole portions (10, 12) of the elements (8) are provided, whereby incremental adjustment of the position of the second die member (32) relative to the first die member (22) is effected so that whilst each of the body portions (10) of the elements (8) is provided along a common centre line, the pole portion (12) of each of the successive elements (8) is incrementally offset relative to the pole portion (12) of each of the respective previous elements (8) with respect to the said common centre line.“
12In deutscher Übersetzung lauten die Ansprüche in ihrer eingeschränkten Fassung mit wiederum hervorgehobenen Änderungen wie folgt:
13Anspruch 1:
14„Vorrichtung zum Herstellen von Elementen (8) aus bandförmigem Material, wobei die Elemente (8) im Gebrauch aufeinander gestapelt werden, um eine Anordnung von gestapelten Elementen (8) für eine elektrische Maschine zu bilden, wobei jedes Element (8) Grundkörper- (10) und Polabschnitte (12) aufweist, die integral ausgebildet sind, wobei die Maschine eine Stanzanordnung aufweist, die mit einem ersten Stanzelement (22) versehen ist, zum Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Grundkörperabschnitte (10) eines jeden Elements, und ein zweites Stanzelement (32) zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Polabschnitte (12) eines jeden Elements (8), und dadurch gekennzeichnet, daß die Stanzelemente (22, 32) für Grundkörper und Pole relativ zueinander bewegbar sind, zwischen aufeinanderfolgenden Stanzvorgängen, wenn die Grundkörper- und Polabschnitte (10, 12) der Elemente (8) gebildet werden, wobei eine schrittweise Einstellung der Position des zweiten Stanzelements (32) relativ zu dem ersten Stanzelement (22) so ausgeführt wird, daß während jeder der Grundköperabschnitte (10) der Elemente (8) entlang einer gemeinsamen Mittellinie gebildet wird, der Polabschnitt (12) eines jeden der aufeinanderfolgenden Elemente (8) schrittweise relativ zu dem Polabschnitt (12) eines jeden entsprechenden vorangehenden Elements (8) in Bezug auf die genannte gemeinsame Mittellinie des Grundkörperabschnitts (10) versetzt ist, und dass das erste Stanzelement (22) relativ zu einer Maschinenbasis (20) ortsfest gehalten wird, und dass das zweite Stanzelement (32) schrittweise zwischen aufeinanderfolgenden Ausstanzvorgängen relativ zu dem ersten Stanzelement (22) und der Maschinenbasis (20) bewegt wird.“
15Anspruch 6:
16„Verfahren zum Herstellen von Elementen (8) unter Verwendung einer Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, ausgehend von bandförmigem Material, wobei die Elemente (8) im Gebrauch aufeinander gestapelt werden, um eine Anordnung von gestapelten Elementen (8) für eine elektrische Maschine zu bilden, wobei jedes Element (8) Grundkörper- (10) und Polabschnitte (12) aufweist, die integral ausgebildet sind, wobei die Maschine eine Stanzanordnung aufweist, die mit einem ersten Stanzelement (22) versehen ist, zum Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Grundkörperabschnitte (10) eines jeden Elements, und ein zweites Stanzelement (32) zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Polabschnitte (12) eines jeden Elements (8), und dadurch gekennzeichnet, daß das Verfahren umfaßt, die ersten und zweiten Stanzelemente (22, 32) relativ zueinander zu bewegen, zwischen aufeinanderfolgenden Stanzvorgängen, wenn die Grundkörper- und Polabschnitte (10, 12) der Elemente (8) gebildet werden, wobei eine schrittweise Einstellung der Position des zweiten Stanzelements (32) relativ zu dem ersten Stanzelement (22) so ausgeführt wird, daß während jeder der Grundköperabschnitte (10) der Elemente (8) entlang einer gemeinsamen Mittellinie gebildet wird, der Polabschnitt (12) eines jeden der aufeinanderfolgenden Elemente (8) schrittweise relativ zu dem Polabschnitt (12) eines jeden entsprechenden vorangehenden Elements (8) in Bezug auf die genannte gemeinsame Mittellinie versetzt ist.“
17Die nachfolgend verkleinert wiedergegebene Figur 4a der Klagepatentschrift zeigt eine bevorzugte Ausführungsform einer Vorrichtung, die für die Herstellung der Elemente verwendet wird:
18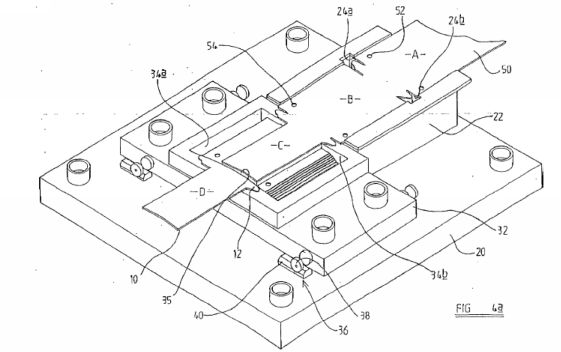
Die Beklagte zu 1), deren Tochtergesellschaft die Beklagte zu 2) ist, ist die operative Obergesellschaft der B.-Gruppe, einem unter anderem auf die Herstellung und den Vertrieb von Windenergieanlagen spezialisierten Energieunternehmen.
20Die Klägerin hat gegen die C. GmbH ein durch Antrag vom 15.02.2021 eingeleitetes selbstständiges Beweisverfahren vor dem Landgericht geführt (4b O 7/21), in dessen Rahmen der Sachverständige Dipl.-Ing. D. nach einer am 04.03.2021 vorgenommenen Besichtigung ein Gutachten sowie ein Ergänzungsgutachten (gemeinsam vorgelegt als Anlage CBH 8) erstellt hat. Die Beklagte zu 2) hat die C. GmbH im Wege der Verschmelzung als übernehmender Rechtsträger übernommen.
21Die Klägerin wendet sich gegen die in der Vergangenheit liegende Herstellung, das Anbieten und Liefern von einteiligen Polschuhblechen bzw. Rotorelementen durch die Beklagte zu 2), die mittels Stanzmaschinen produziert und die für Generatoren in Windenergieanlagen verwendet werden. Ferner wendet sie sich dagegen, dass die so von der Beklagten zu 2) hergestellten und an die Beklagte zu 1) gelieferten Rotorelemente von dieser in den von ihr angebotenen, gelieferten und betriebenen Windenergieanlagen, beispielsweise der X1, verbaut werden.
22Damit greift die Klägerin zum einen die durch die Beklagte zu 2) bei der Herstellung der Rotorelemente verwendete Vorrichtung (angegriffene Ausführungsform) und zum anderen Angebot, Vertrieb und Benutzung der mit dem angegriffenen Verfahren hergestellten Rotorelemente (angegriffene Erzeugnisse) durch beide Beklagte an.
23Ausdrücklich von der Klage ausgenommen hat die Klägerin solche Verfahrenserzeugnisse, die die Beklagte zu 1) von der A. GmbH bezogen hat. Diese waren bereits Gegenstand eines von der Klägerin gegen die Beklagte zu 1) und die A. GmbH geführten früheren Verletzungsverfahrens vor dem Landgericht Düsseldorf (4b O 121/12), welches nach einem außergerichtlichen Vergleich beendet wurde.
24Die Klägerin sieht in den genannten Benutzungshandlungen in der Bundesrepublik Deutschland eine unmittelbare Verletzung des Klagepatents. Die Beklagten machten von dessen technischer Lehre wortsinngemäß, jedenfalls aber – wenn man der Auslegung der Beklagten folgen wollte – mit äquivalenten Mitteln Gebrauch.
25Die Beklagten, die Klageabweisung beantragt haben, haben bereits erstinstanzlich eine Verletzung des Klagepatents in Abrede gestellt. Sie haben sich ferner darauf berufen, dass ein Schadensersatzanspruch aufgrund eines entschuldbaren Rechtsirrtums bereits dem Grunde nach ausgeschlossen sei oder der Klägerin wegen deren nicht sorgfältiger Abfassung der Patentansprüche jedenfalls ein Mitverschulden zur Last zu legen sei. Die Beklagten haben zudem in erster Instanz die Einrede der Verjährung erhoben.
26Mit Urteil vom 15.08.2023, ergänzt mit Ergänzungsurteil vom 17.10.2023, hat das Landgericht Düsseldorf eine Verletzung des Klagepatents bejaht und wie folgt erkannt:
27„I. Die Beklagten werden verurteilt,
281. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie
29a) die Beklagte zu 1):
30Elemente, insbesondere Elemente, die im Gebrauch aufeinandergestapelt werden/sind, um eine Anordnung von gestapelten Elementen für eine elektrische Maschine, insbesondere für den Generator einer Windkraftanlage zu bilden,
31- wobei jedes Element Grundkörper- und Polabschnitte aufweist, die integral ausgebildet sind,
32(unmittelbares Verfahrenserzeugnis des Anspruchs 6)
33in der Bundesrepublik Deutschland zwischen dem 02.05.2007 und dem 20.03.2021 angeboten oder in Verkehr gebracht, oder zu den genannten Zwecken besessen hat,
34welche, ausgehend von bandförmigem Material, durch ein Verfahren hergestellt wurden
35unter Verwendung einer Vorrichtung,
36- die eine Stanzanordnung aufweist, die versehen ist
37- mit einem ersten Stanzelement zum Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Polabschnitte eines jeden Elements,
38- und mit einem zweiten Stanzelement zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Grundkörperabschnitte eines jeden Elements (8),
39- wobei die Stanzelemente für Grundkörper und Pole relativ zueinander bewegbar sind, zwischen aufeinanderfolgenden Stanzvorgängen,
40- wenn die Grundkörper- und Polabschnitte der Elemente gebildet werden,
41- das erste Stanzelement relativ zu einer Maschinenbasis ortsfest gehalten wird, und
42- wobei das zweite Stanzelement schrittweise zwischen aufeinanderfolgenden Ausstanzvorgängen relativ zu dem ersten Stanzelement und der Maschinenbasis bewegt wird,
43(Vorrichtung gem. Anspruch 1)
44wobei das Verfahren
45- eine Relativbewegung der ersten und zweiten Stanzelemente zwischen aufeinanderfolgenden Stanzvorgängen umfasst,
46- wenn die Grundkörper- und Polabschnitte der Elemente gebildet werden,
47- wobei eine schrittweise Einstellung der Position des zweiten Stanzelements relativ zu dem ersten Stanzelement so ausgeführt wird, dass,
48- wenn jeder der Grundkörperabschnitte der Elemente entlang einer gemeinsamen Mittellinie angeordnet wird/ist,
49- der Polabschnitt eines jeden der aufeinanderfolgenden Elemente schrittweise relativ zu dem Polabschnitt eines jeden entsprechenden vorangehenden Elements in Bezug auf die genannte gemeinsame Mittellinie versetzt ist;
50(Verfahren gem. Anspruch 6)
51b) die Beklagte zu 2):
52(1) Elemente nach vorstehender Ziff. I.1.a)
53(unmittelbares Verfahrenserzeugnis des Anspruchs 6)
54in der Bundesrepublik Deutschland zwischen dem 02.05.2007 und dem 20.03.2021 hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht, oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken besessen hat;
55(2) Vorrichtungen zum Herstellen von Elementen
56- aus bandförmigem Material,
57- wobei die Elemente im Gebrauch aufeinandergestapelt werden/sind, um eine Anordnung von gestapelten Elementen für eine elektrische Maschine zu bilden,
58- wobei jedes Element Grundkörper- und Polabschnitte aufweist, die integral ausgebildet sind,
59- wobei die Maschine eine Stanzanordnung aufweist, die versehen ist
60- mit einem ersten Stanzelement zum Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Polabschnitte eines jeden Elements,
61- und mit einem zweiten Stanzelement zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Grundkörperabschnitte eines jeden Elements
62- wobei die Stanzelemente für Grundkörper und Pole relativ zueinander bewegbar sind, zwischen aufeinanderfolgenden Stanzvorgängen;
63- wenn die Grundkörper- und Polabschnitte der Elemente gebildet werden,
64- wobei eine schrittweise Einstellung der Position des zweiten Stanzelements relativ zu dem ersten Stanzelement so ausgeführt wird, dass,
65- wenn jeder der Grundkörperabschnitte der Elemente entlang einer gemeinsamen Mittellinie angeordnet wird,
66- der Polabschnitt eines jeden der aufeinanderfolgenden Elemente (8) schrittweise relativ zu dem Polabschnitt eines jeden entsprechenden vorangehenden Elements in Bezug auf die genannte gemeinsame Mittellinie des Grundkörperabschnitts versetzt ist, und
67- wobei das erste Stanzelement relativ zu einer Maschinenbasis ortsfest gehalten wird, und
68- wobei das zweite Stanzelement schrittweise zwischen aufeinanderfolgenden Ausstanzvorgängen relativ zu dem ersten Stanzelement und der Maschinenbasis bewegt wird;
69(Vorrichtung gem. Anspruch 1)
70in der Bundesrepublik Deutschland zwischen dem 02.05.2007 und dem 20.03.2021 hergestellt, gebraucht oder hierzu besessen hat,
71und zwar unter Angabe
72• der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
73• der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
74• der Menge der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,
75wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen,
76wobei hiervon solche Elemente, die die Beklagte zu 1) von der A. GmbH, Y.-Straße ..., Stadt 1 (A.) bezogen hat, ausgenommen sind,
77wobei sich die Auskunft auch auf solche Benutzungshandlungen erstreckt, deren Gegenstand die vorgenannten Verfahrenserzeugnisse als Teil einer größeren Maschine, insbesondere eines Generators oder einer Windkraftanlage waren;
782. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses vollständig in elektronischer Form darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie jeweils die zu Ziffer l.1. a) bzw. b) bezeichneten Handlungen zwischen dem 02.06.2007 und dem 20.03.2021 begangen haben, und zwar unter Angabe
79a) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen, aufgeschlüsselt nach Liefer- und Bestellmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer und der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,
80b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
81c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
82d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
83wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nichtgewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten tragen und ihn ermächtigen, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist,
84wobei hiervon solche Elemente, die die Beklagte zu 1) von der A. GmbH, Y.-Straße ..., Stadt 1 (A.) bezogen hat, ausgenommen sind,
85wobei sich die Rechnungslegung auch auf solche Benutzungshandlungen erstreckt, deren Gegenstand die vorgenannten Verfahrenserzeugnisse als Teil einer größeren Maschine, insbesondere eines Generators oder einer Windkraftanlage waren;
863. die vorstehend unter Ziff. I.1. a) bzw. I.1. b) (1) bezeichneten Erzeugnisse, die bis zum 20.03.2021 in Verkehr gebracht wurden, gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich (Urteil des Landgerichts Düsseldorf, Az. 4b O 59/22 vom 15. August 2023) festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und das Erzeugnis wieder an sich zu nehmen, soweit diese Erzeugnisse im Zeitpunkt des Beginns der Zwangsvollstreckung in Bezug auf diesen Rückrufanspruch nicht schon in Windkraftanlagen verbaut sind,
87wobei hiervon solche Elemente, die die Beklagte zu 1) von der A. GmbH, Y.-Straße ..., Stadt 1 (A.) bezogen hat, ausgenommen sind;
884. die vorstehend unter Ziff. I.1. a) bzw. I.1. b) (1) bezeichneten Erzeugnisse, die sich seit dem 20.03.2021 in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befinden oder die durch den Rückruf nach vorstehender Ziff. I.3. in ihren Besitz gelangt sind, auf ihre Kosten zu vernichten, oder an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten – Kosten herauszugeben, soweit diese Erzeugnisse im Zeitpunkt des Beginns der Zwangsvollstreckung in Bezug auf diesen Vernichtungsanspruch nicht schon in Windkraftanlagen verbaut sind,
89wobei hiervon solche Elemente, die die Beklagte zu 1) von der A. GmbH, Y.-Straße ..., Stadt 1 (A.) bezogen hat, ausgenommen sind;
905. (nur die Beklagte zu 2) die vorstehend unter Ziff. I.1. b) (2) bezeichneten Vorrichtungen, die sich seit dem 20.03.2021 in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befinden, auf ihre Kosten zu vernichten, oder an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten zu 2) – Kosten herauszugeben.
91II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der Klägerin durch die unter Ziffer l. 1. bezeichneten Handlungen (zwischen dem 02.06.2007 und dem 20.03.2021) entstanden ist und noch entstehen wird.“
92Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt:
93Mit dem – entsprechend den Ausführungen des Bundesgerichtshofs in seiner Entscheidung „Rotorelemente“ (GRUR 2015, 875 Rn. 18) zu berichtigenden – Merkmal des Verfahrensanspruchs 6 (für den Vorrichtungsanspruch 1 gelte Entsprechendes), wonach die Stanzanordnung der Maschine mit einem „zweiten Stanzelement zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Grundkörperabschnitte eines jeden Elements“ versehen sei, werde nicht festgelegt, dass das zweite Stanzelement den gesamten Grundkörperabschnitt bereitstellen müsse.
94Ein „Bereitstellen“ könne nicht mit einem „Fertigstellen“ gleichgesetzt werden und auch die Gegenüberstellung mit dem im Anspruch – bezogen auf das erste Stanzelement – genannten „Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Polabschnitte“ führe zu keinem engeren Verständnis. Bereitgestellt werde der Grundkörper bei dem gebotenen technisch-funktionalen Verständnis, wenn die spätere Mittellinie C/L definiert werde, was bereits dann der Fall sei, wenn die Seitenränder ausgestanzt würden. Entscheidend sei nicht das vollständige Bereitstellen des Grundkörperabschnitts mit dem zweiten Stanzelement, sondern vielmehr dessen Beweglichkeit im Gegensatz zu der Ortsfestigkeit des zumindest Teile der Polabschnitte bereitstellenden ersten Stanzelements. Durch deren Zusammenspiel werde der Grundkörperabschnitt jeweils mit einem inkrementellen Versatz zu dem vorherigen Grundkörperabschnitt gestanzt und damit auch die Mittellinie versetzt, wie aus Abs. [0039] hervorgehe. So entstehe bei einem Aufeinanderstapeln der Rotorelemente unter Beibehaltung der Mittellinie die gewünschte Winkelform. Inwiefern das zweite Stanzelement auch die Bodenlinie des Grundkörpers bereitstelle, sei für das spätere Erscheinungsbild in Form eines Winkels hingegen nicht entscheidend.
95Dass ein vollständiges Ausstanzen nicht gefordert sei, zeige auch ein Vergleich mit Unteranspruch 3. Der darin genannte Einsatz eines dritten Stanzelements, das den Umfangsrand zwischen dem Grundkörperabschnitt eines Elements und dem Polabschnitt eines durch einen vorangegangenen Ausstanzvorgang gebildeten Elements bereitstelle, sei nicht sinnvoll möglich, wenn das in Anspruch 1 genannte zweite Stanzelement den Grundkörperabschnitt bereits vollumfänglich ausgestanzt hätte. Auch der Beschreibung der Ausführungsbeispiele entnehme der Fachmann, dass ein drittes Stanzelement optional sei, welches nach Unteranspruch 6 zwar mit dem zweiten Stanzelement integral ausgebildet sein könne, aber nicht müsse, und das sowohl die gekrümmte äußere Oberfläche des Polabschnitts als auch die gekrümmte innere Oberfläche des vorangehenden Grundkörperabschnitts ausstanze.
96Wenn Abs. [0037] im Ergebnis ein „vollständiges Rotorelement“ vorsehe, sei dies für den Fachmann eine Selbstverständlichkeit und lasse nicht den Rückschluss zu, dass dieses bereits mit Durchlaufen der in Anspruch 6 i.V.m. Anspruch 1 zum Ausdruck gekommenen Lehre vorliegen müsse. Die Ansprüche schlössen das Durchlaufen weiterer Schritte zum Erhalt eines vollständigen Rotorelements nicht aus, wie der bereits erwähnte Blick in die Unteransprüche bestätige.
97Soweit es in Abs. [0009] heiße, dass durch unterschiedliche Krümmungsmittelpunkte eine Veränderung in dem Luftspalt zwischen äußerer Oberfläche des Polabschnitts und der inneren Oberfläche des Stators bewirkt werde, handele es sich dabei nicht um ein technisches Problem, dessen Lösung sich das Klagepatent mit Anspruch 1 zur Aufgabe gemacht habe. Eine zwingende Vorgabe, immer einen gleichbleibenden Luftstrom zu gewährleisten, sei schon deshalb nicht gegeben, weil es für die Gewährleistung eines gleichbleibenden Luftspalts auf die Mittellinie C/L als Krümmungsmittelpunkt ankomme, zu der sich die Ansprüche 1 und 6 nicht verhielten. Abgesehen davon werde die Lösung des genannten technischen Problems durch ein Verständnis, wonach die Grundkörperabschnitte mit dem zweiten Stanzelement nur teilweise ausgestanzt würden, nicht ausgeschlossen.
98Eine Abweichung von der vorgenommenen Auslegung ergebe sich auch nicht aus der Entscheidung „Rotorelemente“ des Bundesgerichtshofs und insbesondere dessen Feststellung, wonach die Möglichkeit, den (gleichförmigen) Grundkörper mit dem ersten Stanzwerkzeug nur teilweise auszustanzen, den Polabschnitt und den Rest des Grundkörperabschnitts aber mit weiteren Stanzwerkzeugen, keinerlei Anklang in der Beschreibung finde. Es sei zu berücksichtigen, dass der Bundesgerichtshof zwar von einem „teilweisen Ausstanzen“ spreche, im Klagepatent aber von einem „Bereitstellen“ die Rede sei, welches technisch-funktional dahingehend zu verstehen sei, dass die spätere Mittellinie C/L definiert werde, was bereits dann der Fall sei, wenn die Seitenränder ausgestanzt würden. Ein „teilweises Bereitstellen“ wäre vor diesem Hintergrund denkbar, wenn nur einer der beiden Seitenränder ausgestanzt werde, was in der Tat vom Anspruchswortlaut nicht gedeckt wäre und auch keinen Anklang in der Beschreibung finde. Die weiteren Ausführungen, wonach sich – noch bezogen auf ein wörtliches Verständnis des vertauschten Anspruchswortlaut – bei einem nur teilweisen Ausstanzen des Grundkörperabschnitts mit dem im Ausführungsbeispiel gezeigten einteiligen beweglichen Werkzeug, bei dem zweites und drittes Stanzelement integral ausgestaltet seien, die im Wesentlichen auf der Mittellinie C/L des Grundkörperabschnitts liegenden Krümmungsradien der Polabschnitte und erst recht die gekrümmten inneren Oberflächen des Grundkörperabschnitts nicht erzeugen ließen, sprächen nicht gegen die vorgenommene Auslegung. Zum einen stelle der Bundesgerichtshof ausdrücklich auf die integrale Ausbildung der zweiten und dritten Stanze ab, die aber erst in einem Unteranspruch vorgesehen sei; zum anderen müsse, wie ausgeführt, der Vorteil, den Scheitelpunkt der Krümmungen des Polabschnitts immer auf der gemeinsamen Mittellinie der Grundkörper zu halten, gar nicht zwingend von Anspruch 1 bzw. Anspruch 6 verwirklicht werden. Sollte man den genannten Vorteil hingegen als erfindungswesentlich ansehen, ließe sich auch das bewerkstelligen, indem entweder das dritte Stanzelement – ggf. integral mit dem zweiten – für die Grundlinie ebenfalls inkrementell weiterbewegt werde oder indem stattdessen die Relativbewegung des Stanzelements für den Grundkörperabschnitt nicht linear, sondern als Drehung durchgeführt werde, so dass die Mittellinie der Abschnitte immer auf den Radien der Grundlinie liege.
99Patentanspruch 6 gebe keine bestimmte Bearbeitungsreihenfolge in dem Sinne vor, dass das bandförmige Material immer zuerst von dem „ersten“ und erst danach von dem „zweiten“ Stanzelement bearbeitet werden müsste.
100Zwar stelle die semantische Reihenfolge der Verfahrensschritte im Text bei Verfah-rensansprüchen grundsätzlich zugleich ein Indiz für die funktionelle Reihenfolge bei der Durchführung der einzelnen Verfahrensschritte dar. Im Fall des Anspruchs 6 bestehe diese Indizwirkung jedoch nicht, weil das in Anspruch 6 unter Schutz gestellte Verfahren nicht über die Verwendung der in Anspruch 1 genannten Vorrichtung hinausgehe, für die eine solche Indizwirkung gerade nicht bestehe. Auch aus der Nummerierung der Stanzelemente, die sich schon zur Erleichterung einer späteren Bezugnahme im Anspruch anbiete, lasse sich kein Rückschluss auf die Bearbeitungsreihenfolge ziehen. Soweit im Anspruch von einer Stanz-„anordnung“ die Rede sei, sei damit keine zwingende Reihenfolge gemeint, sondern lediglich die in den weiteren Merkmalen näher beschriebene Ausgestaltung angesprochen. Dass in der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels die Anordnung der Stanzelemente der im Anspruch enthaltenen Nummerierung entspreche, beschränke die erfindungsgemäße Lehre nicht. Entgegen der Auffassung der Beklagten sei es auch nicht zwingend, dass bei einem Vertauschen der Stanzelemente das zu stanzende Element schon im ersten Stanzschritt aus dem Blech herausgestanzt werde, so dass es nicht weiter zur zweiten Stanzstation transportiert werden könne. Selbst wenn aber der Grundkörperabschnitt mit seinen beiden Seiten und der Grundlinie in einem Schritt gestanzt werde, folge daraus noch nicht, dass das Polelement im Zuge dieses Stanzvorgangs auch vom übrigen Band getrennt werde und sei ein Weitertransport unproblematisch möglich. Auch aus Unteranspruch 8, der auf das inkrementelle Versetzen einer optionalen dritten Stanzanordnung in Relation zur zweiten Stanzanordnung abstelle, lasse sich eine bestimmte Reihenfolge nicht ableiten. Im Gegenteil folge daraus gerade, dass der Hauptanspruch weiter gefasst sei und ein gemeinsames Bewegen von zweitem und drittem Stanzelement nicht zwingend fordere.
101Schließlich lasse sich aus der Entscheidung „Rotorelemente“ des Bundesgerichtshofs keine bestimmte Bearbeitungsreihenfolge ableiten. Dessen Feststellung, dass nichts unter Schutz gestellt werden solle, was von der in der Beschreibung offenbarten Vorrichtung abweiche, beziehe sich allein auf die Begriffe „Polabschnitte“ und „Grundkörperabschnitte“ und lasse sich nicht hinsichtlich des Patentanspruchs insgesamt verallgemeinern. Das Urteil des Bundesgerichtshofs lasse auch nicht erkennen, dass dieser sich mit der Auslegung dieses Teilmerkmals überhaupt beschäftigt habe. Soweit dort eine bestimmte Bearbeitungsreihenfolge geschildert werde, bezögen sich diese Ausführungen ausdrücklich auf die Darstellung eines Ausführungsbeispiels.
102Diese Auslegung zugrunde gelegt, verwirkliche das angegriffene Verfahren alle Merkmale des Klagepatentanspruchs 6 und die in diesem Zusammenhang verwendete Stanzanordnung zugleich alle Merkmale des Klagepatentanspruchs 1. Letztere verfüge über ein erstes, ortsfestes Stanzelement, welches den äußeren Umfang der Polabschnitte und damit Teile derselben bereitstelle. Dass es in Vorschubrichtung erst nach dem beweglich ausgestalteten zweiten Stanzelement angeordnet sei, welches die beiden parallelen Längsseiten des Grundkörperabschnitts stanze und damit im Sinne der dargestellten Auslegung die Grundkörperabschnitte bereitstelle, sei unbeachtlich. Entscheidend sei, dass bereits nach dem Stanzen durch das zweite Stanzelement die endgültige Form des Rotorelements und die allen Grundkörperabschnitten gemeinsame Mittellinie feststehe.
103Aufgrund der Patentverletzung stünden der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche im tenorierten Umfang zu. Es sei insbesondere das Verschulden der Beklagten nicht aufgrund eines entschuldbaren Rechtsirrtums ausgeschlossen. Die Beklagten hätten nicht auf einen uneingeschränkten Vorrang des Wortlauts vertrauen dürfen, sondern hätten damit rechnen müssen, dass die Begriffe „Polabschnitte“ und „Grundkörperabschnitte“ bei einer Auslegung unter Ermittlung des Wortsinns – im Gegensatz zum Wortlaut – gegeneinander auszutauschen seien.
104Es komme auch keine Kürzung des Schadensersatzanspruchs der Klägerin wegen eigenen Mitverschuldens gemäß § 254 BGB in Betracht. Durch das Einreichen einer dem Wortlaut nach missverständlichen Anspruchsfassung habe die Klägerin schon nicht, wie es aber erforderlich wäre, unmittelbar auf die Beklagten eingewirkt. Zudem ergebe sich aus dem Vortrag der Beklagten nicht, dass sie das Klagepatent bei Aufnahme der patentverletzenden Handlungen tatsächlich gekannt und geprüft hätten, weshalb es auch an der Darlegung der erforderlichen Kausalität fehle. Das vorgelegte Privatgutachten könne sie ebenfalls nicht entlasten, da sie dieses jedenfalls erst nach Aufnahme der patentverletzenden Handlungen eingeholt hätten.
105Die von den Beklagten erhobene Einrede der Verjährung greife nicht durch, weil sich eine vor dem August 2021 bestehende positive Kenntnis der Klägerin von der Patentverletzung nicht feststellen lasse.
106Gegen dieses Urteil haben die Beklagten Berufung eingelegt, mit der sie ihr vor dem Landgericht erfolglos gebliebenes Begehren auf Klageabweisung weiterverfolgen. Zur Begründung ihrer Berufung führen sie unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens insbesondere aus:
107Das Landgericht lege das Klagepatent unzutreffend und unter Verkennung geltender Auslegungsgrundsätze aus.
108Wenn in Bezug auf das erste Stanzelement von einem Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Polabschnitte die Rede sei, sei der Begriff „zumindest“ nicht dahin zu verstehen, dass das erste Stanzelement die Polabschnitte auch insgesamt bereitstellen könne. Es sei vielmehr wegen der beanspruchten Lehre zwingend angestrebten Winkelform ausgeschlossen, dass das erste Stanzelement die Polabschnitte der Rotorelemente vollständig ausstanze.
109Das Landgericht ignoriere bei seiner Auslegung, dass der Anspruchswortlaut mit seiner sprachlichen Differenzierung eine technisch zwingende Unterscheidung hinsichtlich des Umfangs des Ausstanzens durch das erste („zum Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Polabschnitte“) und das zweite („zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Grundkörperabschnitte“) Stanzelement treffe. Diese sprachliche Differenzierung dürfe nicht gegenstandslos werden. In der sprachlichen Unterscheidung komme zudem der abweichende technische Beitrag des zweiten gegenüber dem ersten Stanzelement zum Ausdruck, nämlich das nicht nur teilweise, sondern vollständige Ausstanzen des Grundkörperabschnitts und damit zugleich das Herstellen durch Lösen des fertigen Rotorelements aus der Bandform.
110Leistungsergebnis des beanspruchten Verfahrens (Anspruch 6) bzw. der beanspruchten Vorrichtung (Anspruch 1) sei ein aus einem Stahlblechband vollständig gelöstes, selbstständiges Element mit integral ausgestaltetem Pol- und Grundkörperabschnitt. Nur ein solches Element sei nach dem Verständnis der Fachperson geeignet, in gestapelter Form ein Rotorelement für einen elektrischen Motor zu bilden. Daher müssten die Grundkörperabschnitte durch das zweite Stanzelement zwingend vollständig ausgestanzt werden und müssten zudem – ebenfalls zwingend – auch die übrigen Teile der Polabschnitte durch das zweite Stanzelement in einem nachfolgenden Stanzvorgang weggenommen werden.
111Bei einem nur teilweisen Ausstanzen der Grundkörperabschnitte ließe sich überdies die Verwendungseignung der Elemente als Rotorelemente in einer elektrischen Maschine nicht erreichen. Denn das vollständige Ausstanzen der Grundkörperabschnitte bei gleichzeitigem Stanzen der variablen Polabschnitte bedinge, dass die Krümmungsradien der Polabschnitte im Wesentlichen auf der gemeinsamen Mittellinie C/L der Grundkörperabschnitte lägen, so dass trotz der angestrebten Winkelform ein gleichmäßiger Abstand der Polköpfe zur Statorwand erzeugt und somit ein gleichmäßiger Luftspalt zwischen den Polköpfen und dem Stator realisiert werden könne. Seien die Polköpfe unterschiedlich und würden diese so zu unterschiedlich großen Luftspalten zwischen Rotorelement und Stator führen, wären die Elemente – wie die Beklagten erstmals in der Berufungsinstanz geltend machen – aus der Sicht einer Fachperson nicht geeignet, als Rotorelement für einen elektrischen Motor zu dienen.
112Ein abweichendes Verständnis folge auch nicht zwingend aus einer Gegenüberstellung von Anspruch 1 mit den Unteransprüchen des Klagepatents. Rückschlüsse auf das zutreffende Verständnis des Hauptanspruchs ließen sich aus einer nur additiven Ergänzung – wie sie Unteranspruch 3 in Bezug auf den Hauptanspruch vornehme – in der Regel nicht ohne Weiteres ziehen. Zudem bleibe auch bei einem Verständnis, wonach das zweite Stanzelement den Grundkörperabschnitt vollständig ausstanze, ein sinnvoller Anwendungsbereich für den Unteranspruch 3, etwa dann, wenn das dritte Stanzelement separat ausgebildet sei. Darüber hinaus definiere Abs. [0014] die Wirkung des dritten Stanzelements dahin, dass dieses sich stets und ausschließlich auf das Ausstanzen des (gekrümmten) Umfangsrandes beziehe, nicht dagegen auf das Ausstanzen der Unterkante bzw. Fußlinie des Grundkörperabschnitts. Ferner sei zu beachten, dass sich Unteranspruch 3 auf die in Figur 4a gezeigte und in Abs. [0027] ff. beschriebene Stanzreihenfolge beziehe und daher – wenn überhaupt – nur dann zur Auslegung der Ansprüche 1 und 6 herangezogen werden könne, wenn auch für diesen die in der Beschreibung gezeigte Stanzreihenfolge zwingend gelte.
113Schließlich stehe die Auslegung des Landgerichts im Widerspruch zu der Entscheidung „Rotorelemente“ des Bundesgerichtshofs und lasse den von diesem vorgenommenen Austausch der Begriffe „Polabschnitte“ und „Grundkörperabschnitte“ gegenstandslos werden, obgleich bei einem solchen Verständnis die Ansprüche unzulässig erweitert seien. Der Grundsatz, wonach der Patentanspruch grundsätzlich ohne Rücksicht darauf auszulegen sei, ob sich der so ermittelte Gegenstand als patentfähig erweise, müsse in einem Fall wie dem vorliegenden eine Einschränkung erfahren, in dem die Rechtsbestandsentscheidung klar erkennen lasse, welcher Gegenstand vom Anspruch erfasst sei und welcher – mangels Offenbarung – nicht unter den Anspruch falle. Auch das Gebot der Rechtssicherheit gebiete es, die Feststellungen des Bundesgerichtshofs zu den „korrigierten“ Merkmalen als verbindlich anzusehen und nicht ganz oder teilweise wieder „zurückzudrehen“. Dies gelte auch deshalb, weil der Bundesgerichtshof mit seiner Auslegung entgegen Art. 69 Abs. 1 EPÜ, § 14 S. 1 PatG den Anspruchswortlaut bewusst verlassen habe, der dem Verkehr sonst als Ausgangspunkt und Grundlage der Anspruchsauslegung diene, weshalb als Anknüpfungspunkt für die Bestimmung des Schutzbereichs des Klagepatents nunmehr allein das den Merkmalen in der Entscheidung „Rotorelemente“ beigemessene Verständnis dienen könne. Der Grundsatz, wonach bei einer Änderung der Ansprüche im Nichtigkeitsverfahren die die Abweichungen von der ursprünglichen Anspruchsfassung behandelnden Entscheidungsgründe an die Stelle der bzw. neben die ursprüngliche Beschreibung treten, müsse in Bezug auf den vom Bundesgerichtshof vorgenommenen Austausch Anwendung finden. Schließlich hätte sich das Landgericht auch die Frage stellen müssen, warum der Bundesgerichtshof nicht – als „milderes Mittel“ – die Begriffe „erstes“ und „zweites“ (Stanzelement) vertauscht habe. Es wäre dann zu dem Ergebnis gelangt, dass der Bundesgerichtshof sich an diesem geringfügigen Austausch gehindert gesehen habe, weil dann das Polabschnitts-Stanzelement die Polabschnitte vollständig, also einschließlich ihrer Unterkantenabschnitte, ausstanzen müsste.
114In Bezug auf den Verfahrensanspruch 6 sei mit dem Durchlaufen des bandförmigen Materials durch das erste und zweite Stanzelement eine Reihenfolge der Verfahrensschritte festgelegt. Die semantische Reihenfolge der Verfahrensschritte stelle nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein Indiz für die funktionelle Reihenfolge dar, zudem sei die auch bereits durch die Nummerierung der Stanzelemente vorgegebene Reihenfolge in der Beschreibung und den Ausführungsbeispielen ausschließlich so gezeigt. Überdies bleibe die Bandform im Verfahrensablauf nur dann erhalten, wenn zunächst das erste Stanzelement die Polabschnitte lediglich teilweise und sodann zweite Stanzelement den Grundkörperabschnitt und die allen Elementen gemeinsamen Bereiche des Polabschnitts ausstanze. Das Argument des Landgerichts, der Gegenstand des Verfahrensanspruchs 6 gehe nicht über die Verwendung der mit Anspruch 1 beanspruchten Vorrichtung hinaus, übersehe, dass dem Vorrichtungs- und dem Verfahrensanspruch eine jeweils andere Erfindung zugrunde liege.
115Bei zutreffendem Verständnis liege somit eine Patentverletzung nicht vor. Tatsächlich sei es bei der angegriffenen Ausführungsform nur durch eine zusätzliche Drehung (der teilgestanzten Grundkörperabschnitte zusätzlich zur Relativverschiebung gegenüber dem Polstanzelement) technisch möglich, Rotorelemente herzustellen, bei denen die Mittellinie von Grundkörper und die Radien der Oberkanten der Polabschnitte fluchten, obwohl zunächst die Grundkörperabschnitte teilweise und die Polabschnitte nachfolgend vollständig ausgestanzt würden.
116Jedenfalls fehle es am Verschulden, weil sie sich in einem entschuldbaren Rechtsirrtum befunden hätten. Bis zur Entscheidung „Rotorelemente“ hätten sie sich darauf verlassen dürfen, dass sie kein rechtsbeständiges Patent verletzen, denn mit der erteilten Anspruchsfassung habe dem Klagepatent die unzulässige Erweiterung förmlich auf die Stirn geschrieben gestanden. Auch nach der Entscheidung „Rotorelemente“ sei ihnen kein Schuldvorwurf zu machen, weil sie mit der Auslegung des Landgerichts nicht hätten rechnen müssen.
117Erstmals in der Berufungsinstanz machen die Beklagten außerdem geltend: Die Ansprüche auf Rückruf und Vernichtung seien unverhältnismäßig. Insbesondere die Verurteilung zur Vernichtung der Stanzanordnung stelle sich als grob unverhältnismäßig dar. Bei der gemäß § 140a Abs. 4 S. 1 PatG vorzunehmenden Abwägung sei zu berücksichtigen, dass das Klagepatent bereits am 20.03.2021 abgelaufen sei, die Anlage also seitdem patentfrei genutzt werden dürfe und seitdem Elemente mit ihr produziert würden, die keinem Patentschutz unterfielen. Zudem sei der Bau der betreffenden Stanzanlage mit Anschaffungskosten in Höhe von knapp 3,9 Mio. EUR verbunden gewesen, wobei der Wiederbeschaffungsaufwand bei ca. 5,089 Mio. EUR liegen würde. Allein die Stanzwerkzeuge hätten einen Anschaffungswert zwischen 50.000 und 150.000 EUR je Stück, wobei eine Wiederbeschaffung der Stanzelemente heute je Einheit knapp 197.000 EUR kosten würde. Schließlich sei in die Abwägung einzustellen, dass ihnen aufgrund der außergewöhnlichen Fallumstände kein Schuldvorwurf zu machen sei. Hingegen sei kein berechtigtes Interesse der Klägerin, insbesondere nicht an der Vernichtung der Stanzanordnung erkennbar. Schließlich beschränke sich deren geschäftliche Tätigkeit auf das Halten und Durchsetzen des Klagepatents und verfüge diese nicht über eine eigene Marktposition, die durch die Vollstreckung von Rückruf und Vernichtung zu schützen wäre.
118Auch der Rückruf erscheine angesichts des lange zurückliegenden Ablaufs des Klagepatents unverhältnismäßig. Er berge insbesondere die erhebliche Gefahr, dass ihre Kunden ihn als auf einem bestandskräftigen Patent beruhend missverstünden und zu der irrigen Einschätzung gelangten, die Rotorelemente seien, zumindest durch sie, nicht mehr lieferbar.
119Jedenfalls sei der Rechtsstreit – wie die Beklagten erstmals mit der Berufungsreplik geltend machen – mit Blick auf die von der Beklagten zu 2) erhobene Nichtigkeitsklage vom 25.03.2024 auszusetzen, die sich im Wesentlichen darauf stütze, dass der Gegenstand der Ansprüche 1 und 6 des Klagepatents unzulässig erweitert sei, wenn er so bestimmt werde, wie es das Landgericht getan habe. Da mit einer solchen Auslegung des Landgerichts nicht zu rechnen gewesen sei, sei der Beklagten zu 2) die neue Nichtigkeitsklage erst zum jetzigen Zeitpunkt möglich gewesen.
120Die Beklagten beantragen,
121das am 15.08.2023 verkündete Urteil des Landgerichts Düsseldorf, Aktenzeichen 4b O 59/22, abzuändern und die Klage abzuweisen;
122hilfsweise,
123den Rechtsstreit auszusetzen, bis rechtskräftig über die gegen das Klagepatent anhängige Nichtigkeitsklage vom 25.03.2024 entschieden ist.
124Die Klägerin beantragt,
125die Berufung mit den Maßgaben zurückzuweisen,
126 dass im Tenor zu I. 1. a) des landgerichtlichen Urteils nach dem ersten Wort „Elemente“ der Zusatz „insbesondere Elemente“ gestrichen wird;
127 dass im Tenor zu I. 1. b) (1) nach den Worten „zwischen dem 02.05.2007 und dem 20.03.2021“ das Wort „hergestellt“ gestrichen wird;
128hilfsweise,
129im Fall einer Aussetzung des Verfahrens nach § 148 ZPO
130das am 17.10.2023 verkündete Urteil der 4b-Kammer des Landgerichts Düsseldorf gemäß § 718 Abs. 1 ZPO im Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit dahingehend abzuändern, dass die von ihr, der Klägerin, zu erbringende Sicherheitsleistung für den Tenor zu Ziff. I.1. und I.2. des am 15.08.2023 verkündeten Urteils der 4b-Kammer gegenüber beiden Beklagten insgesamt 50.000,- EUR beträgt.
131Sie verteidigt das angefochtene Urteil und tritt den Ausführungen der Beklagten unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vorbringens wie folgt entgegen:
132Die Auffassung der Beklagten, wonach das bewegliche („erste“) Stanzelement ausschließlich Teile des Polabschnitts ausstanzen dürfe, widerspreche anerkannten Auslegungsgrundsätzen. „Zumindest“ bedeute nicht „nur“ – im Gegenteil.
133Soweit es die Frage angehe, ob das zweite Stanzelement die Grundkörperabschnitte vollständig ausstanzen müsse, spreche hierfür einzig und allein die Anspruchssystematik. Diese allein könne eine derart beschränkende Auslegung der im Übrigen klaren Lehre des Klagepatents jedoch nicht rechtfertigen. Danach könne optional ein drittes Stanzelement hinzutreten, welches sowohl die gekrümmte äußere Oberfläche des Polabschnitts als auch die gekrümmte innere Oberfläche des Grundkörperabschnitts ausstanze und optional einstückig mit dem beweglichen („zweiten“) Stanzelement ausgebildet sein könne. Zu dieser Beschreibung und dem einzigen Ausführungsbeispiel setze sich das enge Verständnis in Widerspruch.
134Die Behauptung der Beklagten, ohne die Gewährleistung eines gleichmäßigen Luftspalts sei ein Rotorelement nicht für den Einsatz in einer elektrischen Maschine geeignet, werfe schon im Hinblick auf die Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform Fragen auf. Jedenfalls aber beantworte sich die Frage der objektiven Eignung ausschließlich auf der Ebene des Klagepatents und nicht etwa danach, was die Beklagten im Jahr 2023 als „Industriestandard“ o.ä. betrachten mögen. Das Klagepatent selbst lehre die Wirkung eines gleichmäßigen Luftspalts ausdrücklich als optional.
135Entgegen der Darstellung der Beklagten habe der Bundesgerichtshof nicht ausgeführt, dass ein Bereitstellen des Grundkörperabschnitts durch teilweises Ausstanzen nicht anspruchsgemäß sei. Die von den Beklagten zitierte Rn. 23 der Entscheidung „Rotorelemente“ beinhalte nicht mehr als die Aussage, dass ein nur teilweises Ausstanzen des Grundkörperabschnitts bei gleichzeitig vollständigem Ausstanzen des Polabschnitts nicht beschrieben sei. Die fehlende Beschreibung einer Ausführungsform führe aber nicht aus dem Schutzbereich heraus.
136Die von den Beklagten konstruierte vermeintliche Bindungswirkung der Entscheidungsgründe bestehe ebenfalls nicht. Der Bundesgerichtshof habe weder den Schutzbereich des Klagepatents auf das Ausführungsbeispiel beschränkt noch sei er zu dem Ergebnis gekommen, dass eine „vertauschte Nummerierung“ nicht ursprungsoffenbart sei. Entscheidend sei vielmehr die Erkenntnis gewesen, dass die Polelemente durch ein feststehendes und die Grundkörperabschnitte durch ein bewegliches Stanzelement bereitgestellt würden.
137Zu Recht habe sich das Landgericht auch der – in der Berufungsinstanz nur noch in Bezug auf den Verfahrensanspruch vertretenen – Auffassung der Beklagten, aus der Bezeichnung des ortsfesten und des beweglichen Stanzelements als „erstes“ und „zweites“ Stanzelement folge eine bestimmte Stanzreihenfolge, nicht angeschlossen. Anspruch 6 gebe nicht einmal eine semantische Reihenfolge von Verfahrensschritten vor, sondern konkretisiere allein die Stanzanordnung der Maschine.
138Von einem unvermeidbaren Rechtsirrtum der Beklagten könne keine Rede sei, zumal sie zum Zeitpunkt der „Rotorelemente“ bereits ihre, der Klägerin, Auslegung sowie diejenige des Landgerichts und Oberlandesgerichts Düsseldorf (jeweils aus dem seinerzeitigen Besichtigungsverfahren) gekannt hätten. Sie hätten also gewusst, dass mehrere Instanzen eine von ihnen abweichendes Verständnis hätten, was einen unvermeidbaren Irrtum jedenfalls ausschließe.
139Der erstmals in der Berufungsinstanz erhobene Einwand der Unverhältnismäßigkeit sowie der diesbezügliche Vortrag – zu dem sie, die Klägerin, sich mit Nichtwissen erkläre – sei präkludiert. Ebenfalls präkludiert seien der Aussetzungsantrag und der zu seiner Begründung vorgebrachte Vortrag.
140Korrekturbedürftig sei allerdings die Kostenentscheidung des Landgerichts, soweit sie, die Klägerin, hierdurch belastet werde. Das Landgericht habe übersehen, dass der zurückgenommene Antrag – betreffend den Auskunftsanspruch gegenüber der Beklagten zu 2) hinsichtlich der Anwendung des patentgemäßen Verfahrens – mit den tenorierten Ansprüchen deckungsgleich sei.
141Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der wechselseitigen Schriftsätze der Parteien und der von ihnen vorgelegten Anlagen sowie auf den Tatbestand und die Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen.
Die jeweils eingelegten Rechtsmittel sind zulässig, bleiben in der Sache aber ohne Erfolg.
Die zulässige Berufung der Beklagten ist unbegründet. Zu Recht hat das Landgericht in den die angegriffene Ausführungsform (Stanzmaschine) sowie die angegriffenen Erzeugnisse (Rotorelemente) betreffenden Benutzungshandlungen in der Bundesrepublik Deutschland eine wortsinngemäße Benutzung des Klagepatents gesehen und die Beklagten wegen unmittelbarer Patentverletzung zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung, zur Vernichtung, zum Rückruf sowie zum Schadensersatz verurteilt.
1441.
145Das Klagepatent betrifft eine Vorrichtung zum Herstellen von bandförmigen Material, wobei die Elemente im Gebrauch aufeinander gestapelt werden, um eine Anordnung von gestapelten Elementen für eine elektrische Maschine zu bilden.
146Zur Veranschaulichung wird nachfolgend Figur 1 des Klagepatents eingeblendet, die eine herkömmliche Rotoranordnung mit einer Welle 6 und einer Anzahl von Rotorelementen 8 zeigt, die mit der Welle zur Drehung mit dieser um die Achse A-A der Welle verbunden sind, wobei jedes Rotorelement einen Grundkörperabschnitt 10 und einen Polabschnitt 12 aufweist:
147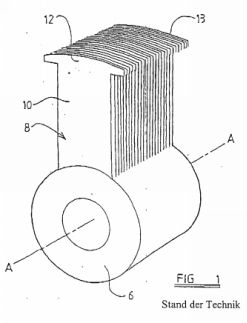
Eine elektrische Maschine mit ausgeprägten Polen ist unter dem Fachbegriff Schenkelpolmaschine bekannt. Für Käfig- und Drehstromentwicklungen ist es üblich, zur Geräusch- und Oberwellendämpfung die Nuten zu schrägen. Die Einzelbleche werden gegeneinander versetzt, so dass Nuten und Leiter wendelförmig verlaufen, ggf. auch abschnittsweise mit unterschiedlicher Schrägungsrichtung, so dass sich eine als Winkel- oder Pfeilform bezeichnete Form ergibt (BGH-Urteile „Rotorelemente“ Rn. 7, „Stanzanordnung in Schenkelpolmaschine“ Rn. 8). Auch nach dem Klagepatent sollen die Polabschnitte winkelförmig geschrägt werden, die Grundkörper hingegen unverändert bleiben, wie in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 2 des Klagepatents gezeigt (BGH-Urteile „Rotorelemente“ Rn. 7; „Stanzanordnung in Schenkelpolmaschine“ Rn. 8):
149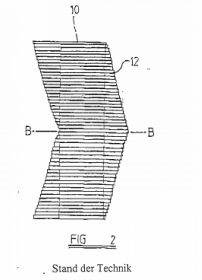
Dazu müssen im Stand der Technik entweder beide Teile einzeln gefertigt und beispielsweise durch Schweißen verbunden werden oder es ist für jedes Blech eine gesonderte Form zu stanzen, was eine große Zahl verschiedener Stanzwerkzeuge erfordert (BGH-Urteile „Rotorelemente“ Rn. 8, „Stanzanordnung in Schenkelpolmaschine“ Rn. 9).
151Davon ausgehend liegt dem Klagepatent die Aufgabe zugrunde, einen Rotor mit dem gewünschten Winkelprofil einfacher herzustellen (BGH-Urteile „Rotorelemente“ Rn. 8, „Stanzanordnung in Schenkelpolmaschine“ Rn. 9; Urteil BPatG II Rn. 19).
152Zur Lösung dieser Problemstellung schlägt Patentanspruch 1 in der im Nichtigkeitsverfahren aufrechterhaltenen Fassung eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor, wobei die gegenüber der eingetragenen Fassung hinzugekommenen Merkmale durch Kursivschrift und der sogleich näher zu erörternde Austausch der Begriffe „Polabschnitte“ und „Grundkörperabschnitte“ durch Unterstreichung gekennzeichnet sind:
1531.1 Vorrichtung zum Herstellen von Elementen (8)
1541.2 aus bandförmigem Material,
1551.3 wobei die Elemente (8) im Gebrauch aufeinandergestapelt werden, um eine Anordnung von gestapelten Elementen (8) für eine elektrische Maschine zu bilden,
1561.4 wobei jedes Element (8) Grundkörper- (10) und Polabschnitte (12) aufweist, die integral ausgebildet sind,
1572. wobei die Maschine eine Stanzanordnung aufweist, die versehen ist
1582.1 mit einem ersten Stanzelement (22) zum Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Polabschnitte (12) eines jeden Elements,
1592.2 und mit einem zweiten Stanzelement (32) zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Grundkörperabschnitte (10) eines jeden Elements (8),
1603.1 wobei die Stanzelemente (22, 32) für Grundkörper und Pole relativ zueinander bewegbar sind, zwischen aufeinanderfolgenden Stanzvorgängen,
1613.2 wenn die Grundkörper- und Polabschnitte (10, 12) der Elemente gebildet werden,
1624. wobei eine schrittweise Einstellung der Position des zweiten Stanzelements (32) relativ zu dem ersten Stanzelement (22) so ausgeführt wird, dass,
1634.1 während jeder der Grundkörperabschnitte (10) der Elemente entlang einer gemeinsamen Mittellinie gebildet wird,
1644.2 der Polabschnitt (12) eines jeden der aufeinanderfolgenden Elemente (8) schrittweise relativ zu dem Polabschnitt (12) eines jeden entsprechenden vorangehenden Elements (8) in Bezug auf die genannte gemeinsame Mittellinie des Grundkörperabschnitts (10) versetzt ist,
1655.1 wobei das erste Stanzelement (22) relativ zu einer Maschinenbasis (20) ortsfest gehalten wird, und
1665.2 wobei das zweite Stanzelement (32) schrittweise zwischen aufeinanderfolgenden Ausstanzvorgängen relativ zu dem ersten Stanzelement (22) und der Maschinenbasis (20) bewegt wird.
167Patentanspruch 6 schlägt in der von der Klägerin geltend gemachten Kombination mit Anspruch 1 ein Verfahren mit folgenden Merkmalen vor:
168Verfahren zum Herstellen von Elementen (8)
1691.1 unter Verwendung einer Vorrichtung nach Anspruch 1
1701.2 ausgehend von bandförmigem Material,
1711.3 wobei die Elemente (8) im Gebrauch aufeinandergestapelt werden, um eine Anordnung von gestapelten Elementen (8) für eine elektrische Maschine zu bilden,
1721.4 wobei jedes Element (8) Grundkörper- (10) und Polabschnitte (12) aufweist, die integral ausgebildet sind,
1732. wobei die Maschine eine Stanzanordnung aufweist, die versehen ist
1742.1 mit einem ersten Stanzelement (22) zum Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Polabschnitte (12) eines jeden Elements,
1752.2 und mit einem zweiten Stanzelement (32) zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Grundkörperabschnitte (10) eines jeden Elements (8),
1763.1 wobei das Verfahren umfasst, die ersten und zweiten Stanzelemente (22, 32) relativ zueinander zu bewegen, zwischen aufeinanderfolgenden Stanzvorgängen,
1773.2 wenn die Grundkörper- und Polabschnitte (10, 12) der Elemente gebildet werden,
1784. wobei eine schrittweise Einstellung der Position des zweiten Stanzelements (32) relativ zu dem ersten Stanzelement (22) so ausgeführt wird, dass,
1794.1 während jeder der Grundkörperabschnitte (10) der Elemente (8) entlang einer gemeinsamen Mittellinie gebildet wird,
1804.2 der Polabschnitt (12) eines jeden der aufeinanderfolgenden Elemente (8) schrittweise relativ zu dem Polabschnitt (12) eines jeden entsprechenden vorangehenden Elements (8) in Bezug auf die genannte gemeinsame Mittellinie versetzt ist.
181Der Senat legt seinem Verständnis der Klagepatentansprüche – wie das Landgericht – die vom Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung „Rotorelemente“ (Rn. 18 ff.) herausgearbeitete und in seiner Entscheidung „Stanzanordnung in Schenkelpolmaschine“ (Rn. 13) bestätigte Auslegung zugrunde, wonach der Patentanspruch abweichend von seinem reinen Wortlaut so zu lesen ist, dass das erste Stanzelement zum Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Polabschnitte eines jeden Elements und das zweite Stanzelement zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Grundkörperabschnitte eines jeden Elements vorgesehen ist. Bereits in der Merkmalsgliederung sind daher die im wörtlich verstandenen Patentanspruch vertauschten Begriffe „Polabschnitte“ und „Grundkörperabschnitte“ ausgetauscht (Merkmale 2.1, 2.2).
182Die erfindungsgemäß erstrebte einfachere Herstellung eines Rotors mit dem gewünschten Winkelprofil wird nach der Lehre des Klagepatents durch zwei Stanzwerkzeuge erreicht, die schrittweise (inkrementell) gegeneinander bewegt werden und so eine sukzessive Verschiebung des Polabschnitts zum Grundkörper bewirken (BGH-Urteile „Rotorelemente“ Rn. 8, „Stanzanordnung in Schenkelpolmaschine“ Rn. 9). Während nämlich das Stanzwerkzeug für den Polabschnitt fest steht, wird das Stanzwerkzeug für den Grundkörper schrittweise zwischen den aufeinanderfolgenden Stanzvorgängen bewegt. Dadurch wird bei den nacheinander ausgestanzten Elementen die sukzessive Verschiebung zwischen Polabschnitt und Grundkörper realisiert, wobei im montierten Zustand die Grundkörper miteinander fluchtend angeordnet sind, während die aneinandergereihten Polabschnitte die gewünschte Schrägstellung gegenüber der Hauptachse der Maschine aufweisen (vgl. Urteil BPatG II Rn. 20).
Dies vorausgeschickt bedürfen insbesondere die Merkmale 2.1 und 2.2 des Vorrichtungsanspruchs 1 einer näheren Erläuterung, wobei für den Verfahrensanspruch 6 – soweit nicht ausdrücklich angesprochen – Entsprechendes gilt.
Nach Merkmal 2.1 ist die Stanzanordnung einer erfindungsgemäßen Maschine mit einem ersten Stanzelement zum Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Polabschnitte eines jeden Elements versehen.
185Wie der Fachmann, ein Fachhochschulingenieur des Maschinenbaus oder der Fertigungstechnik mit besonderer Berufserfahrung in der Fertigung von Blechpaketen für elektrische Maschinen, der die Vorgaben für die Details der jeweils zu fertigenden Blechpakete von einem promovierten oder zumindest diplomierten Ingenieur der Elektrotechnik, der in der Optimierung elektrischer Motoren und Generatoren erfahren ist, erhält (vgl. BPatG-Urteil II Rn. 22), der Vorgabe, wonach das erste Stanzelement zum Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Polabschnitte eines jeden Elements vorgesehen ist, entnimmt, handelt es sich dabei um eine bloße Zweckangabe. Derartige Zweckangaben in einem Sachanspruch beschränken als solche dessen Gegenstand regelmäßig nicht. Die Zweckangabe ist damit aber nicht bedeutungslos. Sie hat vielmehr regelmäßig die Aufgabe, den durch das Patent geschützten Gegenstand dahin zu definieren, dass er nicht nur die räumlich-körperlichen Merkmale des Anspruchs erfüllen, sondern auch so ausgebildet sein muss, dass er für den im Patentanspruch angegebenen Zweck verwendbar ist (vgl. BGH, GRUR 1991, 436, 441 f. – Befestigungsvorrichtung II; GRUR 2006, 923 Rn. 15 – Luftabscheider für Milchsammelanlage; GRUR 2008, 896 Rn. 17 – Tintenpatrone; GRUR 2009, 837 Rn. 15 – Bauschalungsstütze, GRUR 2012, 475 Rn. 17 – Elektronenstrahltherapiesystem; GRUR 2018, 1128 Rn. 12 – Gurtstraffer; Urt. v. 07.09.2021 – X ZR 77/19, GRUR-RS 2021, 30741 Rn. 13 – Laserablationsvorrichtung). Dies bedeutet im Streitfall, dass das erste Stanzelement seiner räumlich-körperlichen Ausgestaltung nach geeignet sein muss, zumindest Teile der Polabschnitte durch Ausstanzen bereitzustellen.
186Nach dem eindeutig erscheinenden Wortlaut („zumindest von Teilen der Polabschnitte“) kann das erste Stanzelement auch so ausgebildet sein, dass es die Polabschnitte nicht nur teilweise, sondern vollständig ausstanzt. Soweit die Beklagten in der Berufungsinstanz die Auffassung vertreten, ein vollständiges Ausstanzen der Polabschnitte sei vom Anspruch nicht erfasst, vielmehr dürfe das erste Stanzelement zwingend nur denjenigen Teil der Polabschnitte stanzen, der allen Rotorelementen, unabhängig von dem jeweiligen Versatz ihrer Polabschnitte gegenüber der Mittellinie der Grundkörperabschnitte gemeinsam ist, entspricht dieses Verständnis nicht dem Wortlaut des Merkmals. Verlangt Patentanspruch 1 ein erstes Stanzelement zum Bereitstellen durch Ausstanzen „zumindest von Teilen der Polabschnitte“ eines Elements, lässt sich dies ausgehend vom Wortlaut nicht anders verstehen, als dass die Polabschnitte im Betrieb einer erfindungsgemäßen Vorrichtung auch vollständig ausgestanzt werden dürfen.
187An diesem Punkt bleibt der Fachmann allerdings nicht stehen. Selbst dann, wenn der Wortlaut des Patentanspruchs – wie hier – nach dem allgemeinen Sprachgebrauch oder dem Fachverständnis eindeutig zu sein scheint, ist stets eine Auslegung des Patentanspruchs geboten, in der es den technischen Sinngehalt des Patentanspruchs zu ermitteln gilt. Aus der Patentbeschreibung und den Zeichnungen, die gemäß Art. 69 Abs. 1 S. 2 EPÜ zur Auslegung heranzuziehen sind, kann sich ergeben, dass die Patentschrift Begriffe eigenständig definiert und insoweit ein eigenes Lexikon darstellt (BGH, GRUR 1999, 909, 912 – Spannschraube; „Rotorelemente“ Rn. 16; GRUR 2016, 361 Rn. 14 – Fugenband; GRUR 2021, 942 Rn. 22 – Anhängerkupplung II; Senat, Urt. v. 29.02.2024 – I-2 U 6/20, GRUR-RS 2024, 7537 Rn. 55 – Rohrbearbeitungsvorrichtung, m.w.N.).
188Auch bei einer weitergehenden Betrachtung findet der Fachmann jedoch keine Anhaltspunkte für ein einschränkendes Verständnis. Die von den Beklagten herangezogene Textstelle in Abs. [0013] ist zwar Teil der allgemeinen Beschreibung, beschreibt aber ausdrücklich eine bevorzugte Ausführungsform, wenn es dort heißt:
189„Bevorzugt ist der Teil des (ersten) Polabschnitts, der durch das erste Stanzelement hergestellt wird, derjenige Teil des Polabschnitts, der für alle Rotorelemente über den gesamten Bereich gemeinsam ist.“
190Dass in dem in den Figuren 4a, 5a und 6a gezeigten und in den Abs. [0028] ff. beschriebenen Ausführungsbeispiel das erste Stanzelement der Vorrichtung stets nur den äußeren Umfang der Polabschnitte ausstanzt, vermag den weitergehenden Anspruchswortlaut nicht zu beschränken. Ein Ausführungsbeispiel erlaubt regelmäßig – so auch hier – keine einschränkende Auslegung des die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs (vgl. BGH, GRUR 2004, 1023, 1024 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; GRUR 2017, 152 Rn. 21 – Zungenbett).
191Das Argument der Beklagten, Oberkante und Unterkante eines Polabschnitts könnten durch ein ortsfestes Stanzelement nicht gestanzt werden, da diese sich in Abhängigkeit von dem erfindungsgemäß angestrebten Versatz von Rotorelement zu Rotorelement unterschieden, führt ebenfalls nicht zu einem anderen Verständnis. Selbst wenn diese Sichtweise für die im Ausführungsbeispiel gezeigte Ausführungsform zutreffen sollte, ist der Anspruch darauf, wie soeben festgestellt, nicht beschränkt. Der Anspruch schließt – solange alle Merkmale verwirklicht sind – auch das Vorsehen weiterer Mittel zum Erreichen des insbesondere in den Merkmalen 4.1 und 4.2 beschriebenen Ergebnisses nicht aus (dazu noch unter b) dd) (2)).
192Auch aus den Ausführungen des Bundesgerichtshofs in der Entscheidung „Rotorelemente“ ergibt sich ein derartiges technisches Verständnis entgegen der Auffassung der Beklagten nicht. In Rn. 29 dieser Entscheidung heißt es:
193„Technisch sinnvoll ließe sich die zunächst nur teilweise Ausstanzung des Grundkörperabschnitts, die Merkmal 2.1 vorzusehen scheint, nur dahin verstehen, dass dem Ausstanzen seiner Längskanten die Ausstanzung seiner Fußlinie, gegebenenfalls zusammen mit der Oberkante des vorauslaufenden Polabschnitts, nachfolgt. …“
194Der Bundesgerichtshof würdigt sodann unter Zugrundelegung eines wörtlich verstandenen Anspruchswortlauts die in Unteranspruch 5 (= zum Zeitpunkt der Entscheidung Unteranspruch 6) beanspruchte Ausführungsform, in dem ein mit dem zweiten Stanzelement integral ausgebildetes drittes Stanzelement vorgesehen ist. Er gelangt hierbei zu dem Ergebnis (Rn. 31):
195„Mit diesem einteiligen beweglichen Werkzeug lassen sich jedoch im Wesentlichen auf der Mittellinie C/L des Grundkörperabschnitts liegende Krümmungsradien der Polabschnitte nicht erzeugen. Es lassen sich nicht einmal die (gleichmäßig) gekrümmten inneren Oberflächen des Grundkörperabschnitts erzeugen, mit denen die Rotorelemente im Ausführungsbeispiel auf der Welle angeordnet sind, weil die einteilige Stanze relativ zum Grundkörperabschnitt verschoben wird.“
196Die Beklagten leiten aus diesen auf den wörtlich verstandenen Anspruchswortlaut bezogenen Ausführungen ein Verständnis des Bundesgerichtshofs ab, wonach (nach einer Korrektur der vertauschten Begrifflichkeiten) die Polabschnitte nur teilweise ausgestanzt werden dürften. Dieser Interpretation vermag der Senat indes nicht zu folgen. Der Bundesgerichtshof würdigt mit der zitierten Urteilspassage Beschreibung und Ausführungsbeispiele des Klagepatents ausschließlich unter dem Gesichtspunkt eines widerspruchsfreien Verständnisses des Anspruchswortlauts, um nämlich die Frage beantworten zu können, ob dem Begriff „Polabschnitte“ die Bedeutung „Grundkörperabschnitte“ zuzumessen ist und umgekehrt. Zu der Frage des Schutzumfangs eines widerspruchsfrei verstandenen Anspruchs äußert sich der Bundesgerichtshof weder an der zitierten Stelle noch überhaupt in der Entscheidung „Rotorelemente“. Folgerichtig befasst sich auch die zitierte Textstelle ausschließlich mit der bevorzugten Ausführungsform des Unteranspruchs 5 und gelangt zu dem Schluss, dass bei einem wörtlichen Verständnis der genannten Begriffe der gerade durch diese Ausführungsform erstrebte Vorteil von im Wesentlichen auf der Mittellinie C/L des Grundkörperabschnitts liegenden Krümmungsradien der Polabschnitte sich nicht erzeugen ließe (BGH-Urteil „Rotorelemente“ Rn. 31). Die Schlussfolgerung, der Bundesgerichtshof halte ausschließlich ein nur teilweises und nicht auch ein vollständiges Ausstanzen durch das erste Stanzelement für technisch umsetzbar oder anspruchsgemäß, lässt sich daraus nicht ziehen.
Nach Merkmal 2.2 ist die Stanzanordnung einer erfindungsgemäßen Maschine ferner mit einem zweiten Stanzelement zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Grundkörperabschnitte eines jeden Elements versehen.
198Auch insoweit handelt es sich, wie der Fachmann der Formulierung zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Grundkörperabschnitte entnimmt, um eine Zweckangabe. Erforderlich, aber auch ausreichend ist demnach auch hier, dass die Stanzanordnung räumlich-körperlich so ausgestaltet ist, dass sie die objektive Eignung aufweist, die Grundkörperabschnitte durch Ausstanzen bereitzustellen. Zwischen den Parteien streitig ist insbesondere die Frage, ob sich die entsprechende Eignung des zweiten Stanzelements zwingend auf ein vollständiges Ausstanzen der Grundkörperabschnitte beziehen muss oder ob es auch ausreicht, wenn das zweite Stanzelement zum Ausstanzen lediglich von Teilen der Grundkörperabschnitte – namentlich dessen Seitenkanten – ausgebildet ist.
Bei einer Betrachtung des Wortlauts stellt sich der Fachmann zunächst die Frage, welche Bedeutung dem in Merkmal 2.2 – wie auch in Merkmal 2.1 – enthaltenen Begriff des Bereitstellens – in der nach Art. 70 Abs. 1 EPÜ maßgeblichen Verfahrenssprache „providing“ – zukommt. Das Landgericht hat hierzu ausgeführt, dass der Begriff des Bereitstellens nicht als ein Fertigstellen verstanden und schon vor diesem Hintergrund ein vollständiges Ausstanzen auch der Grundkörperabschnitte nicht verlangt werden könne. Gegen ein Verständnis, wonach das Bereitstellen begrifflich als Fertigstellen (des jeweiligen Abschnitts des Rotorelements) zu verstehen ist, spricht in der Tat, dass der Anspruch diesen Begriff in Merkmal 2.1 in Bezug auf die Polabschnitte verwendet, in diesem Fall aber, wie unter a) erläutert, ausdrücklich ein nur teilweises Ausstanzen genügen lässt. Im Zweifel ist gleichen Begriffen im Rahmen eines Patentanspruchs auch die gleiche Bedeutung beizumessen (BGH, GRUR 2017, 152 Rn. 17 – Zungenbett; Urt. v. 25.05.2023 – X ZR 54/21, GRUR-RS 2023, 21360 Rn. 23 – Schiebeverpackung; OLG Düsseldorf, Urt. v. 14.12.2017 – I-15 U 23/18, BeckRS 2017, 154037 Rn. 36; GRUR-RR 2023, 237 Rn. 87 – Waffenverschlusssystem II; Urt. v. 01.02.2024 – I-15 U 17/23, GRUR-RS 2024, 7766 Rn. 65 – Kartuschensystem). Ein unterschiedliches Verständnis des Begriffs des Bereitstellens scheint sich auch nicht daraus zu ergeben, dass das Bezugsobjekt (Polabschnitte/Grundkörperabschnitte) ein anderes ist. Vielmehr beschreibt das Bereitstellen bei einer rein sprachlichen Betrachtung den Beitrag des jeweiligen Stanzelements zu dem Leistungsergebnis, während der konkrete Umfang des hierfür vorzunehmenden Ausstanzens separat bestimmt werden muss. Der Begriff des Bereitstellens ist daher auch nicht isoliert, sondern stets im Zusammenhang mit der Forderung nach einem Ausstanzen zu lesen, also als ein „Bereitstellen durch Ausstanzen“ („providing by punching“). Dies wird auch dadurch bestätigt, dass das Klagepatent den Begriff auch an anderer Stelle ausschließlich in diesem Sinne verwendet (vgl. Abs. [0014], Unteranspruch 3).
200Nachdem also für den konkreten Umfang des erforderlichen Ausstanzens nicht allein auf den Begriff des Bereitstellens abgestellt werden kann, stellt sich die Frage, ob ein Ausstanzen der Grundkörperabschnitte dem reinen Wortlaut nach, wie es die Beklagten verstanden wissen wollen, nur ein vollständiges Ausstanzen der Grundkörperabschnitte insgesamt bedeuten kann. Auch wenn diese Sichtweise auf den ersten Blick nahezuliegen scheint; begrifflich zwingend ist sie jedenfalls nicht. Denn ein „vollständiges“ Ausstanzen oder ein Ausstanzen der Grundkörperabschnitte „insgesamt“ ist gerade nicht gefordert.
201Allerdings lässt der Fachmann in diesem Zusammenhang nicht den sprachlichen Unterschied zwischen den Merkmalen 2.1 und 2.2 außer Betracht. Während in Merkmal 2.2 von einem Bereitstellen durch Ausstanzen der Grundkörperabschnitte die Rede ist, spricht Merkmal 2.1 von einem Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Polabschnitte. In Fortführung des bereits zitierten Grundsatzes, wonach gleichen Begriffen im Rahmen eines Patentanspruchs im Zweifel auch die gleiche Bedeutung beizumessen ist (BGH, GRUR 2017, 152 Rn. 17 – Zungenbett; Urt. v. 25.05.2023 – X ZR 54/21, GRUR-RS 2023, 21360 Rn. 23 – Schiebeverpackung; OLG Düsseldorf, Urt. v. 14.12.2017 – I-15 U 23/18, BeckRS 2017, 154037 Rn. 36; GRUR-RR 2023, 237 Rn. 87 – Waffenverschlusssystem II; Urt. v. 01.02.2024 – I-15 U 17/23, GRUR-RS 2024, 7766 Rn. 65 – Kartuschensystem), kommt unterschiedlichen Begriffen im Zweifel auch eine unterschiedliche Bedeutung zu und deutet eine sprachliche Differenzierung somit auf ein unterschiedliches Verständnis hin. Wie es aber auch nach dem dargestellten Grundsatz nicht ausgeschlossen ist, dass gleichen Begriffen in unterschiedlichen Zusammenhängen doch unterschiedliche Bedeutungen zukommen (BGH, GRUR 2017, 152 Rn. 17 – Zungenbett), ist es ebenso wenig ausgeschlossen, dass unterschiedliche Begriffe in einem Patentanspruch die gleiche Bedeutung haben oder dass einer sprachlichen Differenzierung nicht mehr als eine klarstellende Wirkung zukommt. Dies ist anzunehmen, wenn die Auslegung des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit unter Berücksichtigung auch der Beschreibung und der Kennzeichnungen ein solches Verständnis ergibt (vgl. BGH, GRUR 2017, 152 Rn. 17 – Zungenbett; Urt. v. 12.03.2024 – X ZR 12/22, GRUR-RS 2024, 9316 Rn. 29 ff. – Variationsnut; OLG Düsseldorf Urt. v. 14.12.2017 – I-15 U 23/18, BeckRS 2017, 154037 Rn. 36 ff., jeweils zu der unterschiedlichen Bedeutung gleicher Begriffe).
202Im Streitfall ergibt die Auslegung des Patentanspruchs, dass der sprachlichen Differenzierung lediglich eine – bezogen auf Merkmal 2.1 – klarstellende Wirkung zukommt und dass auch Merkmal 2.2 eine Ausgestaltung des zweiten Stanzelements zulässt, bei dem zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Grundkörperabschnitte lediglich deren Seitenkanten ausgestanzt werden.
Zu dieser Sichtweise gelangt der Fachmann zunächst unter Berücksichtigung des in den Figuren 4a, 5a und 6a gezeigten und in den Abs. [0028] ff. beschriebenen (einzigen) Ausführungsbeispiels des Klagepatents, welches eine erfindungsgemäße Vorrichtung zeigt und deren Betriebsweise erläutert. Zur Veranschaulichung wird nachstehend Figur 4a nochmals eingeblendet:
204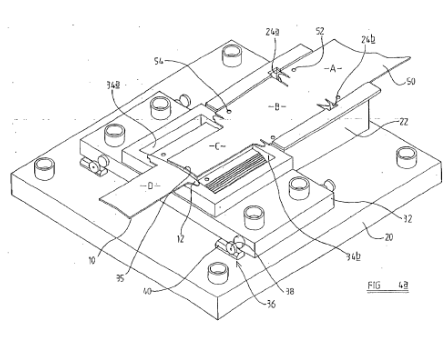
Danach ist auf einer Basisplatte 20 ein erstes ortsfestes Stanzelement (die member) 22 und benachbart zu diesem ein zweites bewegliches Stanzelement 32 angeordnet (Abs. [0029]). Das Stanzelement 22 weist zwei Stanzöffnungen 24a und 24b auf, von denen jede einer Fläche entspricht, die an einen Teil der Umfangslinie des Polabschnitts angrenzt (Abs. [0030]). Das bewegliche Stanzelement 32 weist Stanzöffnungen 34a und 34b auf, von denen jede einer Fläche entspricht, die an die (Längs-)Seite des Grundkörperabschnitts angrenzt, sowie eine sich dazwischen erstreckende dritte Stanzöffnung 35 (Abs. [0031]). Unter Ausnutzung dieser Stanzöffnungen werden mittels nicht dargestellter Stanzen die Rotorelemente ausgestanzt (Abs. [0035 ff.]), indem in Position B zunächst die Polabschnitte teilweise ausgestanzt werden (Abs. [0035]) und in Position C die Grundkörperabschnitte gestanzt werden (Abs. [0036]), so dass auf diese Weise mit dem Ausstanzen des Grundkörperabschnitts mittels der Stanzen (punch members) 64a und 64b und einer einteilig mit diesen ausgebildeten dritten Stanze 65 gleichzeitig das Ausstanzen der Polabschnitte vollendet wird und in Position D ein vollständiges Rotorelement bereitsteht (Abs. [0037]). Die Beschreibung erläutert weiter, es verstehe sich, dass die Stanzen beider Stanzelemente 22, 32 gleichzeitig betätigt würden. Im Anschluss an jeden Stanzvorgang werde ein Antriebsmittel 36 betätigt, um das Stanzelement 32 inkrementell in einer Richtung zu versetzen und damit einen Versatz des Polabschnittabschnitts von der Mittellinie des Grundkörperabschnitts zu erzeugen (Abs. [0039]) (vgl. BGH-Urteile „Rotorelemente“ Rn. 21, „Stanzanordnung in Schenkelpolmaschine“ Rn. 16).
206Was die Grundkörperabschnitte angeht, werden diese also in dem Ausführungsbeispiel durch zwei Stanzelemente ausgestanzt: Das zweite Stanzelement, welches die Seitenkanten ausstanzt und das dritte Stanzelement, welches die untere Oberfläche des Rotors, also die Fußlinie des Grundkörperabschnitts, ausstanzt. Beide Stanzelemente sind in dem dargestellten Ausführungsbeispiel einteilig ausgebildet (Abs. [0037]) und werden, wie auch das die äußersten Ränder der Polelemente ausstanzende erste Stanzelement, gleichzeitig betätigt (vgl. Abs. [0035], [0039]). Indem das dritte Stanzelement in einer besonders bevorzugten Ausführungsform sowohl die gekrümmte äußere Oberfläche des Polelements als auch die gekrümmte innere Oberfläche des Grundkörperabschnitts erzeugt, kann der Vorteil erzielt werden, dass die Mittellinie des Krümmungsradius der Polabschnitte im Wesentlichen auf der Mittellinie C/L des Grundkörperabschnitts bleibt, obwohl sich der Versatz des Polabschnitts von der Mittellinie bei den einzelnen Rotorelementen unterscheidet (vgl. Abs. [0042]). Dies wiederum führt im gestapelten Zustand der Rotorelemente zu einer konstant bleibenden Mittellinie der äußeren Oberfläche, was wiederum – trotz winkelartiger Anordnung –einen konstant bleibenden Luftspalt zwischen der äußeren und der inneren Oberfläche des Stators ermöglicht (Abs. [0043]).
207Auch der Bundesgerichtshof würdigt in der Entscheidung „Rotorelemente“ die Beschreibung der Ausführungsbeispiele in dem Sinne, dass die Grundkörperabschnitte teilweise von einem dritten Stanzelement ausgestanzt werden. Dies ergibt sich etwa aus der bereits zitierten Urteilspassage in Rn. 21 („… so dass auf diese Weise mit dem Ausstanzen des Grundkörperabschnitts mittels der Stanzen (punch members) 64a und 64b und einer einteilig mit diesen ausgebildeten dritten Stanze 65 …“).
208Festzuhalten bleibt also, dass in dem Ausführungsbeispiel des Klagepatents das zweite Stanzelement nur die Seitenkanten des Grundkörperabschnitts eines jeden Elements ausstanzt, während dessen Fußlinie von einem dritten Stanzelement ausgestanzt wird. Nachdem die im Patentanspruch verwendeten Begriffe im Zweifel so zu verstehen sind, dass sämtliche Ausführungsbeispiele zu ihrer Ausfüllung herangezogen werden können (BGH, GRUR 2015, 972 Rn. 23 – Kreuzgestänge), spricht dies gegen ein Verständnis, wonach das zweite Stanzelement zwingend zum Ausstanzen auch der Fußlinie des Grundkörperabschnitts ausgebildet sein muss.
In dem hierdurch nahegelegten Verständnis sieht sich der Fachmann durch die Unteransprüche 3 und 5 bestätigt.
210Unteranspruch 3 lehrt eine vorteilhafte Ausgestaltung einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 2, welche dadurch gekennzeichnet ist, dass die Stanzanordnung ein drittes Stanzelement zum Bereitstellen durch Ausstanzen eines Umfangsrands zwischen dem Grundkörperabschnitt eines Elements und einem Polabschnitt eines Elements, das durch einen vorangehenden Ausstanzvorgang gebildet worden ist, aufweist. Unteranspruch 5 beansprucht sodann Schutz für eine Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die zweiten und dritten Stanzelemente integral sind.
Die Ermittlung des Sinngehalts eines Unteranspruchs kann grundsätzlich zur richtigen Auslegung des Hauptanspruchs beitragen, da Unteransprüche die im Hauptanspruch unter Schutz gestellte Lösung weiter ausgestalten und daher – mittelbar – Erkenntnisse über deren technische Lehre zulassen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass sie regelmäßig den Gegenstand des Hauptanspruchs nicht einengen, sondern, nicht anders als Ausführungsbeispiele, lediglich – ggf. mit einem zusätzlichen Vorteil verbundene – Möglichkeiten seiner Ausgestaltung aufzeigen (BGH, GRUR 2016, 1031 Rn. 15 – Wärmetauscher; OLG Düsseldorf Urt. v. 21.12.2017 – I-15 U 88/16, GRUR-RS 2017, 147787, Rn. 35 – Flüssigkeitssprüheinrichtung; Urt. v. 18.06.2020 – I-15 U 65/19, GRUR-RS 2020, 53264 Rn. 35 – Schutzbügel; Urt. v. 30.09.2021 – I-2 U 5/21, GRUR-RS 2021, 34296 Rn. 71 – Laufsohle; Urt. v. 11.11.2021 – I-15 U 25/20; Urt. v. 09.12.2021 – I-2 U 1/21, GRUR-RS 2021, 39600 Rn. 21 – Rasierapparat; Urt. v. 24.02.2022 – I-2 U 19/21, GRUR-RS 2022, 5981 Rn. 40 – Tätowiervorrichtung; Urt. v. 17.08.2023 – I-15 U 39/22, GRUR-RS 2023, 42708 Rn. 86 – Unterbauleiste). Inwieweit sich aus dem Gegenstand eines Unteranspruchs tragfähige Rückschlüsse für das Verständnis des Hauptanspruchs und der in ihm verwendeten Begriffe gewinnen lassen, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, insbesondere auch davon, worin die mit dem Unteranspruch vorgeschlagene Ergänzung der technischen Lehre des Hauptanspruchs besteht und auf welche Weise sie den Gegenstand des Hauptanspruchs fortbildet: Wird dadurch etwa ein Merkmal im Interesse funktionaler Optimierung um einen dieses Merkmal weiter ausformenden Aspekt ergänzt, kann dies unter Umständeneher tragfähige Rückschlüsse auf das dem betreffenden Merkmal im Rahmen der Lehre des Klagepatents beizulegende Verständnis ermöglichen, als wenn den Merkmalen des Hauptanspruchs additiv ein weiteres Element hinzugefügt wird (BGH, GRUR 2016, 1031 Rn. 15 – Wärmetauscher; GRUR 2021, 45 Rn. 28 – Signalumsetzung; OLG Düsseldorf, Urt. v. 18.06.2020 – I-15 U 65/19, GRUR-RS 2020, 53264 Rn. 35 – Schutzbügel; Urt. v. 24.02.2022 – I-2 U 19/21, GRUR-RS 2022, 5981 Rn. 40 – Tätowiervorrichtung; Urt. v. 17.08.2023 – I-15 U 39/22, GRUR-RS 2023, 42708 Rn. 86 – Unterbauleiste).
212Im Streitfall lassen die Unteransprüche 3 und 5 Rückschlüsse auf das Verständnis des Hauptanspruchs zu. Sie fügen dem Anspruch 1 nicht nur – additiv – ein Merkmal hinzu, sondern ergänzen diesen auch um einen funktionalen Aspekt. Durch das Vorsehen eines integral mit dem zweiten Stanzelement ausgebildeten dritten Stanzelements (Unteranspruch 5) kann der bereits erwähnte, in Abs. [0042] f. beschriebene Vorteil einer gleichbleibenden Mittellinie und damit des konstanten Luftspalts erzielt werden, wenn mit diesem Ausstanzelement die gekrümmte äußere Oberfläche des Polelements zusammen mit den gekrümmten inneren Oberflächen des Grundkörperabschnitts erzeugt wird. Unteranspruch 3 greift ebenfalls das bereits im Ausführungsbeispiel als vorteilhaft beschriebene Vorsehen eines dritten Stanzelements auf und beschreibt mit dem Bereitstellen durch Ausstanzen eines Umfangsrands zwischen dem Grundkörperabschnitt eines Elements und einem Polabschnitt eines durch einen vorangehenden Ausstanzvorgang gebildeten Elements einen funktional als vorteilhaft erachteten Aspekt.
Davon ausgehend sieht sich der Fachmann durch die Unteransprüche 3 und 5 zunächst in seinem Verständnis bestätigt, dass ein drittes Stanzelement vorgesehen sein kann, welches einen Teil des späteren Grundkörperabschnitts ausstanzt. Denn bei einem Verständnis, wonach Hauptanspruch 1 zwingend die Eignung zum Ausstanzen des vollständigen Grundkörperabschnitts fordert, bliebe für das Teile des Grundkörperabschnitts ausstanzende dritte Stanzelement kein sinnvoller Anwendungsbereich.
214Dem lässt sich auch nicht entgegenhalten, der in Unteranspruch 3 angesprochene Umfangsrand sei kein Teil des Grundkörperabschnitts. Die Beklagten berufen sich in diesem Zusammenhang auf Abs. [0014] der Beschreibung, in dem das optionale dritte Stanzelement wie folgt beschrieben wird:
215„In bevorzugter Weise umfaßt die Stanzanordnung ein drittes Stanzelement zum Bereitstellen, durch Stanzen, eines Umfangsrands, der gekrümmt sein kann und eine gekrümmte äußere Oberfläche des Polabschnitts bildet, zwischen dem ersten Abschnitt eines Elements und einem zweiten Abschnitt eines Elements, das durch einen vorangegangenen Stanzvorgang hergestellt worden ist.“
216(Hervorhebungen hinzugefügt)
217Sie betonen, hiermit sei ein von dem zweiten Stanzelement separat ausgebildetes drittes Stanzelement beschrieben, dessen Funktion sich stets und ausschließlich auf das Ausstanzen des gekrümmten Umfangsrands, nicht dagegen auf das Ausstanzen der Unterkante bzw. Fußlinie des Grundkörperabschnitts beziehe. Erst in Unteranspruch 5 sowie Abs. [0015], [0029] und [0035] und Figur 7 würden das funktional dem Ausstanzen des Grundkörperabschnitts inklusive Unterkante zugeordnete zweite Stanzelement und das funktional dem fertigen Ausstanzen des Polabschnitts durch Stanzen des Umfangsrands zugeordnete dritte Stanzelement in der Ausführungsform eines integral ausgebildeten (zweiten und dritten) Stanzelements zusammengeführt.
218Auch wenn Unteranspruch 3 von einem Umfangsrand „zwischen“ dem Grundkörperabschnitt eines Elements und einem Polabschnitt eines durch einen vorangehenden Ausstanzvorgang gebildeten Elements spricht, kann damit allerdings ein Teil des Grundkörperabschnitts angesprochen sein, nämlich dessen untere Oberfläche, die der äußeren Oberfläche der Polelemente entspricht. Dieser kann beispielsweise von einem gemäß Figur 7 ausgebildeten Werkzeug gebildet werden. Von dieser Sichtweise geht auch der Bundesgerichtshof aus, wie sich den nachfolgend wiedergegebenen Ausführungen der Entscheidung „Rotorelemente“ entnehmen lässt (Rn. 30):
219„Die Stanze 65 gehört zu einem dritten Stanzelement 35, das nach Patentanspruch 4 (= nunmehr Anspruch 3) zum Ausstanzen eines Umfangsrands zwischen dem Grundkörperabschnitt eines Elements und dem Polabschnitt eines durch den vorangegangenen Ausstanzvorgang gebildeten Elements dient. Nach Patentanspruch 6 (= nunmehr Anspruch 5) sind die zweiten und dritten Stanzelemente integral ausgebildet. Es sind in Patentanspruch 6 (= nunmehr Anspruch 5) einteilig ausgebildete Stanzen 64a, 64b, 65 unter Schutz gestellt, wie sie in der Beschreibung erläutert und in Figur 7 gezeigt sind. …“
220(Hervorhebungen hinzugefügt)
221Was vor diesem Hintergrund mit dem Umfangsrand gemeint sein kann, erschließt sich mit Blick auf die nachfolgend eingeblendete Figur 7 und der Erläuterung hierzu in Abs. [0038]:
222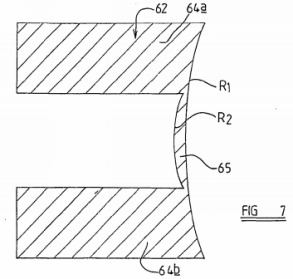
Abs. [0038] lautet:
224„Wie sich anhand von Fig. 7 ergibt, weisen die überbrückende Öffnung 35 und der entsprechende Ausstanzabschnitt 65 Oberflächen auf, die mit Krümmungsradien R1 und R2 versehen sind, wobei der Radius R1 gleich dem gewünschten Krümmungsradius der äußeren Oberflächen der Polelemente ist, während der Radius R2 gleich dem Radius der unteren Oberflächen des Rotors ist.“
225Vor diesem Hintergrund liegt es auch nahe, dass in Abs. [0014], obgleich dort nur eine gekrümmte obere Oberfläche des Polabschnitts angesprochen ist, durch die Bezugnahme auf den Bereich zwischen einem vorangegangenen und einem nachfolgenden Element auch die untere Oberfläche des Grundkörperabschnitts in Bezug genommen ist. Ausgehend von dem bandförmigen Material, aus dem erfindungsgemäß die Rotorelemente gebildet werden, grenzt an die obere Oberfläche eines Elements die untere Oberfläche eines entweder vor- oder nachlaufenden Elements an. Selbst wenn man dem aber nicht folgt, ist Abs. [0014] jedenfalls ausdrücklich die Beschreibung einer bevorzugten Ausführungsform und definiert dieser das dritte Stanzelement nicht allgemein dahin, dass dieses nur Teile der Polabschnitte stanzt.
Darüber hinaus zieht der Fachmann aus dem Umstand, dass erst Unteranspruch 5 die integrale Ausbildung des zweiten und dritten Stanzelements vorsieht, den Schluss, dass das dritte Stanzelement von dem zweiten Stanzelement nicht nur funktional, sondern auch baulich separat ausgebildet sein kann. Dies bestärkt ihn in der Sichtweise, dass die Möglichkeit des Vorsehens eines dritten Stanzelements ernst zu nehmen ist und der Anspruch – auch in Bezug auf das Ausstanzen der Grundkörperabschnitte – nicht abschließend sein kann (dazu noch unter dd) (2)).
Der Einwand der Beklagten, Unteranspruch 3 beziehe sich auf die in Figur 4a gezeigte Ausführungsform einschließlich der dort gezeigten Stanzreihenfolge und könne daher nur dann zur Auslegung der Hauptansprüche 1 und 6 herangezogen werden, wenn auch diesen die dort gezeigte Stanzreihenfolge beigemessen werde, vermag nicht zu überzeugen. Bei Unteranspruch 3 handelt es sich ebenso wie bei Patentanspruch 1, auf den Unteranspruch 3 rückbezogen ist, um einen Sachanspruch, dessen Merkmale dazu bestimmt sind, die geschützte Sache zu beschreiben, d.h. die Maschine und damit ggf. mittelbar die Ausgestaltung der Erzeugnisse, die mit ihr hergestellt werden können (BGH-Urteil „Rotorelemente“ Rn. 30). Was Patentanspruch 1 anbelangt, ergibt sich weder aus der Bezeichnung der Stanzelemente als „erstes Stanzelement“ und als „zweites Stanzelement“ noch aus den Vorgaben betreffend die Stanzanordnung und deren Stanzelemente unmittelbar oder mittelbar eine „Stanzreihenfolge“. Für den Unteranspruch 3 gilt nichts anderes.
Eine andere Sichtweise folgt auch nicht aus einem anspruchsgemäß zwingend zu erzielenden „Leistungsergebnis“. Eine erfindungsgemäße Vorrichtung muss zwar zum Herstellen fertiger, aus dem bandförmigen Material herausgetrennter Rotorelemente mit integral ausgebildeten Grundkörper- und Polabschnitten geeignet sein (dazu unter (1)). Daraus lässt sich aber nicht ableiten, dass solches mit den in den Merkmalen 2.1 und 2.2 genannten Stanzelementen erfolgen und insbesondere das zweite Stanzelement die Grundkörperabschnitte vollständig ausstanzen müsste (dazu unter (2)). Auch der optional vorgesehene Vorteil eines gleichmäßigen Luftspalts legt ein solches Verständnis nicht nahe (dazu unter (3)).
Dass die Vorrichtung die objektive Eignung aufweisen muss, aus dem bandförmigen Material herausgetrennte Elemente herzustellen, ergibt sich bereits aus den Merkmalen 1.1 und 1.3. Danach handelt es sich um eine Vorrichtung zum Herstellen von Elementen, wobei die Elemente im Gebrauch aufeinandergestapelt werden, um eine Anordnung von gestapelten Elementen für eine elektrische Maschine zu bilden. Es handelt sich auch hierbei um eine Zweckangabe, die, wie bereits erörtert, den durch das Patent geschützten Gegenstand dahingehend definiert, dass er so ausgebildet sein muss, dass er für den im Patentanspruch angegebenen Zweck verwendbar ist. Es leuchtet unmittelbar ein, dass die Elemente nur dann im Gebrauch aufeinandergestapelt werden können, wenn sie aus dem bandförmigen Material herausgetrennt sind. Entsprechend zeigen auch die Figuren 4b, 5b und 6b jeweils herausgetrennte Rotorelemente als Ergebnis des Betriebs der im Ausführungsbeispiel gezeigten Vorrichtung (vgl. Abs. [0041]). Folgerichtig spricht auch Abs. [0037] in Bezug auf das Ausführungsbeispiel davon, dass nach Durchlaufen der Stanzanordnung an der Position D ein „vollständiges Rotorelement“ hergestellt ist.
230Das fertige Rotorelement, zu dessen Herstellung eine erfindungsgemäße Vorrichtung geeignet sein muss, wird zudem durch die Merkmale 4.1 und 4.2 weiter konkretisiert: Die mit der Vorrichtung hergestellten Rotorelemente müssen den dortigen Vorgaben entsprechen, somit die Grundkörperabschnitte eine gemeinsame Mittelinie aufweisen, die (nicht symmetrischen) Polabschnitte hingegen einen Versatz aus der Mittellinie in die eine oder andere Richtung (BGH-Urteile „Rotorelemente“ Rn. 26, „Stanzanordnung in Schenkelpolmaschine“ Rn. 17).
Aus der anspruchsgemäß erforderlichen Eignung der Vorrichtung, fertige Rotorelemente mit Grundkörper- und Polabschnitten herzustellen, lässt sich indes nicht der Schluss ziehen, das zweite Stanzelement müsse zum vollständigen Ausstanzen der Grundkörperabschnitte ausgebildet sein.
232Dass der Anspruch zwar auf die Herstellung eines fertigen Rotorelements gerichtet ist, die hierfür eingesetzten Vorrichtungsbestandteile aber nicht zwingend abschließend beschreibt, wird bereits daran deutlich, dass Merkmal 2.1 ausdrücklich die Eignung zum Ausstanzen von Teilen der Polabschnitte ausreichen lässt, sich aber im Anspruch selbst nicht dazu verhält, durch welchen Bestandteil der Vorrichtung der in diesem Fall verbleibende Rest der Polabschnitte ausgestanzt wird. Insbesondere lässt sich dem Anspruch selbst nicht entnehmen, dass das zweite Stanzelement dazu ausgebildet ist, neben dem Ausstanzen der Grundkörperabschnitte auch den verbleibenden Rest der Polabschnitte auszustanzen. Auch wenn eine solche Ausgestaltung nach dem Anspruch nicht ausgeschlossen ist, ist ebenso – wie im Ausführungsbeispiel und den Unteransprüchen 3 und 5 – die Ausbildung eines dritten Stanzelements möglich. Auch Merkmal 2, wonach die Stanzordnung einer erfindungsgemäßen Maschine mit einem ersten und zweiten Stanzelement versehen ist, schließt die Ausbildung weiterer Stanzelemente nicht aus.
Soweit es den bereits erwähnten, in Abs. [0042] f. geschilderten Vorteil eines trotz winkelartiger Anordnung der Elemente konstant bleibenden Luftspalts zwischen der äußeren und der inneren Oberfläche des Stators angeht, lässt sich daraus entgegen der Auffassung der Beklagten nicht der Schluss ziehen, das zweite Stanzelement müsse zu einem vollständigen Ausstanzen der Grundkörperabschnitte ausgebildet sein.
234Es handelt sich bei dem genannten Effekt schon nicht um einen von der erfindungsgemäßen Vorrichtung stets angestrebten, erst recht nicht um einen zwingenden Vorteil. Die trotz winkelartiger Anordnung konstante Mittellinie der äußeren Oberfläche und damit der konstant bleibende Luftstrom wird nach den Ausführungen des Klagepatents durch eine ganz bestimmte Ausgestaltung erreicht, die in Abs. [0042] beschrieben ist und (teilweise) in Unteranspruch 5 Niederschlag gefunden hat. Gerade durch das gemeinsame Herstellen der gekrümmten äußeren Oberfläche des Polelements und der gekrümmten inneren Oberflächen des Grundkörperabschnitts durch die dritte Stanzanordnung wird dieser Effekt erzielt. Diesen Zusammenhang macht Abs. [0042] selbst unmittelbar deutlich:
235„Da das Ausstanzelement 65, das die gekrümmte äußere Oberfläche des Polelements erzeugt, zusammen mit den gekrümmten inneren Oberflächen des Grundkörperabschnitts durch die dritte Stanzanordnung hergestellt wird, insbesondere dadurch, dass das Ausstanzelement 65 in die Stanzöffnung 35 bewegt wird, bleibt die Mittellinie des Krümmungsradius der Polabschnitte notwendigerweise im wesentlichen auf der Mittellinie C/L des Grundkörperabschnitts, wobei insbesondere auf Fig. 7 verwiesen sei, obwohl sich der Versatz des Polabschnitts um einen Schritt ausgehend von der theoretischen Position unterscheidet.“
236(Hervorhebungen hinzugefügt)
237Nachdem Patentanspruch 1 selbst die für die Erzielung dieses Vorteils erforderlichen Mittel gerade nicht nennt, lässt sich daraus keine Aufgabe ableiten, die nach der beanspruchten Lehre zwingend erfüllt sein müsste (vgl. OLG Karlsruhe Urt. v. 08.12.2021 – 6 U 123/19, GRUR-RS 2021, 51803 Rn. 70 – Spracherkennungsvorrichtung).
238Soweit die Beklagten erstmals in der Berufungsinstanz geltend machen, Rotorelemente mit versetzten Polköpfen, die die Eigenschaft eine solchen gleichmäßigen Luftstroms nicht aufwiesen, seien aus Sicht des Fachmanns zur Verwendung als Rotorelement in einer elektrischen Maschine gänzlich ungeeignet, kann offen bleiben, ob sie damit in der Berufungsinstanz noch gehört werden können. Jedenfalls ergibt sich aus dem Vorbringen der Beklagten, worauf die Klägerin zu Recht hingewiesen hat, nicht, dass dies auch bereits am Prioritätstag des Klagepatents der Fall war bzw. so gesehen wurde.
Ein anderes Verständnis ist schließlich nicht mit Blick auf die Ausführungen des Bundesgerichtshofs in der Entscheidung „Rotorelemente“ geboten.
Die entsprechenden Ausführungen stellen eine gewichtige Auslegungshilfe dar, eine rechtliche Bindungswirkung an die Entscheidungsgründe besteht entgegen der Auffassung der Beklagten jedoch nicht.
Die Bestimmung des Sinngehalts eines Patentanspruchs ist Rechtserkenntnis und vom Verletzungsgericht, wie von jedem anderen damit befassten Gericht, eigenverantwortlich vorzunehmen (BGH, GRUR 2009, 653 Rn. 16 – Straßenbaumaschine; GRUR 2010, 858 Rn. 10 – Crimpwerkzeug III; GRUR 2015, 972 Rn. 20 – Kreuzgestänge). Die schließt die Möglichkeit ein, dass das Verletzungsgericht zu einem Auslegungsergebnis gelangt, das von demjenigen abweicht, das der Bundesgerichtshof in einem dasselbe Patent betreffenden Nichtigkeitsverfahren gewonnen hat (BGH, GRUR 2015, 972 Rn. 20 – Kreuzgestänge). Auch wenn der Senat an die Ausführungen des Bundesgerichtshofs in der Entscheidung „Rotorelemente“ vor diesem Hintergrund nicht gebunden ist, sind sie allerdings als gewichtige sachkundige Stellungnahme bei der Auslegung zu berücksichtigen (vgl. BGH, GRUR 1996, 757, 759 – Zahnkranzfräser; GRUR 1998, 895, 896 – Regenbecken; GRUR 2010, 950 Rn. 14 – Walzenformgebungsmaschine; OLG Düsseldorf, Urt. v. 09.12.2021 – I-2 U 9/21, GRUR-RS 2021, 39586 Rn. 59 – Halterahmen III; Urt. v. 16.03.2023 – I-15 U 58/21, GRUR-RS 2023, 44797 Rn. 76 – Beleuchtungskörper).
Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass die Entscheidungsgründe des Urteils „Rotorelemente“ teilweise an die Stelle der Beschreibung getreten wären.
243Mit einer Beschränkung der Patentansprüche durch ein Nichtigkeitsurteil geht eine rechtsgestaltende Rückwirkung der geänderten Anspruchsfassung einher (BGH, GRUR 1979, 308, 309 – Auspuffkanal für Schaltgase; GRUR 2007, 778 Rn. 20 – Ziehmaschinenzugeinheit; OLG Düsseldorf, Urt. v. 11.11.2021 – I-15 U 25/20, GRUR-RS 2021, 37635 Rn. 85 – Sanitäre Einsetzeinheit). Grundsätzlich treten die Abweichungen der Anspruchsfassung von der Patentschrift behandelnden Entscheidungsgründe an die Stelle der ursprünglichen Patentbeschreibung und bilden für das Verletzungsgericht den maßgeblichen Text der Patentbeschreibung (BGH, GRUR 1979, 308, 309 – Auspuffkanal für Schaltgase; GRUR 1999, 145, 146 – Stoßwellen-Lithotripter; OLG Düsseldorf, Urt. v. 21.04.2005 – I-2 U 111/03, BeckRS 2006, 10244; Urt. v. 09.12.2021 – I-2 U 9/21, GRUR-RS 2021, 39586 Rn. 60 – Halterahmen III; Urt. v. 11.11.2021 – I-15 U 25/20, GRUR-RS 2021, 37635 Rn. 85 – Sanitäre Einsetzeinheit; Benkard/Scharen, Patentgesetz, 12. Aufl. 2023, § 14 Rn. 26). Der Gegenstand des Patentanspruchs ergibt sich folglich nunmehr aus dem Wortlaut des neugefassten Anspruchs, wie er durch Beschreibung und die Zeichnungen im Lichte der insoweit ergangenen Entscheidungsgründe erläutert ist. Es verbietet sich deshalb, im Nichtigkeitsverfahren in den Anspruch neu eingefügte beschränkende Merkmale bei der Auslegung für unerheblich anzusehen und wieder zu eliminieren (vgl. BGH, GRUR 1961, 335, 337 – Bettcouch; BGHZ 73, 40, 45 – Aufhänger). Da das Verletzungsgericht an den Erteilungsakt – und folglich auch an dessen weiteres Schicksal im Rechtsbestandsverfahren – gebunden ist, ist es ausgeschlossen, dass im Verletzungsprozess eine Patentauslegung und/oder eine Schutzbereichsbestimmung vorgenommen werden, mit denen solche Gegenstände, die dem Patentinhaber im Rechtsbestandsverfahren als Schutzgegenstand genommen worden sind, wieder in das Patent und seinen Schutz einbezogen werden (Senat, Urt. v. 14.12.2022 – I-2 U 2/17, GRUR-RS 2022, 38378 Rn. 23 – Lichtemittierendes Bauelement). Im Streitfall liegt indes, was das von den Beklagten in Bezug genommene erste Nichtigkeitsberufungsverfahren des Bundesgerichtshofs anbelangt, bereits keine Beschränkung der Patentansprüche vor. Der Bundesgerichtshof hat den Patentanspruch mit der Entscheidung „Rotorelemente“ ausdrücklich und unmissverständlich ausgelegt und so den Wortsinn des Anspruchs ermittelt, den Anspruch aber nicht verändert und schon gar nicht beschränkt. Es gibt daher insoweit keine gerichtliche Entscheidungsgründe für eine Beschränkung, die die den Patentanspruch erläuternde Beschreibung ersetzen oder ergänzen könnte.
Auch das Gebot der Rechtssicherheit, wie es unter anderem in Art. 1 S. 3 des Protokolls über die Auslegung des Art. 69 EPÜ Erwähnung findet, begründet keine Bindungswirkung der Entscheidungsgründe. Soweit die Beklagten in diesem Zusammenhang darauf abstellen, der Bundesgerichtshof habe mit seiner Auslegung entgegen Art. 69 Abs. 1 EPÜ, § 14 S. 1 PatG den Anspruchswortlaut bewusst verlassen, der dem Verkehr sonst als Ausgangspunkt und Grundlage der Anspruchsauslegung diene, weshalb als Anknüpfungspunkt für die Bestimmung des Schutzbereichs des Klagepatents nunmehr allein das den Merkmalen in der Entscheidung „Rotorelemente“ beigemessene Verständnis dienen könne, trifft dies bereits im Ausgangspunkt nicht zu. Der Bundesgerichtshof hat mit seiner Auslegung keinesfalls entgegen Art. 69 Abs. 1 EPÜ, § 14 S. 1 PatG den Anspruchswortlaut bewusst verlassen, er hat die in den entsprechenden Vorschriften niedergelegten Auslegungsgrundsätze vielmehr zur Ermittlung des Wortsinns herangezogen. Nachdem er zudem ausdrücklich festgestellt hat, dass es sich um eine Auslegung des Patentanspruchs handelt (vgl. BGH-Urteil „Rotorelemente“ Rn. 15 f.; siehe dazu auch Meier-Beck, GRUR 2016, 865, 867; FS 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf, 361, 367), gebietet es das Gebot der Rechtssicherheit – im Gegenteil – diese Feststellung ernst zu nehmen und nicht entgegen der ausdrücklichen Aussage des Bundesgerichtshofs von einer Anspruchsbeschränkung auszugehen.
In diesem Sinne als eine gewichtige sachkundige Stellungnahme verstanden ergibt sich aus den Ausführungen des Bundesgerichtshofs in der Entscheidung „Rotorelemente“ kein anderes Verständnis.
Bei der Würdigung der Entscheidung „Rotorelemente“ ist zu bedenken, dass der Bundesgerichtshof darin einen ganz bestimmten Aspekt behandelt, nämlich ob die Merkmale 2.1 und 2.2 abweichend vom Wortlaut des Anspruchs dahin zu lesen sind, dass mit den „Grundkörperabschnitten“ die „Polabschnitte“ gemeint sind und umgekehrt. Er erörtert in diesem Zusammenhang insbesondere die Frage, ob ein wörtlich genommener Patentanspruch mit der Beschreibung und den Ausführungsbeispielen in Widerspruch tritt und ob sich Unteranspruch 5 (= zum Zeitpunkt der Entscheidung Unteranspruch 6) bei einem wörtlichen Verständnis technisch sinnvoll umsetzen ließe. Zu diesem Zweck untersucht der Bundesgerichtshof den Offenbarungsgehalt der Klagepatentschrift (vgl. BGH-Urteil „Rotorelemente“ Rn. 32), nicht jedoch den Schutzbereich eines widerspruchsfrei ausgelegten Patentanspruchs. Offenbarung und Schutzbereich haben unmittelbar nichts miteinander zu tun, wie sich schon daran zeigt, dass in der Patentschrift nicht offenbarte, sondern anhand des Patentanspruchs nur naheliegende Abwandlungen unter Äquivalenzgesichtspunkten in den Schutzbereich einbezogen werden (OLG Düsseldorf, Urt. v. 17.08.2023 – I-15 U 39/22, GRUR-RS 2023, 42708 Rn. 83 – Unterbauleiste).
Vor diesem Hintergrund ist auch die von den Beklagten herangezogene Textstelle in Rn. 23 der Entscheidung zu lesen, die wie folgt lautet:
248„… Hingegen findet die Möglichkeit, den (gleichförmigen) Grundkörper mit dem ersten Stanzwerkzeug nur teilweise auszustanzen, den Polabschnitt und den Rest des Grundkörperabschnitts aber mit weiteren Stanzwerkzeugen, keinerlei Anklang in der Beschreibung.“
249(Hervorhebungen hinzugefügt)
250Diese Urteilspassage ist in den Kontext der Würdigung einer bevorzugten Ausführungsform einzuordnen, was der Bundesgerichtshof in Rn. 23 auch deutlich macht. Sie bedeutet vor diesem Hintergrund lediglich, dass ein teilweises Ausstanzen der Grundkörperabschnitte in der Beschreibung dieser Ausführungsform oder auch in der Beschreibung insgesamt nicht erwähnt ist. Die fehlende Erwähnung einer bestimmten Ausgestaltung in der Beschreibung oder in einem Ausführungsbeispiel führt indes nicht dazu, dass der Schutzbereich diese Ausgestaltung nicht erfasst.
Aus dem Umstand, dass der Bundesgerichtshof statt der Begriffe „Grundkörperabschnitte“ und „Polabschnitte“ nicht als „milderes Mittel“ die Begriffe „erstes“ und „zweites“ (Stanzelement) ausgetauscht hat, lassen sich entgegen der Auffassung der Beklagten keine Schlussfolgerungen ziehen. Der Bundesgerichtshof hat schon keinen Austausch vorgenommen, sondern im Wege der Auslegung festgestellt, dass der Begriff „Grundkörperabschnitte“ als „Polabschnitte“ zu verstehen ist und umgekehrt. Abgesehen davon haben die Überlegungen des Bundesgerichtshofs ergeben, dass der reine Wortlaut im Hinblick auf genau diese Begriffe verunglückt ist, weshalb sich Überlegungen dazu, ob nicht auch andere Begriffe hätten „ausgetauscht“ werden können, verbieten. Im Rahmen der Auslegung eines Patentanspruchs findet zudem keine Verhältnismäßigkeitsprüfung statt, weshalb schon kein Anlass bestand, ein „milderes Mittel“ in Betracht zu ziehen.
252Abgesehen davon, hätte der von den Beklagten ins Spiel gebrachte „Austausch“ der Begriffe „erstes“ und „zweites“ dazu geführt, dass der Patentanspruch dahin zu lesen ist, dass die Stanzanordnung mit einem „zweiten“ Stanzelement zum Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Grundkörperabschnitte eines jeden Elements, und mit einem „ersten“ Stanzelement zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Polabschnitte eines jeden Elements, versehen ist. Aus der vom Bundesgerichtshof zur Auslegung des erteilten Patentanspruchs 1 herangezogenen, den Patentanspruch erläuternden Patentbeschreibung ergibt sich allerdings, dass sich die Formulierung „zumindest von Teilen“ in Merkmal 2.1 gerade auf die Polabschnitte bezieht. Denn in der Beschreibung ist es als bevorzugte Vorgehensweise dargestellt, mit dem ersten Stanzelement Teile der Polabschnitte, nämlich den allen Polabschnitten gemeinsamen (äußeren) Umriss der Polköpfe, herzustellen (vgl. Abs. [0013], [0030], [0035]; BGH-Urteil „Rotorelemente“ Rn. 19, 21 und 23), wohingegen die Möglichkeit, den Grundkörper mit dem ersten Stanzwerkzeug nur teilweise auszustanzen, in der Patentbeschreibung nicht ausdrücklich erwähnt wird (vgl. BGH-Urteil „Rotorelemente“ Rn. 23). Wie der Bundesgerichtshof in der Entscheidung „Rotorelemente“ im Einzelnen herausgearbeitet hat, sind die Merkmale 2.1 und 2.2 daher unter Berücksichtigung des Gesamtinhalts der Beschreibung – abweichend vom insoweit verunglückten Wortlaut des Anspruchs – dahin zu lesen, dass mit dem ersten Stanzelement zumindest Teile der Polabschnitte eines jeden Elements und mit dem zweiten Stanzelement die Grundkörperabschnitte eines jeden Elements durch Ausstanzen bereitgestellt werden.
Ein anderes Verständnis ist auch nicht deshalb geboten, weil das Bundespatentgericht in seinem ersten – aufgehobenen – Urteil im Nichtigkeitsverfahren möglicherweise von einem Verständnis ausgegangen ist, wonach (zumindest rein begrifflich) ein „Ausstanzen der Grundkörperabschnitte“ nur als ein vollständiges Ausstanzen verstanden werden kann. So heißt es dort noch in Bezug auf die wörtlich verstandene Fassung (BPatG-Urteil I Rn. 24):
254„Der Anspruch 1 stützt sich auf den Anspruch 11 der WO …..220, wobei …. Nach Merkmal 2.1, 2.2 zumindest Teile der Grundkörperabschnitte und die Polabschnitte (insgesamt) ausgestanzt werden, …“
255(Hervorhebungen hinzugefügt)
256Dieser Aspekt wird in der Entscheidung des Bundespatentgerichts bereits nicht näher erörtert und es wird nicht deutlich, ob es sich um das Ergebnis einer Auslegung oder um eine (unzutreffende) Wiedergabe des reinen Wortlauts handelt. Es ist zudem nicht zu erkennen, dass der Bundesgerichtshof dieser Ansicht gefolgt wäre. Dieser gibt die Sichtweise des Bundespatentgerichts zwar in diesem Sinne wieder (vgl. BGH-Urteil „Rotorelemente“ Rn. 11), ohne sie jedoch selbst aufzugreifen. In der eigenen Begründung des Bundesgerichtshofs ist an keiner Stelle von einem Ausstanzen der Grundkörperabschnitte „insgesamt“ die Rede. Auch rügt der Bundesgerichtshof, wenn auch nicht explizit bezogen auf diesen Punkt, dass das Bundespatentgericht eine Auslegung des Patentanspruchs unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen unterlassen hat (BGH-Urteil „Rotorelemente“ Rn. 15).
257Es bedarf vor diesem Hintergrund keiner Erörterung, ob die Ausführungen des Bundespatentgerichts nach der Aufhebung des Urteils noch als fachkundige Stellungnahme im Rahmen der Auslegung herangezogen werden können. Selbst wenn dies der Fall ist, misst der Senat ihnen aus den dargestellten Gründen im Streitfall keine maßgebliche Bedeutung bei.
Der vorgenommenen Auslegung des Merkmals 2.2 steht schließlich nicht entgegen, dass bei einem solchen Verständnis eine im Nichtigkeitsverfahren bereits festgestellte unzulässige Erweiterung vorläge.
Es hat bei der Auslegung des Patentanspruchs außer Betracht zu bleiben, ob diese zu einem Ergebnis führt, bei dem der Patentanspruch eine unzulässige Erweiterung gegenüber den Ursprungsunterlagen enthält. Ebenso wenig wie der Patentanspruch nach Maßgabe dessen ausgelegt werden darf, was sich nach Prüfung des Stands der Technik als patentfähig erweist (BGH, GRUR 2004, 47, 49 – blasenfreie Gummibahn I), darf er nach Maßgabe des Sinngehalts der Ursprungsunterlagen ausgelegt werden (BGH, GRUR 2012, 1124 Rn. 28 – Polymerschaum I). Grundlage der Auslegung ist vielmehr allein die Patentschrift (BGH, GRUR 2012, 1124 Rn. 28 – Polymerschaum I; Senat, Urt. v. 17.10.2019 – I-2 U 11/18; Urt. v. 21.10.2021 – I-2 U 5/21, GRUR-RS 2021, 34296, Rn. 91 – Laufsohle; Urt. v. 25.08.2022 – I-2 U 31/18, GRUR-RS 2022, 21391 Rn. 53 – Faserstrangherstellung).
Ein Abweichen von diesen Grundsätzen ist auch nicht ausnahmsweise deshalb geboten, weil dem Patentanspruch mit der vorgenommenen Auslegung ein Schutzbereich beigemessen würde, hinsichtlich dessen eine unzulässige Erweiterung im Nichtigkeitsverfahren bereits festgestellt wäre.
261Es trifft bereits nicht zu, dass zu einem bestimmten Verständnis des nunmehr geltend gemachten Patentanspruchs eine unzulässige Erweiterung im Nichtigkeitsverfahren festgestellt worden wäre. Von einer unzulässigen Erweiterung ist zwar das Bundespatentgericht in seinem ersten Urteil ausgegangen, das der Bundesgerichtshof mit der Entscheidung „Rotorelemente“ aufgehoben und mit welcher Entscheidung er die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen hat. Nachdem die hiesige Klägerin den Anspruch aber nur noch eingeschränkt verteidigt hat und insoweit die Abweisung der Nichtigkeitsklage nach Zurückweisung der Berufung rechtskräftig geworden ist, ist zu der nunmehr allein maßgeblichen Fassung keinesfalls eine unzulässige Erweiterung festgestellt worden.
262Auch das Argument der Beklagten, eine Reihe neuerer Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (GRUR 2019, 491 Rn. 19 – Schweinwerferbelüftungssystem; GRUR 2021, 945 Rn. 22 – Schnellwechseldorn) und des Senats (GRUR-RR 2021, 258 Rn. 70 f. – Infusionsvorrichtung; Urt. v. 13.07.2023 – I-2 U 79/22, GRUR-RS 2023, 17772 Rn. 60 – Infusionsvorrichtung II) zeigten, dass bei der Anspruchsauslegung die Berücksichtigung von Gesichtspunkten geboten sein könne, die den Rechtsbestand des Patents beträfen und dieser Gedanke müsse auch im Streitfall Anwendung finden, vermag nicht zu überzeugen. Die zitierten Entscheidungen befassen sich mit der Berücksichtigung von in der Patentschrift selbst gewürdigtem Stand der Technik im Rahmen der Auslegung. Es geht nicht um die Vorwegnahme von Rechtsbestandseinwänden im Rahmen der Patentauslegung, sondern einzig und allein darum, aus fachmännischer Sicht diejenige technische Lehre zu identifizieren, für die dem Inhaber das fragliche Patent (mit Bindungswirkung für das Verletzungsgericht) erteilt worden ist (Senat, GRUR-RR 2021, 258 Rn. 71 – Infusionsvorrichtung). Der Schluss, das Vorliegen einer unzulässigen Erweiterung bei einem bestimmten Verständnis des Patentanspruchs sei zu berücksichtigen, lässt sich aus den zitierten Entscheidungen deshalb nicht ziehen.
Die dargestellte Auslegung gilt für den nebengeordneten Verfahrensanspruch (Anspruch 6) grundsätzlich entsprechend (vgl. auch BGH-Urteil „Stanzanordnung in Schenkelpolmaschine“, Rn. 18 f.).
264Soweit die Beklagten in der Berufungsinstanz noch mit Blick auf Anspruch 6 geltend machen, die Merkmale 2.1 und 2.2 gäben mit der Bezeichnung als erstes und zweites Stanzelement eine bestimmte Reihenfolge des Ausstanzens vor, greift dies nicht durch.
Auch wenn nicht grundsätzlich die semantische Reihenfolge der Verfahrensschritte im Text eines Verfahrensanspruchs damit zugleich auch die funktionelle Reihenfolge für die Durchführung der einzelnen Verfahrensschritte vorgibt, kann in der Abfolge der Verfahrensschritte im Wortlaut des Patentanspruchs gleichwohl ein Indiz für die Einhaltung dieser Reihenfolge zu erkennen sein (BGH, GRUR 2015, 159 Rn. 33 – Zugriffsrechte; Urt. v. 09.05.2017 – X ZR 97/15, BeckRS 2017, 118920 Rn. 12 – Bremsbeläge; weitergehend LG Düsseldorf, Urt. v. 28.03.2019 – 4b O 116/17, BeckRS 2019, 17802 Rn. 61, das von einer grundsätzlich vorgegebenen Reihenfolge ausgeht; dem folgend Benkard/Scharen, Patentgesetz, 12. Aufl. 2023, § 14 Rn. 47; siehe ferner BGH, GRUR 2024, 603 Rn. 31 ff. – Happy Bit, wo eine Reihenfolge ohne Prüfung einer Indizwirkung verneint wird). Vor allem aber vermag sowohl der Patentanspruch als Ganzes als auch der technische Zusammenhang, in dem die einzelnen Verfahrensschritte in der Beschreibung des Streitpatents geschildert werden, zu einer Vorgabe für die Abfolge der Verfahrensschritte zu führen. Insoweit kommt es unter anderem darauf an, ob der Patentanspruch zusammen mit der Beschreibung zum Ausdruck bringt, dass für einzelne Verfahrensschritte eine bestimmte, durch andere vorangegangene Verfahrensschritte hervorgebrachte technische Situation vorausgesetzt wird, oder ob aufgrund des Fehlens eines solchen technischen Zusammenhangs einzelne Verfahrensschritte technisch getrennt sowie in zeitlicher Hinsicht unabhängig voneinander und demnach ohne die Einhaltung einer bestimmten Reihenfolge vorgenommen werden können (BGH, Urt. v. 09.05.2017 – X ZR 97/15, BeckRS 2017, 118920 Rn. 12 – Bremsbeläge; vgl. ferner OLG Düsseldorf, Urt. v. 27.03.2024 – I-15 U 13/13, GRUR-RS 2024, 7755 Rn. 46 – Netzwerk-Bedrohungserkennung).
Die danach gebotene Auslegung des Patentanspruchs 6 ergibt, dass bei Durchführung des beanspruchten Verfahrens eine bestimmte Reihenfolge in Bezug auf die Merkmale 2.1 und 2.2 nicht zu beachten ist.
267Es handelt sich bei den Vorgaben der Merkmalsgruppe 2 bereits nicht um Verfahrensschritte, für die eine etwaige Indizwirkung anzunehmen sein könnte. Vielmehr wird – insoweit wortlautgleich zu dem Vorrichtungsanspruch 1 – die Stanzanordnung der bei Durchführung des Verfahrens zu verwendenden Maschine näher beschrieben. Mit dem „ersten“ und dem „zweiten“ Stanzelement werden die Bestandteile der Stanzanordnung festgelegt, ohne dass damit eine Aussage zu der Reihenfolge des Einsatzes der Stanzanordnung im Betrieb beschrieben ist. Entscheidend ist dabei entgegen der Auffassung der Beklagten nicht, ob mit dem Vorrichtungs- und Verfahrensanspruch dieselbe oder eine andere Erfindung beansprucht ist. Maßgeblich ist vielmehr, dass der Verfahrensanspruch an dieser Stelle keinen Verfahrensschritt benennt, sondern die Ausgestaltung der bei dem Verfahren zu verwendenden Maschine beschreibt.
268Zwingende funktionale Gründe für die Beachtung einer bestimmten Reihenfolge sind ebenfalls nicht gegeben. Soweit die Beklagten den Anspruch so verstehen, dass zwingend in einem ersten Schritt nur Teile der Polabschnitte und ebenso zwingend in einem zweiten Schritt die Grundkörperabschnitte vollständig sowie der verbleibende Rest der Polabschnitte ausgestanzt werden, schränken sie den weitergefassten Patentanspruch in unzulässiger Weise auf eine Ausführungsform – die überdies das im Ausführungsbeispiel gezeigte dritte Stanzelement unberücksichtigt lässt – ein.
2694.
270Ausgehend von einem solchen Verständnis ist das Landgericht zutreffend zu dem Ergebnis gelangt, dass die angegriffene Ausführungsform (Stanzmaschine) wortsinngemäß von der technischen Lehre des Patentanspruchs 1 des Klagepatents Gebrauch macht und dass bei Herstellung der angegriffenen Erzeugnisse (Rotorelemente) mit der angegriffenen Ausführungsform zudem Patentanspruch 6 wortsinngemäß verwirklicht wird.
Nach den unangegriffenen Feststellungen des Landgerichts (S. 33 f. LG-Urteil, Bl. 36 f. eA OLG), die der Senat seiner Bewertung nach § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO zugrunde zu legen hat, verfügt die Stanzanordnung der angegriffenen Ausführungsform über folgende Stanzelemente:
272 Ein ortsfest ausgestaltetes Stanzelement, welches den äußeren Umfang der Polabschnitte bereitstellt (in Anlage CBH 10 als „1. Stanzelement 22“ bezeichnet), und
273 ein bewegliches Stanzelement, welches die beiden parallelen Längsseiten des Grundkörperabschnitts stanzt (in Anlage CBH 10 als „2. Stanzelement 32“ bezeichnet).
274Das bewegliche Stanzelement („2. Stanzelement 32“) ist in Vorschubrichtung vor dem ortsfesten Stanzelement („1. Stanzelement 22“) angeordnet.
Die so ausgestaltete angegriffene Ausführungsform macht von allen Merkmalen des Patentanspruchs 1 (Vorrichtungsanspruch), ihr Betrieb von allen Merkmalen des Patentanspruchs 6 (Verfahrensanspruch) wortsinngemäß Gebrauch. Dies gilt insbesondere für die zwischen den Parteien streitigen Merkmale 2.1 und 2.2. Dass die übrigen Merkmale jeweils wortsinngemäß verwirklicht werden, ist zwischen den Parteien zu Recht unstreitig, weshalb sich weitere Ausführungen hierzu erübrigen.
276Die angegriffene Ausführungsform weist eine Stanzanordnung auf, die in Gestalt des in Anlage CBH 10 als „1. Stanzelement 22“ bezeichneten Bauteils mit einem ersten Stanzelement zum Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Polabschnitte eines jeden Elements und in Gestalt des in Anlage CBH 10 als „2. Stanzelement 32“ bezeichneten Bauteils mit einem zweiten Stanzelement zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Grundkörperabschnitte eines jeden Elements versehen ist.
277Dass die Polabschnitte durch das erste Stanzelement der angegriffenen Ausführungsform nicht nur teilweise, sondern vollständig ausgestanzt werden, führt nach der oben dargetanen Auslegung ebenso wenig aus der Verletzung heraus wie der Umstand, dass durch das zweite Stanzelement nur die Seitenkanten der Grundkörperabschnitte ausgestanzt werden. Gleichfalls unschädlich ist es, dass im Betrieb der angegriffenen Ausführungsform zunächst das zweite, zum Ausstanzen der Grundkörperabschnitte ausgebildete Stanzelement und sodann das erste, zum Ausstanzen zumindest von Teilen der Polabschnitte ausgebildete Stanzelement zum Einsatz kommt.
278Schließlich ist es für die Merkmalsverwirklichung unbeachtlich, dass sich die Beklagten darauf berufen, bei der angegriffenen Ausführungsform sei es nur durch eine zusätzliche Drehung (der teilgestanzten Grundkörperabschnitte zusätzlich zur Relativverschiebung gegenüber dem Polstanzelement) technisch möglich, Rotorelemente herzustellen, bei denen die Mittellinie von Grundkörper und die Radien der Oberkanten der Polabschnitte fluchten, obwohl zunächst die Grundkörperabschnitte teilweise und die Polabschnitte nachfolgend vollständig ausgestanzt würden. Eine im Patentanspruch nicht genannte zusätzliche Drehung schließt – was die Beklagten zu Recht auch nicht geltend machen – eine Anspruchsverwirklichung nicht aus.
2795.
280Davon ausgehend hat die Beklagte zu 2) mit der Herstellung der angegriffenen Erzeugnisse mittels der angegriffenen Ausführungsform (Stanzmaschine) im Sinne des § 9 S. 2 Nr. 1 PatG ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist (Patentanspruch 1), gebraucht. Sie hat zudem im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 3 PatG die unmittelbaren Erzeugnisse (Rotorelemente) eines Verfahrens, das Gegenstand des Patents ist (Patentanspruch 6), angeboten und vertrieben. Die Beklagte zu 1) hat im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 1 PatG unmittelbare Verfahrenserzeugnisse angeboten, geliefert und gebraucht, indem sie die ihr von der Beklagten zu 2) gelieferten angegriffenen Erzeugnisse (Rotorelemente) in ihre Windenergieanlagen verbaut und diese angeboten, geliefert und betrieben hat.
281Dass und in welchem Umfang die Beklagten vor diesem Hintergrund zur Auskunftserteilung, Rechnungslegung, zum Schadensersatz, zum Rückruf und zur Vernichtung verpflichtet sind, hat das Landgericht zutreffend ausgeführt. Auf die dortigen Erläuterungen (LG-Urteil S. 34 ff.) wird verwiesen, soweit sich nicht aus den nachfolgenden Ausführungen etwas anderes ergibt:
Soweit die Beklagten ein schuldhaftes Handeln – und damit das Bestehen eines Schadensersatz- und eines diesen vorbereitenden Rechnungslegungsanspruchs – mit der Erwägung in Abrede stellen, sie hätten bis zur Entscheidung „Rotorelemente“ des Bundesgerichtshofs davon ausgehen dürfen, kein rechtsbeständiges Patent zu verletzen, weil der erteilten Anspruchsfassung die unzulässige Erweiterung förmlich auf die Stirn geschrieben gestanden hätte, ist das Landgericht dem zu Recht nicht gefolgt. Auch der in der Berufungsinstanz von den Beklagten weiter vertretene Ansatz, auch nach der Entscheidung „Rotorelemente“ sei ihnen kein Schuldvorwurf zu machen, weil sie nicht mit der Sichtweise des Landgerichts hätten rechnen müssen, greift nicht durch.
Im gewerblichen Rechtsschutz werden an die Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt strenge Anforderungen gestellt (Senat, Urt. v. 30.10.2010 – I-2 U 82/09, BeckRS 2010, 142329 Rn. 42; Urt. v. 17.12.2015 – I-2 U 53/04, BeckRS 2016, 3041 Rn. 151; Benkard-Grabinski/Zülch/Tochtermann, 12. Aufl. 2023, § 139 Rn. 43). Dem Grundsatz nach trägt ein Verletzer das Risiko der Schuldhaftigkeit, welches sich nicht ohne weiteres auf den Schutzrechtsinhaber verschieben lässt. In der Regel ist deshalb die Benutzung einer patentierten und damit geprüften Erfindung auch bei einem Irrtum über deren Rechtsbeständigkeit als schuldhaft anzusehen (vgl. BGH, GRUR 1961, 26 – Grubenschaleisen; GRUR 1977, 250, 253 – Kunststoffhohlprofil; GRUR 1987, 564, 565 – Taxi-Genossenschaft; Senat, Urt. v. 30.10.2010 – I-2 U 82/09, BeckRS 2010, 142329 Rn. 42; Urt. v. 17.12.2015 – I-2 U 53/04, BeckRS 2016, 3041 Rn. 151; OLG München, GRUR-RR 2006, 385, 391 – Kassieranlage). Der Fahrlässigkeitsvorwurf bleibt in einem solchen Fall grundsätzlich bestehen; die Annahme, das Patent sei nicht rechtsbeständig, exkulpiert grundsätzlich nicht. Selbst bei begründeten Bedenken gegen die Rechtsbeständigkeit ist das Patent bis zu seiner Vernichtung oder seinem Widerruf in Kraft und als allgemeinverbindliche Norm zu respektieren (Senat, Urt. v. 30.10.2010 – I-2 U 82/09, BeckRS 2010, 142329 Rn. 42; Urt. v. 17.12.2015 – I-2 U 53/04, BeckRS 2016, 3041 Rn. 151; Benkard/Grabinski/Zülch/Tochtermann, 12. Aufl. 2023, § 139 Rn. 48; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 16. Aufl. 2024, Abschn. D Rn. 780).
284Diese Risikoverteilung gilt im Grundsatz auch dann, wenn das verletzte Patent durch ein nicht rechtskräftiges Nichtigkeitsurteil in erster Instanz für nichtig erklärt worden ist. Einem jeden Nichtigkeitsberufungsverfahren, dessen Sinn und Zweck gerade die Überprüfung des instanzgerichtlichen Urteils ist, wohnt dem Ansatz nach das Risiko einer anderen Beurteilung des Streitstands durch den Bundesgerichtshof inne. Die Erfahrung lehrt immer wieder, dass sogar bei einem scheinbar sehr nahe kommenden Stand der Technik Nichtigkeitsklagen abweichend von der Beurteilung durch das Bundespatentgericht und/oder der Verletzungsgerichte letztinstanzlich beim Bundesgerichtshof keinen Erfolg haben. Die Möglichkeit, dass das verletzte Patent im Nichtigkeitsberufungsverfahren nicht vernichtet wird, ist daher stets ernstlich in Rechnung zu stellen (Senat, Urt. v. 30.10.2010 – I-2 U 82/09, BeckRS 2010, 142329 Rn. 43; Urt. v. 17.12.2015 – I-2 U 53/04, BeckRS 2016, 3041 Rn. 152). Ein Fachunternehmen, das sich trotz noch nicht endgültig geklärter Rechtslage entschließt, von einem Patent Gebrauch zu machen, handelt deshalb grundsätzlich auf eigene Gefahr (Senat, Urt. v. 30.10.2010 – I-2 U 82/09, BeckRS 2010, 142329 Rn. 43; Urt. v. 17.12.2015 – I-2 U 53/04, BeckRS 2016, 3041 Rn. 152; OLG Nürnberg, GRUR 1967, 538, 540 – Laternenflasche; Benkard/Grabinski/Zülch/Tochtermann, 12. Aufl. 2023, § 139 Rn. 48; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 16. Aufl. 2024, Abschn. D Rn. 780).
285Ähnlich verhält es sich bei einem Irrtum über den Schutzumfang des verletzten Patents (Benkard/Grabinski/Zülch/Tochtermann, 12. Aufl. 2023, § 139 Rn. 48). An die Sorgfaltspflicht dessen, dem das Bestehen eines Schutzrechts bekannt ist und der lediglich irrig annimmt, der von ihm hergestellte Gegenstand falle nicht darunter, sind strenge Anforderungen zu stellen (BGH, GRUR 1964, 606, 610 f.; GRUR 1968, 33, 38 – Elektrolackieren; Benkard/Grabinski/Zülch/Tochtermann, 12. Aufl. 2023, § 139 Rn. 48).
286Am Verschulden des Verletzers fehlt es vor diesem Hintergrund nur unter besonderen Umständen, so z.B. dann, wenn bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt mit einer anderen, dem irrig Handelnden ungünstigen Beurteilung durch die Gerichte bzw. den Bundesgerichtshof nicht gerechnet werden brauchte (vgl. BGH, GRUR 1987, 564, 565 – Taxi-Genossenschaft; BGH, GRUR 1990, 474, 476 – Neugeborenentransporte; GRUR 1998, 568, 569 – Beatles-Doppel-CD; GRUR 1999, 49, 51 – Bruce Springsteen and his Band; GRUR 2002, 622, 626 – shell.de; GRUR 2002, 706, 708 – vossius.de; Senat, Urt. v. 30.10.2010 – I-2 U 82/09, BeckRS 2010, 142329 Rn. 45; Urt. v. 17.12.2015 – I-2 U 53/04, BeckRS 2016, 3041 Rn. 154). Das kann der Fall sein, wenn das später als rechtsirrig zu qualifizierende Handeln der bis dahin geltenden höchstrichterlichen gefestigten Rechtsprechung entsprochen hat (Senat, Urt. v. 30.10.2010 – I-2 U 82/09, BeckRS 2010, 142329 Rn. 45; Urt. v. 17.12.2015 – I-2 U 53/04, BeckRS 2016, 3041 Rn. 154; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 16. Aufl. 2024, Abschn. D Rn. 781). Befolgt der Verletzer die bisherige höchstrichterliche Rechtsprechung, so darf er nämlich grundsätzlich auf deren Fortbestand vertrauen; mit einer Änderung braucht er regelmäßig nicht zu rechnen (Senat, Urt. v. 17.12.2015 – I-2 U 53/04, BeckRS 2016, 3041 Rn. 154; Benkard/Grabinski/Zülch/Tochtermann, 12. Aufl. 2023, § 139 Rn. 51). Als entschuldbaren Rechtsirrtum ist es deshalb anzusehen, wenn der Verletzer berechtigterweise auf eine feststehende höchstrichterliche Judikatur vertraut, die sich später ändert (OLG Düsseldorf [20. ZS], GRUR-RR 2002, 23, 25 – Überkleben von Kontrollnummern).
Gemessen an diesen Grundsätzen liegt ein entschuldbarer Rechtsirrtum der Beklagten nicht vor.
288Eine nach den dargestellten Maßstäben erforderliche Ausnahmekonstellation, in der ein Vertrauen auf den fehlenden Rechtsbestand des Klagepatents bis zur Entscheidung „Rotorelemente“ gerechtfertigt gewesen wäre, ist nicht gegeben. Insbesondere stellt die genannte Entscheidung, wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, keine Abkehr von der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung dar. Der Bundesgerichtshof hat in der Entscheidung bereits bekannte Auslegungsgrundsätze zur Anwendung gebracht (vgl. BGH-Urteil „Rotorelemente“, Rn. 16). Das private Rechtsgutachten (Anlage CBH 11), auf das sich die Beklagten insbesondere in erster Instanz berufen haben, datiert erst vom 28.08.2020 und vermag sie schon deshalb nicht zu entlasten.
289Auch die erstinstanzliche Entscheidung des Bundespatentgerichts, in dem dieses das Klagepatent wegen unzulässiger Erweiterung für nichtig erklärt hat, rechtfertigt nach den dargestellten Grundsätzen kein Vertrauen in den fehlenden Rechtsbestand des Klagepatents.
290Ein ab der Entscheidung „Rotorelemente“ gerechtfertigtes Vertrauen darauf, dass die angegriffene Ausführungsform das Klagepatent nicht verletzt, ist ebenfalls nicht zu erkennen. Es lassen sich schon nicht die von den Beklagten aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofs gezogenen Schlussfolgerungen ziehen. Insoweit kann auf die Ausführungen unter 2. b) ee) Bezug genommen werden.
Der von den Beklagten erstmals in der Berufungsinstanz erhobene Unverhältnismäßigkeitseinwand hinsichtlich des Rückruf- und Vernichtungsanspruchs greift nicht durch.
Die Beklagten können mit den zur Begründung ihres Unverhältnismäßigkeitseinwands vorgebrachten tatsächlichen Behauptungen, soweit diese nicht unstreitig sind, in der Berufungsinstanz nicht gehört werden. Dies betrifft konkret die von den insoweit darlegungs- und beweisbelasteten Beklagten (vgl. dazu Senat, GRUR-RR 2007, 259, 261 – Thermocycler) behaupteten Kosten der Anschaffung und Wiederbeschaffung der Stanzvorrichtung sowie der Stanzelemente.
293Es handelt sich dabei, nachdem sich die Klägerin hierzu in der Berufungserwiderung in zulässiger Weise mit Nichtwissen erklärt hat (§ 138 Abs. 4 ZPO), um neues tatsächliches Vorbringen, welches nur unter den Voraussetzungen der §§ 529 Abs. 1 Nr. 2, 531 Abs. 2 S. 1 ZPO berücksichtigungsfähig ist (vgl. auch Senat, GRUR 2023, 394 Rn. 79 f. – Tassenspender). Zu dem Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen haben sich die Beklagten, auch nach dem entsprechenden Hinweis der Klägerin, nicht geäußert.
Eine Unverhältnismäßigkeit der Vernichtung ist auf der Grundlage des berücksichtigungsfähigen Vorbringens nicht festzustellen.
Die Anordnung der Vernichtung hat über die Folgenbeseitigung hinaus eine Art Sanktionscharakter und ist wegen des damit verbundenen Eingriffs in das durch Art. 14 GG geschützte Eigentum in besonderem Maße dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz unterworfen (BGH, GRUR 2006, 504 Rn. 52 – Parfümtestkäufe). Die Frage der Unverhältnismäßigkeit ist deshalb unter umfassender Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beantworten (zum Markenrecht: BGH, GRUR 1997, 899, 901 – Vernichtungsanspruch; GRUR 2013, 1161 Rn. 46 – Hard Rock Cafe; GRUR 2018, 518 Rn. 21 – Curapor, zu § 140a PatG; Senat, Urt. v. 18.03.2021 – I-2 U 18/19, GRUR-RS 2021, 6714 Rn. 101 – Hubsäule). So sind unter Berücksichtigung des generalpräventiven Zwecks der Vorschrift das Vernichtungsinteresse des Patentinhabers und das Erhaltungsinteresse des Verletzers abzuwägen (BGH, GRUR 1997, 899, 901 – Vernichtungsanspruch; GRUR 2019, 518 Rn. 21 – Curapor; OLG Düsseldorf, Urt. v. 29.01.2015 – I-15 U 23/14, GRUR-RS 2015, 06710 Rn. 41 – Andockvorrichtung; Urt. v. 18.03.2021 – I-2 U 18/19, GRUR-RS 2021, 6714 Rn. 101 – Hubsäule; OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2024, 133 Rn. 53 – Druckwellenbehandlung). Im Rahmen der Abwägung sind insbesondere die Schwere des Eingriffs in das Patentrecht, der Umfang des durch die Vernichtung für den Verletzer entstehenden Schadens im Vergleich zu dem durch die Verletzung eingetretenen wirtschaftlichen Schaden des Rechtsinhabers (vgl. BGH, GRUR 1997, 899, 901 – Vernichtungsanspruch; GRUR 2006, 504 Rn. 52 – Parfümtestkäufe) und die Besonderheiten der Beschaffenheit der Ware einzubeziehen. Die Interessen Dritter sind, wie § 140a Abs. 4 S. 2 PatG ausdrücklich normiert, bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit ebenfalls zu berücksichtigen.
296Neben diesen Gesichtspunkten kann auch die Frage von Bedeutung sein, ob im Einzelfall ein milderes Mittel zur Beseitigung der Störung zur Verfügung steht (BGH, GRUR 1997, 899, 901 – Vernichtungsanspruch; GRUR 2019, 518 Rn. 21 – Curapor; Senat, Urt. v. 03.05.2018 – I-2 U 47/17, GRUR-RS 2018, 13140 Rn. 89 – Trinkbehälteranordnung; Urt. v. 30.07.2020 – I-2 U 31/19, GRUR-RS 2020, 45854 Rn. 64 – Hebeschlinge; Urt. v. 18.03.2021 – I-2 U 18/19, GRUR-RS 2021, 6714 Rn. 101 – Hubsäule; GRUR-RR 2021, 15 Rn. 56 – Bodenbelag; OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2024, 133 Rn. 53 – Druckwellenbehandlung).
297Auch der Schutzrechtsablauf kann als abwägungsrelevanter Umstand im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu berücksichtigen sein, wobei sich die Abwägung allerdings an den nach dem Schutzrechtsablauf fortbestehenden gesetzlichen Zielen des Vernichtungsanspruchs zu orientieren hat (OLG Karlsruhe, GRUR 2022, 641 Rn. 229 – Polsterumarbeitungsmaschine; BeckOK Patentrecht/Fricke, 31. Ed. Stand: 15.01.2024, § 140b PatG Rn. 33.1).
Davon ausgehend hält der Senat nach einer Abwägung aller in der Berufungsinstanz noch zu berücksichtigenden Umstände die Vernichtung nicht für unverhältnismäßig.
299Die von den Beklagten angeführte Schuldlosigkeit ihres Handelns greift aus rechtlichen Gründen nicht durch (siehe dazu unter a)) und ist daher auch im Rahmen der Abwägung nicht zu berücksichtigen. Der Ablauf des Schutzrechts ist, auch wenn er den Vernichtungsanspruch hinsichtlich derjenigen Gegenstände, für die er einmal entstanden ist, nicht ohne Weiteres entfallen lässt (vgl. nur Senat, Urt. v. 13.01.2011 – I-2 U 56/09, BeckRS 2011, 7499; Urt. v. 23.11.2017 – I-2 U 81/16, BeckRS 2017, 154820 Rn. 67; BeckOK Patentrecht/Fricke, 31. Ed. Stand: 15.01.2024, § 140b PatG Rn. 33 und 33.1, m.w.N.), zwar als abwägungsrelevanter Umstand in die Betrachtung einzustellen. Auch in Verbindung mit dem Umstand, dass die Klägerin ihr ehemals vorhandenes operatives Geschäft zwischenzeitlich eingestellt hat, lässt er aber die Vernichtung nicht als unverhältnismäßig erscheinen.
Für die von den Beklagten weiter geltend gemachte Unverhältnismäßigkeit des Rückrufs gilt nichts anderes. Die Gefahr eines etwaigen Missverständnisses auf Seiten der Kunden ist der Durchsetzung des Rückrufanspruchs immanent und begründet keine Unverhältnismäßigkeit. Der Rückrufanspruch betrifft überdies in seiner tenorierten Fassung ausschließlich solche Erzeugnisse, die im Zeitpunkt des Beginns der Vollstreckung des Rückrufanspruchs nicht schon in Windkraftanlagen verbaut sind. Auf den entsprechenden Hinweis der Klägerin in der Berufungserwiderung, es sei deshalb davon auszugehen, dass der Anspruch weitgehend leerlaufe, sind die Beklagten nicht mehr eingegangen.
Soweit das Landgericht die Beklagte zu 2) zur Auskunftserteilung auch über von ihr „hergestellte“ Rotorelemente verurteilt hat, hat die Klägerin ihre Klage in zweiter Instanz insoweit mit Zustimmung der Beklagten zurückgenommen (Bl. 564 eA OLG); der Senat hat deshalb die Alternative „hergestellt“ im Tenor zu I. 1. b) (1) des landgerichtlichen Tenors gestrichen. Außerdem hat der Senat – entsprechend dem Berufungsantrag der Klägerin – die bedeutungslosen Worte „insbesondere Elemente“ im Tenor zu I. 1. a) gestrichen.
3026.
303Der Durchsetzbarkeit der Ansprüche der Klägerin steht auch nicht die von den Beklagten in erster Instanz erhobene Einrede der Verjährung (§ 214 Abs. 1 BGB) entgegen. Auf die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts, gegen die sich die Beklagten in der Berufungsinstanz auch nicht mehr gewendet haben, wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen.
Eine Aussetzung der Verhandlung ist nicht veranlasst.
Die Beklagten sind mit dem entsprechenden Vorbringen zwar nicht nach §§ 529, 531 ZPO ausgeschlossen. Es handelt sich bei dem auf die neue Nichtigkeitsklage gestützten Aussetzungsverlangen um ein neues Verteidigungsmittel, das im Berufungsverfahren nur unter den Voraussetzungen der §§ 529 Abs. 1 Nr. 2, 531 Abs. 2 ZPO Berücksichtigung finden kann (vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 16. Aufl. 2024, Abschn. E Rn. 946). Dies schließt insbesondere den zur Begründung des Aussetzungsverlangens geleisteten Sachvortrag ein, selbst wenn die Erhebung der Nichtigkeitsklage an sich – wie hier – unstreitig ist. Die dem Aussetzungsantrag zugrundeliegende Nichtigkeitsklage war jedoch erstinstanzlich noch nicht erhoben und stellt damit ein erst nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung in der Vorinstanz entstandenes Verteidigungsmittel dar, welches gemäß § 531 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ZPO zuzulassen ist (Senat, Urt. v. 21.10.2021 – I-2 U 5/21, GRUR-RS 2021, 34296 Rn. 113 – Laufsohle).
306Das auf die neue Nichtigkeitsklage gestützten Aussetzungsverlangen ist auch nicht nach den allgemeinen Verspätungsregeln der §§ 530, 296 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen. Zwar haben die Beklagten entgegen § 520 Abs. 3 Nr. 4 ZPO ihr neues Vorbringen nicht in der Berufungsbegründung, sondern erstmals im Rahmen der Berufungsreplik vorgetragen. Nachdem aber nicht die Nichtigkeitsklage selbst, sondern das darauf gestützte Aussetzungsverlangen das maßgebliche Verteidigungsmittel ist, waren sie mangels erhobener Nichtigkeitsklage zuvor an der Geltendmachung gehindert und liegt eine im Sinne von § 296 Abs. 1 ZPO ausreichende Entschuldigung vor.
Gleichwohl bietet die durch die Beklagte zu 2) während des Berufungsverfahrens eingereichte Nichtigkeitsklage für eine Aussetzung der Verhandlung keinen Anlass, § 148 ZPO.
Wenn das Klagepatent mit einer Patentnichtigkeitsklage angegriffen ist, verurteilt das Verletzungsgericht, wenn es eine Verletzung des in Kraft stehenden Patents bejaht, grundsätzlich nur dann wegen Patentverletzung, wenn es eine Nichtigerklärung nicht für (überwiegend) wahrscheinlich hält; anderenfalls hat es die Verhandlung des Rechtsstreits nach § 148 ZPO auszusetzen, bis jedenfalls erstinstanzlich über die Nichtigkeitsklage entschieden ist (BGH, GRUR 2014, 1237 Rn. 4 – Kurznachrichten). Denn eine – vorläufig vollstreckbare – Verpflichtung des Beklagten zu Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung sowie Vernichtung patentgemäßer Erzeugnisse ist regelmäßig nicht zu rechtfertigen, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten steht, dass dieser Verurteilung durch die Nichtigerklärung des Klagepatents die Grundlage entzogen werden wird. Der aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) in Verbindung mit den Grundrechten folgende und damit verfassungsrechtlich verbürgte Justizgewährungsanspruch gebietet, dem Verletzungsbeklagten wirkungsvollen Rechtsschutz zur Verfügung zu stellen, wenn er sich gegen den Angriff aus dem Klagepatent mit einem Gegenangriff gegen den Rechtsbestand dieses Patents zur Wehr setzen will. Dies erfordert nicht nur eine effektive Möglichkeit, diesen Angriff selbst durch eine Klage auf Nichtigerklärung bzw. durch Erhebung eines Einspruchs führen zu können, sondern auch eine angemessene Berücksichtigung des Umstands, dass in diesem Angriff auch ein – und ggf. das einzige – Verteidigungsmittel gegen die Inanspruchnahme aus dem Patent liegen kann. Wegen der gesetzlichen Regelung, die für die Ansprüche nach §§ 139 ff. PatG lediglich ein in Kraft stehendes Patent verlangt und für die Beseitigung dieser Rechtsposition nur die in die ausschließliche Zuständigkeit des Patentgerichts fallende Nichtigkeitsklage zur Verfügung stellt, kann der Angriff gegen das Klagepatent anders als in anderen Rechtsordnungen nicht als Einwand im Verletzungsverfahren oder durch Erhebung einer Widerklage auf Nichtigerklärung geführt werden. Dies darf indessen nicht dazu führen, dass diesem Angriff jede Auswirkung auf das Verletzungsverfahren versagt wird. Die Aussetzung des Verletzungsstreits ist vielmehr grundsätzlich, aber auch nur dann geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent dem erhobenen Einspruch bzw. der erhobenen Nichtigkeitsklage nicht standhalten wird (BGH, GRUR 2014, 1237 Rn. 4 – Kurznachrichten; st. Rspr. des Senats, vgl. nur Urt. v. 25.10.2018 – I-2 U 30/16, GRUR-RS 2018, 34555 Rn. 109 – Papierrollensäge).
Wurde das Klagepatent bereits – wie hier – in einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren bestätigt, so hat das Verletzungsgericht grundsätzlich die von der zuständigen Fachinstanz (DPMA, EPA, BPatG) nach technisch sachkundiger Prüfung getroffene Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Klagepatents hinzunehmen. Grund, die parallele Rechtsbestandsentscheidung in Zweifel zu ziehen und von einer Verurteilung vorerst abzusehen, besteht nur dann, wenn das Verletzungsgericht die Argumentation der Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanz für nicht vertretbar hält oder wenn der Angriff auf den Rechtsbestand nunmehr auf (z.B. neue) erfolgversprechende Gesichtspunkte gestützt wird, die die bisher mit der Sache befassten Stellen noch nicht berücksichtigt und beschieden haben (st. Rspr. des Senats, vgl. nur Urt. v. 06.12.2012 – I-2 U 46/12, BeckRS 2013, 13744; Urt. v. 08.04.2021 – I-2 U 13/20, GRUR-RS 2021, 8206 Rn. 78 – Halterahmen II).
310Außerdem liegt hier nicht nur eine erstinstanzliche Rechtsbestandsentscheidung vor. Vielmehr wurde das Klagepatent in der hier geltend gemachten Fassung bereits in einem – über mehrere Instanzen geführten – Nichtigkeitsverfahren rechtskräftig bestätigt. Die Möglichkeit, die Entscheidung über ein Rechtsmittel des Verletzungsbeklagten gegen eine Verurteilung aus einem Patent, das bereits in einem rechtskräftig abgeschlossenen Nichtigkeitsverfahren bestätigt ist, auszusetzen, bis über eine während des Rechtsmittels erhobene neue Nichtigkeitsklage entschieden ist, ist besonders zurückhaltend zu behandeln (OLG Karlsruhe, Urt. v. 22.02.2023 – 6 U 245/21, GRUR-RS 2023, 26668 Rn. 111 – Polsterumarbeitungsmaschine II, m.w.N.). So kommt z.B. nach rechtskräftigem Abschluss eines Nichtigkeitsverfahrens regelmäßig wegen der damit verbundenen erheblichen Verzögerung des Verfahrensabschlusses eine (erneute) Aussetzung eines an sich entscheidungsreifen Verfahrens über eine Nichtzulassungsbeschwerde im Hinblick auf eine nach Abschluss des ersten Nichtigkeitsverfahrens erhobene zweite Nichtigkeitsklage nur dann in Betracht, wenn die Erfolgsaussicht der neuen Nichtigkeitsklage offensichtlich ist (BGH, GRUR 2012, 1072 Rn. 2 – Verdichtungsvorrichtung; Beschl. v. 27.09.2022 – X ZR 30/21, GRUR-RS 2022, 30206 Rn. 9 – Verletzergewinn). Dies gilt unter dem Gesichtspunkt des Interesses des Klägers an einem zeitnahen Abschluss des Verletzungsverfahrens im Wesentlichen auch für die Frage der Aussetzung des Verfahrens über eine Berufung, während deren Anhängigkeit eine neue Nichtigkeitsklage eingereicht worden ist (OLG Karlsruhe, Urt. v. 22.02.2023 – 6 U 245/21, GRUR-RS 2023, 26668 Rn. 111 – Polsterumarbeitungsmaschine II).
Darüber hinaus ist bei der Aussetzungsentscheidung die späte Erhebung der Nichtigkeitsklage zu Lasten der Beklagten zu berücksichtigen (vgl. BGH, GRUR 2012, 93 Rn. 5 – Klimaschrank; Senat, Urt. v. 06.12.2012 – I-2 U 46/12, BeckRS 2013, 13744; Urt. v. 11.06.2015 – I-2 U 64/14, GRUR-RS 2015, 18679 Rn. 75 – Verbindungsstück; Schlussurt. v. 21.10.2021 – I-2 U 5/21, GRUR-RS 2021, 34296 Rn. 114 f. – Laufsohle; OLG Karlsruhe Urt. v. 22.2.2023 – 6 U 245/21, GRUR-RS 2023, 26668 Rn. 113 – Polsterumarbeitungsmaschine II; OLG München, Urt. v. 02.02.2017 – 6 U 2748/15, BeckRS 2017, 126447 Rn. 49).
312Eine verzögerte Erhebung der Nichtigkeitsklage führt zu einer deutlich späteren Entscheidung des Bundespatentgerichts, wodurch sich bei einer Aussetzung auch das Verletzungsverfahren entsprechend verlängert. Auch im Fall seines erstinstanzlichen Obsiegens ist die Aussetzung für einen Verletzungskläger mit Nachteilen verbunden, da er die Zwangsvollstreckung auch weiterhin nur gegen Sicherheitsleistung betreiben kann und dem aus § 717 Abs. 2 ZPO erwachsenden Schadensersatzrisiko unterliegt. Daher ist es an dem jeweiligen Verletzungsbeklagten, beizeiten klare Verhältnisse zu schaffen. Verlässt er sich erstinstanzlich auf die Argumentation zur vermeintlichen Nichtverletzung und entscheidet sich erst in zweiter Instanz zu einem Angriff auf den Rechtsbestand des Klagepatents, ist dem durch eine restriktive Aussetzungspraxis Rechnung zu tragen. Eine Aussetzung kommt in einem solchen Fall nur dann in Betracht, wenn es in hohem Maße wahrscheinlich erscheint, dass das Klagepatent aufgrund der Nichtigkeitsklage widerrufen oder vernichtet wird (Senat, Schlussurt. v. 21.10.2021 – I-2 U 5/21, GRUR-RS 2021, 34296 Rn. 114 f. – Laufsohle). Eine Aussetzung wird regelmäßig vor allem dann nicht veranlasst sein, wenn der Verletzungsbeklagte den Einspruch oder die Nichtigkeitsklage erst so kurzfristig vor dem Haupttermin im Verletzungsprozess erhebt, dass dem Patentinhaber eine angemessene Erwiderung auf das Einspruchs-oder Nichtigkeitsvorbringen nicht mehr möglich ist (OLG Düsseldorf, Urt. v. 06.12.2012 – I-2 U 46/12, BeckRS 2013, 13744; siehe auch Urt. v. 16.07.2020 – I-15 U 38/18, GRUR-RS 2020, 52063 Rn. 107 – Schnellwechseldorn).
313Der Anwendung eines in diesem Sinne verschärften Maßstabs steht auch nicht entgegen, dass aus der Sicht der Beklagten die neue Nichtigkeitsklage erst nach Kenntnis des landgerichtlichen Urteils und dessen Begründung veranlasst gewesen sein mag. Denn den Beklagten musste bereits mit Durchführung des selbstständigen Beweisverfahrens, spätestens aber mit der Klageerhebung bewusst gewesen sein, dass das Risiko einer entsprechenden Verurteilung und einer von ihrer Rechtsauffassung abweichenden Sichtweise des Landgerichts bestand. Dass sie sich gleichwohl zu einem Zuwarten bis nach dem erstinstanzlichen Urteil und sogar bis zu ihrer Berufungsreplik entschieden haben, geht – wie ausgeführt – zu ihren Lasten.
Demgegenüber erfährt der Maßstab entgegen der Ansicht der Beklagten keine grundlegenden Abweichungen dadurch, dass die Klägerin aus dem erstinstanzlichen Urteil bereits über ein vorläufig vollstreckbares Urteil verfügt. Zwar unterliegt die Aussetzung der Verhandlung etwas weniger strengen Anforderungen, wenn der Patentinhaber bereits über einen Titel verfügt und daraus vollstrecken kann (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2002, 369, 377 – Haubenstretchautomat; Urt. v. 25.01.2008 – I-2 U 66/01, BeckRS 2008, 142644 Rn. 30; Urt. v. 16.07.2020 – I-15 U 38/18, GRUR-RS 2020, 52063 Rn. 106 – Schnellwechseldorn). Auch in einem solchen Fall genügt es jedoch schon im Grundsatz nicht, wenn die Vernichtung des Klagepatents möglich ist; sie muss auch hier wahrscheinlich sein (Senat, GRUR-RR 2007, 259, 262 – Thermocyler). Dass den in dem über vier Instanzen geführten ersten Nichtigkeitsverfahren ergangenen Entscheidungen technisch fachkundiger Spruchkörper ein geringeres Gewicht beizumessen wäre, folgt aus dem Vorliegen eines vollstreckbaren Titels ebenfalls nicht.
Davon ausgehend bietet der durch die Beklagten zur Begründung ihres Aussetzungsantrages aufgeführte Einwand gegen den Rechtsbestand für eine Aussetzung der Verhandlung keinen Anlass.
316Die Beklagte zu 2) stützt die weitere Nichtigkeitsklage nach dem hierzu in der Berufungsinstanz geleisteten Vorbringen auf den Nichtigkeitsgrund einer unzulässigen Erweiterung, der bereits Gegenstand der ersten – aufgehobenen – Entscheidung des Bundespatentgerichts und der auf die diesbezügliche Berufung ergangenen Entscheidung „Rotorelemente“ war. Dass die unzulässige Erweiterung nach der Zurückweisung an das Bundespatentgericht und der Einschränkung der geltend gemachten Patentansprüche nicht erneut diskutiert wurde, lag in der bereits herbeigeführten Klärung dieser Frage begründet. Über die nach der Zurückverweisung an das Bundespatentgericht geltend gemachte eingeschränkte Fassung des Klagepatents liegt eine rechtskräftige Entscheidung vor, der gegenüber neuer Stand der Technik nicht vorgebracht wird.
317Es entsteht auch kein Widerspruch zu der vorgenommenen Auslegung des Klagepatents, weil, wie unter 2. b) ee) erörtert, ein Widerspruch zwischen den Erwägungen des Bundesgerichtshofs und der hier vertretenen Auslegung nicht besteht.
318Der Umstand, dass es hier „nur“ um die Vollstreckung des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs sowie des Vernichtungs- und Rückrufanspruchs geht, vermag schließlich unter den hier gegebenen Umständen keine anderweitige Aussetzungsentscheidung zu rechtfertigen. Das gilt umso mehr, als der Kläger nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs selbst dann, wenn im Falle des Erlöschens des Klagepatents durch Zeitablauf die Verurteilung zur Auskunft und Rechnungslegung bereits vollstreckt ist, ein schutzwürdiges Interesse an einer zeitnahen Entscheidung des Verletzungsprozesses hat, das einer Aussetzung entgegensteht (BGH, Beschl. v. 27.09.2022 – X ZR 30/21, GRUR-RS 2022, 30206 Rn. 13 f. – Verletzergewinn).
Die Anschlussberufung der Klägerin ist zulässig, bleibt in der Sache aber ebenfalls ohne Erfolg.
Das in der Berufungserwiderung vorgebrachte Begehren der Klägerin nach einer Korrektur der erstinstanzlichen Kostenentscheidung ist, weil es bei einer sogenannten gemischten Kostenentscheidung zur Anfechtung ihres „hauptsachelosen“ Teils einer solchen bedarf (Musielak/Voit/Ball, 21. Aufl. 2024, § 524 Rn. 9; BeckOK ZPO/Wulf, 52. Ed. Stand: 01.03.2024, § 524 Rn. 8; insoweit auch MüKo ZPO/Rimmelspacher, 6. Aufl. 2020, § 524 Rn. 18), als Anschlussberufung auszulegen.
321Die nicht ausdrückliche Bezeichnung als Anschlussberufung steht ihrer wirksamen Einlegung nicht entgegen. Für die Einlegung eines Anschlussrechtsmittels ist nicht die ausdrückliche Erklärung erforderlich, es werde Anschlussberufung bzw. Anschlussrevision eingelegt. Vielmehr genügt jede Erklärung, die sich ihrem Sinn nach als Begehren auf Abänderung des Urteils erster Instanz darstellt (BGH, GRUR 2012, 180 Rn. 26 – Werbegeschenke; vgl. ferner BGH, GRUR 2012, 954 Rn. 25 – Europa-Apotheke Budapest; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2006, 118, 120 – Drehschwingungstilger; GRUR 2015, 299 Rn. 41 – Kupplungsvorrichtung; GRUR 2018, 1037 Rn. 113 – Flammpunktprüfungsvorrichtung).
322Die Anschlussberufung ist auch im Übrigen zulässig, insbesondere innerhalb der in § 524 Abs. 2 S. 2 ZPO genannten Frist eingelegt worden.
In der Sache bleibt die Anschlussberufung ohne Erfolg.
324Es ist nicht zu beanstanden, dass das Landgericht den in der mündlichen Verhandlung zurückgenommenen Klageantrag zu I. 1. b) (2), mit dem die Klägerin ihren Auskunftsanspruch hinsichtlich einer unmittelbaren Verletzung des Verfahrensanspruchs 6 durch Anwendung des geschützten Verfahrens zwischen dem 02.05.2007 und dem 20.03.2001 geltend gemacht hat, mit einem Streitwertanteil von 50.000,- EUR – einem Drittel des auf die gegen die Beklagte zu 2) gerichtete Klage entfallenden Werts – bemessen hat.
325Bei dem zurückgenommenen Antrag handelt es sich um einen von drei gegenüber der Beklagten zu 2) geltend gemachten Auskunftsansprüchen, auf den auch der Schadensersatz- und der diesen vorbereitende Rechnungslegungsantrag rückbezogen waren. In der Klageschrift finden sich zur wirtschaftlichen Bedeutung dieses Antrags aus der für die Streitwertfestsetzung entscheidenden Sicht der Klägerin keine Erläuterungen, weshalb gegen die vom Landgericht vorgenommene gleichmäßige Aufteilung des Streitwerts zwischen den die unterschiedlichen Verletzungshandlungen betreffenden Anträgen keine Bedenken bestehen. Auch der Umstand, dass der Rückruf- und der Vernichtungsantrag naturgemäß nicht auf die Anwendung des Verfahrens rückbezogen waren, lässt die Beurteilung des Landgerichts nicht als unzutreffend erscheinen. Bezogen auf die Anwendung des Verfahrens konnten bei einer objektiven Betrachtung andere wirtschaftliche Erwägungen, etwa mit Blick auf die mögliche Schadensberechnung, im Vordergrund gestanden haben, die die Klägerin veranlasst haben könnten, den Antrag in dieser Form zu stellen. Selbst wenn es zutreffen sollte, dass – wie die Klägerin nunmehr erläutert – keine Konstellation ersichtlich ist, in der die Beklagte zu 2) das Verfahren hätte anwenden können, ohne die unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse herzustellen bzw. die Vorrichtungen zu gebrauchen, ändert dies nichts daran, dass sich diese Erwägungen bezogen auf den allein entscheidenden Zeitpunkt bei Eingang der Klageschrift (vgl. § 40 GKG) nicht anstellen ließen und die vom Landgericht vorgenommene (pauschale) Aufteilung schon aus diesem Grund nicht zu beanstanden ist.
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92 Abs. 2 Nr. 1, 97 Abs. 1, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO.
327Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.
328Für eine Zulassung der Revision bestand keine Veranlassung, weil die in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen dafür ersichtlich nicht gegeben sind. Es handelt sich um eine reine Einzelfallentscheidung ohne grundsätzliche Bedeutung, mit der der Bundesgerichtshof auch nicht im Interesse einer Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung befasst werden muss (§ 543 Abs. 2 ZPO). Es besteht insbesondere kein Widerspruch zu der Sichtweise des Bundesgerichtshofs in den im Nichtigkeitsverfahren ergangenen Entscheidungen, weshalb insbesondere dieser Umstand keine Zulassung der Revision gebietet.