 Seite drucken
Seite drucken
 Entscheidung als PDF runterladen
Entscheidung als PDF runterladen
 Seite drucken
Seite drucken
 Entscheidung als PDF runterladen
Entscheidung als PDF runterladen

I. Die Beklagte wird verurteilt,
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000 – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Fall wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihren Geschäftsführern zu vollstrecken ist, zu unterlassen,
Spannungsregler, umfassend
eine Schaltmodusreglerschaltung zum Erzeugen einer geregelten Spannung mit Reihen- und Nebenschaltelementen; und eine Spannungsspitzenschutzschaltung, die über die Reihen- und Nebenschaltelemente hinweg an dem Eingang der Schaltmodusreglerschaltung zum Spannungsspitzenschützen der Schaltmodusreglerschaltung angeordnet ist, ein dissipatives Element (Rsp) und eine Ladungsspeicherschaltung (Csp) umfassend;
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, wenn die Schaltmodusreglerschaltung und die Spannungsspitzenschaltung durch eine integrierte Schaltung in einer integrierten Schaltungseinheit implementiert sind; die Reihen- und Nebenschaltelemente der Schaltmodusreglerschaltung in verbundene Schaltblocksegmente unterteilt sind; und die Ladungsspeicherschaltung (Csp) der Spannungsspitzenschutzschaltung in verbundene Ladungsspeicherschaltungssegmente unterteilt ist, die zwischen den Schaltblocksegmenten verschachtelt sind;
2. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie (die Beklagte) die zu Ziffer 1 bezeichneten Handlungen seit dem 5. März 2020 begangen hat, und zwar unter Angabe
a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die Erzeugnisse bezahlt wurden,
wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürfte Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
3. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagte) die zu Ziffer 1 bezeichneten Handlungen seit dem 5. März 2020 begangen hat, und zwar unter Angabe
a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, - preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,
b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, - preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger
c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Webeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei es der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.
4. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer 1 bezeichneten Handlungen seit dem 5. März 2020 entstanden ist und noch entstehen wird.
5. Die Beklagte wird verurteilt, die unter Ziffer 1 bezeichneten, im Besitz Dritter befindlichen und seit dem 5. März 2020 auf den Markt gebrachten Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des deutschen Teils des Klagepatents EP A(= DE B) erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird, und endgültig zu entfernen, indem die Beklagte diese Erzeugnisse wieder an sich nimmt oder die Vernichtung derselben beim jeweiligen Besitzer veranlasst.
6. Die Beklagte wird verurteilt, in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindliche, in Ziffer 1 bezeichnete Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten – Kosten herauszugeben.
II. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten auferlegt.
III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung hinsichtlich des Tenors zu I.1. in Höhe von X, hinsichtlich des Tenors zu I.2. und 3. in Höhe von 500.000,- Euro, hinsichtlich des Tenors zu I.5. und I.6. jeweils in Höhe von 2.000.000,- Euro und hinsichtlich des Tenors zu II. in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. Die Sicherheit kann auch durch eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Europäischen Union als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder Sparkasse erbracht werden.
Tatbestand
2Die Klägerin verfolgt aus Patentrecht gegen die Beklagte Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung, Rückruf und Vernichtung sowie Feststellung der Schadensersatzverpflichtung dem Grunde nach.
3Die Klägerin ist alleinverfügungsberechtigte und eingetragene Inhaberin des Patents EP A(Anlage ES 3a, im Folgenden: Klagepatent). Das Klagepatent wurde am 21. Dezember 2010 in englischer Verfahrenssprache angemeldet und beansprucht eine Priorität der US C vom 23. Dezember 2009. Die Anmeldung wurde am 19. September 2018 offengelegt und der Hinweis auf die Patenterteilung am 5. Februar 2020. Das Klagepatent steht auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Über die seitens der D am 3. April 2023 erhobene Nichtigkeitsklage (vgl. Anlagenkonvolut B7) ist bislang keine Entscheidung ergangen. Mit Beschluss vom 29. November 2023 hat das BPatG in seinem gerichtlichen Hinweis gem. § 83 Abs. 1 PatG mitgeteilt, dass die Nichtigkeitsklage nach derzeitigem Stand keine Aussicht auf Erfolg haben dürfte. Wegen der Einzelheiten zur Begründung wird auf den Beschluss des BPatG verwiesen.
4Das Klagepatent betrifft Überspannungsschutz für einen Schaltwandler.
5In englischer Verfahrenssprache heißt es in Anspruch 1:
6„A voltage regulator (300) comprising: switched mode regulator circuitry (301, 302, 304, 306) to generate a regulated voltage (Vout), having series and shunt switching elements (301, 302); and voltage spike protection circuitry (303), arranged across the series and shunt switching elements at the input to the switched mode regulator circuitry for voltage-spike-protecting the switched mode regulator circuitry, comprising a dissipative element (RSP) and a charge-storage circuit (Csp ); characterised in that: said switched mode regulator circuitry (301, 302, 304, 306) and said voltage spike circuitry (303) are implemented by an integrated circuit (1930) in an integrated circuit package (1940); said series and shunt switching elements (301, 302) of said switched mode regulator circuitry are subdivided into connected switching block segments (2120, 2130, 2140); and said charge-storage circuit (Csp) of said voltage-spike protection circuitry is subdivided into connected charge-storage circuit segments (2121, 2122) which are interleaved between said switching block segments.“
7Anspruch 1 des Klagepatents lautet in deutscher Übersetzung:
8„Spannungsregler (300), Folgendes umfassend: eine Schaltmodusreglerschaltung (301, 302, 304, 306) zum Erzeugen einer geregelten Spannung (Vout) mit Reihen- und Nebenschaltelementen (301, 302); und eine Spannungsspitzenschutzschaltung (303), die über die Reihen- und Nebenschaltelemente hinweg an dem Eingang der Schaltmodusreglerschaltung zum Spannungsspitzenschützen der Schaltmodusreglerschaltung angeordnet ist, ein dissipatives Element (Rsp) und eine Ladungsspeicherschaltung (Csp) umfassend; dadurch gekennzeichnet, dass: die Schaltmodusreglerschaltung (301, 302, 304, 306) und die Spannungsspitzenschaltung (303) durch eine integrierte Schaltung (1930) in einer integrierten Schaltungseinheit (1940) implementiert sind; die Reihen- und Nebenschaltelemente (301, 302) der Schaltmodusreglerschaltung in verbundene Schaltblocksegmente (2120, 2130, 2140) unterteilt sind; und die Ladungsspeicherschaltung (Csp) der Spannungsspitzenschutzschaltung in verbundene Ladungsspeicherschaltungssegmente (2121, 2122) unterteilt ist, die zwischen den Schaltblocksegmenten verschachtelt sind.“
9Wegen des Inhalts der „insbesondere“-geltend gemachten Unteransprüche 2, 8 sowie 11 bis 13 wird auf die Klagepatentschrift verwiesen.
10Folgende Figuren sind der Klagepatentschrift zur Veranschaulichung der klagepatentgemäßen Lehre entnommen. Die Figur 10 zeigt ein Beispiel eines Schaltmodusspannungsreglers:
11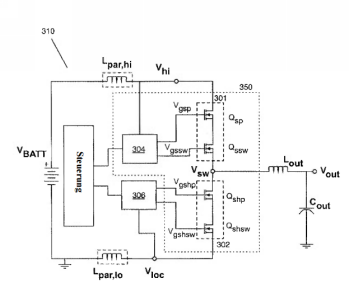
Die Figur 20 zeigt eine in vier Abschnitte unterteilte Schalter-Schaltung, eine Spitzenschutzschaltung und ein Beispiel für die resultierende Dämpfung des Überschwingungszustands und die Figur 21 zeigt ein Beispiel für die in Reihe von Segmenten unterteilte Schalter-Schaltung und Schutzschaltsegmente, die jedem Schalter-Schaltungssegment zugeordnet sind:
13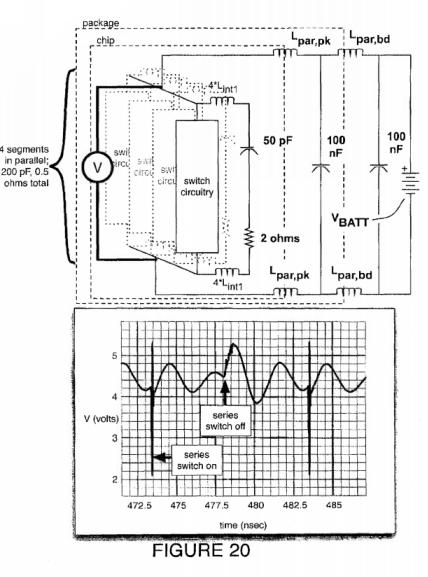
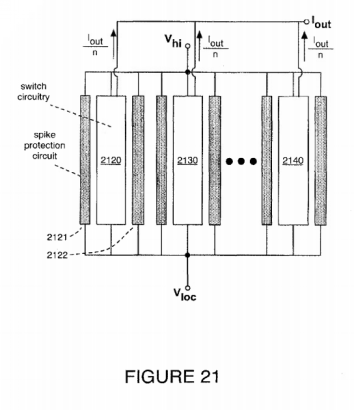
Bei der Klägerin handelt es sich um eine im Jahr 2008 gegründete Gesellschaft im Privatbesitz, die im Bereich der Hochfrequenz-Halbleitertechnologie für das Power-Management tätig ist. Sie investiert in Forschung und Entwicklungen auf diesem Feld.
16Die Beklagte gehört zur E-Unternehmensgruppe. Die E Inc. (bis 1. November 2015 F) ist einer der größten US-amerikanischen PC- und Druckerhersteller, registriert in X, und mit der Unternehmenszentrale in X(Anlagen ES 2a, ES 2b). Die Beklagte ist die deutsche Vertriebstochter der E Gruppe mit Sitz in X und betreibt die deutschsprachige Website der Unternehmensgruppe, abrufbar unter X. Auf dieser Homepage bietet die Beklagte insbesondere Desktop-PCs, Laptops und Server an, die mit von D hergestellten Mikroprozessoren (im nachfolgenden auch: angegriffene Ausführungsform(en)) ausgestattet sind.
17X ist D interne Bezeichnung für einige der 10. Generation der D Core Prozessoren und der 3. Generation der X Scalable Serverprozessoren. Bei mobilen Endgeräten (z.B. Laptops) werden die Prozessoren als „10th Generation X“ bezeichnet. D verwendet für die Bezeichnung seiner Mikroprozessoren durchgängig bestimmte Codenamen (vgl. Anlage ES 4a). Neben X Prozessoren sind vorliegend insbesondere X und X von Relevanz.
18Bei der Beklagten sind X Mobil-Prozessoren beispielsweise im Laptop „E X“ und „E X Laptop-PC mit FreeDOS“ enthalten (vgl. Anlage ES 4f). XProzessoren sind verbaut in Produkten wie „E X Chromebook Laptop Enterprise Laptop-PC“ und „E X“ (Anlage ES 4g), XProzessoren in dem X Laptop und E X“ (Anlage ES 4h). Die (verbauten) Prozessoren sind mit der so genannten X-Technologie („X“; nachfolgend auch: X) ausgestattet.
19Die Prozessbevollmächtigten der Klägerin haben unter dem 16. November 2021 einen Online-Testkauf durchgeführt und den Laptop „X mit FreeDOS“ (Anlage ES 4k) erworben. Der Laptop ist mit einem D X Prozessor, also einem D XProzessor ausgestattet.
20Beispielhaft hat die Klägerin die 2021-Modelle X Prozessor "D X" sowie den XServer (X) Prozessor "D X" einer näheren Analyse durch die beiden Fachunternehmen TechInsights und LTEC unterzogen (vgl. Anlagen ES 5a, 5b). Die Beklagte hat als Anlage B 4 ein Gutachten von Prof. G von der TU München zu den technischen Hintergründen sowie als Anlage B 23 sowie B 26 Gutachten von Herrn H von der Universität Twente (Niederlande) mit Erläuterungen technischer Fachtermini sowie von auf Modellen basierenden Simulationen vorgelegt.
21Die Klägerin verfolgt das gleiche Patent in weiteren Verletzungsverfahren vor der Kammer und geht gegen die Unternehmen X, D sowie F vor (Az. 4c O 58/22, 4c O 60/22 und 4c O 61/22).
22Die Klägerin ist der Ansicht, dass die Klage vollumfänglich begründet sei. Die angegriffenen Ausführungsformen würden wortsinngemäßen unmittelbaren Gebrauch von der Lehre des Klagepatents machen.
23Die Klägerin behauptet, dass die in den angegriffenen Ausführungsformen enthaltenen Mikroprozessoren von D eine Anzahl integrierter Spannungsreglerschaltungen aufweisen würden. Es seien Schaltmodus-Abwärtswandler zur Spannungsverringerung. Die X-Schaltungen würden jeweils für die Versorgung bestimmter Abschnitte des Mikroprozessors mit der jeweils benötigten elektrischen Leistung (Spannung, Strom) eingesetzt. Den Aufbau der angegriffenen Ausführungsformen habe die Klägerin von den Unternehmen TechInsights und LTEC untersuchen lassen und diese Erkenntnisse zur Grundlage ihrer Verletzungsargumentation gemacht. Die Ergebnisse des TechInsights-Gutachtens würden nicht durch die versehentliche Falschbezeichnung des tatsächlich untersuchten Prozessors „X“ geschmälert. Dieser Fehler sei behoben worden, was auch den Austausch einiger Abbildungen sowie deren Neubezeichnung („ItemID“) erforderlich gemacht habe. Der inhaltliche Aussagegehalt der Untersuchungen sei dadurch nicht berührt worden.
24Die in diesem Zuge identifizierten integrierten MIM-Kondensatoren, bezeichnet als X und X, welche auch als Entkopplungskondensatoren für hohe Frequenzbereiche bezeichnet würden, seien eine erfindungsgemäße Ladungsspeicherschaltung, da sie in den angegriffenen Ausführungsformen für eine Dämpfung von Spannungsspitzen sorgen würden. Das Klagepatent verlange nämlich für eine erfindungsgemäße Spannungsspitzenschutzschaltung, dass sie durch parasitäre Induktivitäten entstandene, zu hohe Spannungen beseitige. Hierzu fordere das Klagepatent weiter, dass die Schutzschaltung am Eingang der Schaltmodusreglerschaltung angeordnet sei, und zwar zwischen den Potentialknoten Vhi und Vloc. So werde gewährleistet, dass die Schutzschaltung die parasitären Induktivitäten effektiv auffangen könne, bevor diese Eingang in die Schaltelemente fänden. Sie solle am Eingang parallelgeschaltet und damit in unmittelbarer Nähe der Schaltmodusreglerschaltung angeordnet sein. Andere Anforderungen in physischer Hinsicht zur Anordnung der Schutzschaltung im Verhältnis zur Schaltmodusreglerschaltung würde das Klagepatent nicht aufstellen. Die Entkopplungskondensatoren seien entsprechend angeordnet und würden zu einer Dämpfung von Spannungen führen, sodass zulässige Höchstwerte nicht überschritten würden. Die seitens der Klägerin angestellten Messungen würden den wirksamen Spannungsschutz belegen. Die MIM-Kondensatoren würden, so behauptet die Klägerin, Spannungsspitzen von 4,2 bis 4,4 V verhindern. Die zugrunde liegende Dimensionierung betrage für X: R = 14,1 Ω und C = 161 pF sowie für X: R = 1,2 Ω und C = 282,5 pF. Diese Messergebnisse würden auf Simulationen beruhen, welche die tatsächliche Anordnung der einzelnen Funktionseinheiten auf dem Chip berücksichtigen würden. Allein mittels eines fachmännischen Chip-Designs würden sich die Spannungsspitzen jedenfalls nicht vermeiden lassen.
25Die eigenen Messungen und Berechnungen der Beklagten zu in den angegriffenen Ausführungsformen vorkommenden Spannungswerten würden allenfalls die Eignung der Entkopplungskondensatoren für die ihnen ursprünglich zugedachte Funktion nachweisen, könnten aber den Vortrag der Klägerin nicht entkräften. Die Bezugnahme auf VBD-Werte sei unbehilflich, da dieser Wert die Gate-Spannung der Transistoren, zur Steuerung des Transistors selbst betreffe, nicht aber den in den Stromkanal geleiteten Strom. Ferner ziele dieser Wert auf die Zerstörung des Transistors ab, auf die es dem Klagepatent aber gar nicht ankomme. Soweit die Beklagte außerdem auf eine Zeitkonstante Bezug nehme und diese in Beziehung zu den in den Untersuchungen der Klägerin eingesetzten Werten bringe, stehe dies dem Verletzungsargument der Klägerin nicht entgegen, da es auf eine Reaktionszeit der Kondensatoren allenfalls in ihrer Funktion als Entkopplungskondensatoren ankomme, nicht jedoch beim Spannungsspitzenschutz.
26Das G-Gutachten der Beklagten könne zu keinem anderen Ergebnis führen. Auch bei dessen Berücksichtigung sei die Möglichkeit, dass die Entkopplungskondensatoren als Schutzschaltung fungieren würden, nicht ausgeschlossen. Die insoweit angestellte Vergleichsschaltung des Gutachters sei für Rückschlüsse ungeeignet, da sie keine Ausgangsspule aufweise. Ferner bezögen sich die Erkenntnisse auf die Ausgangsspannung Vout, wohingegen das Klagepatent die Eingangsspannung in den Blick nehme.
27Es verbleibe bei den Messergebnissen der Klägerin, wonach ohne die Kondensatoren die Spannungen deutlich oberhalb von 2 V lägen. Bei diesem Ergebnis verbleibe es auch nach dem weiteren zur Akte gereichten H-Gutachten der Beklagten. Diese Ausführungen seien schon verspätet, da sie erst mit der Duplik eingereicht worden seien und daher unberücksichtigt zu lassen. Das gelte umso mehr für die korrigierte Duplik, da der Beklagten der Fehler hätte früher auffallen müssen. Auch inhaltlich weise das Vorgehen methodische Mängel auf und könne einer Verletzung des Klagepatents daher nicht entgegenstehen. Insbesondere sei nicht nachvollziehbar, wie die hier relevanten Kondensatoren in den Messungen berücksichtigt worden sein sollten, zumal in der händisch korrigierten Fassung des Schaltmodells allenfalls Unterschiede hinsichtlich des vormaligen Kondensators X (auch bezeichnet als X) zu erkennen seien und nicht hinsichtlich der neuen Kondensatoren X und X.
28Die MIM-Kondensatoren seien auch in anspruchsgemäße Segmente unterteilt. Es handele sich nicht um einen einzigen zusammenhängenden Kondensator. Jedes Segment der Kondensatoren sei in räumlicher und funktionaler Nähe zu den Schaltblocksegmenten angeordnet. Dies werde für die angegriffenen Ausführungsformen bei einer Draufsicht belegt. Die Transistoren befänden sich in einer deutlich unterhalb der Ebene der Kondensatoren angeordneten Schicht und seien über parallele, vertikal verlaufende Vias miteinander verbunden. Die Schutzelemente lägen außerdem in horizontaler Richtung in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Schaltelementen. In vertikaler Richtung lägen zwischen ihnen die vertikal verlaufenden Vias, die lediglich den Abstand zwischen der Ebene der Transistoren und der MIM-Ebene überwinden müssten und die aus (vergleichsweise) dickem Metall bestünden und in so großer Anzahl vorhanden seien, dass die Verbindung eine sehr geringe, im Prinzip vernachlässigbare Induktivität aufweise. Dies stelle eine denkbar kurze Verbindung der Komponenten dar. Es bestehe deshalb auch eine anspruchsgemäße Verschachtelung.
29Die Klägerin vertritt die Ansicht, dass der Einwand der Unverhältnismäßigkeit sowohl in Bezug auf den Unterlassungsanspruch wie auch mit Blick auf Rückruf und Vernichtung unbegründet sei.
30Der Rechtsstreit sei schließlich auch nicht auszusetzen, weil sich das Klagepatent im Nichtigkeitsverfahren als rechtsbeständig erweisen werde.
31Die Klägerin beantragt,
32zu erkennen, wie geschehen.
33Die Beklagte beantragt,
34die Klage abzuweisen,
35hilfsweise den Rechtsstreit gemäß § 148 ZPO bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung im dem den deutschen Teil des europäischen Patents EP Abetreffenden Nichtigkeitsverfahren auszusetzen,
36weiter hilfsweise, den Beklagten zu gestatten, die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung, die auch in Form einer Bankbürgschaft erbracht werden kann, ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin abzuwenden.
37Sie ist der Auffassung, dass die angegriffenen Ausführungsformen die Lehre des Klagepatents nicht gebrauchen würden.
38Die mit der Klage zur Akte gereichten Untersuchungen würden schon einen Widerspruch aufweisen, da aus dem Titel der angeblich untersuchte Prozessor „X“ hervorgehe, der aber, was unstreitig ist, nicht den untersuchten XProzessor bezeichne. Diese Unstimmigkeit sei mit der Replik nicht behoben worden, weil nunmehr andere Abbildungen und Bezeichnungen dieser als in dem ersten Bericht festzustellen seien.
39Das Klagepatent verstehe unter einer Spannungsspitze eine maximale Obergrenze, ab der es zu einer Zerstörung des Chips komme. Der konkrete Wert der Spannungsspitze variiere von Produkt zu Produkt. Die Zuverlässigkeit des Chips müsse gewahrt sein.
40Die angegriffenen Ausführungsformen würden in diesem Sinne keine Spannungsspitzenschutzschaltung aufweisen. Die seitens der Klägerin identifizierten MIM-Kondensatoren „X“, „L“ und „X“ seien Entkopplungskondensatoren, die am Eingang der Schaltmodusreglerschaltung dafür sorgen würden, dass die Eingangsspannung nicht unter einen bestimmten Schwellenwert sinke. Zudem lasse sich anhand der von der Klägerin ermittelten Parameter zur Kapazität und zum Widerstand dieser Kondensatoren eine Zeitkonstante ermitteln, die aufzeige, dass die MIM-Kondensatoren auch nicht schnell genug wären, Spannungsspitzen wirksam zu dämpfen. Konkret betrage dieser Wert, welcher rechnerisch zwischen den Parteien unstreitig ist, für X: 14,1 Ω*161 pF = 2,27 ns und für X: 1,2 Ω*282,5 pF = 339 ps. Die Oszillation liege dagegen bei 174ps.
41Zudem würden sich in der angegriffenen Ausführungsform keine Spannungsspitzen oberhalb einer maximalen Obergrenze für die Gate-Spannung eines einzelnen Transistors ergeben. Hierbei könne der VBD („break down voltage“)-Wert eine relevante Größe darstellen. Eine Berechnung komme zu maximalen xxxxxxxxx. Aufgrund dieser Werte habe die Simulation der Klägerin ohne Spannungsspitzenschutzschaltung keine Bedeutung, da diese vermeintliche Spitzen lediglich im Bereich von ca. X ergeben habe. Eine Zuverlässigkeitsgrenze für den regulären Betrieb läge bei den angegriffenen Ausführungsformen im Übrigen bei 2,3 V/Kaskode, betrachtet auf einen Zeitraum von X.
42Die seitens der Beklagten angestellten Simulationen würden belegen, dass keine Eingangsspannungen oberhalb der Zuverlässigkeitsgrenze auftreten würden. Die Eingangsspannung im X sowohl im „MIM-Szenario“ X) als auch im „noMIM-Szenario X) bewege sich unterhalb der von der Klägerin abgeschätzten Zuverlässigkeitsgrenze von2 V/Kaskode. Ebenso wenig lasse sich über die Betriebsdauer hinweg ein messbarer Einfluss der Eingangsspannung auf eine Degradation/Unzuverlässigkeit der angegriffenen Ausführungsformen feststellen.
43Die MIM-Kondensatoren seien auch deshalb keine erfindungsgemäße Spannungsspitzenschutzschaltung, da sie nicht über die Schaltelemente hinweg angeordnet seien. Das Klagepatent verstehe darunter eine Anforderung an die physische Ausgestaltung der Schaltung über die Wafer-Schichten hinweg. Die MIM-Kondensatoren würden aber nur in der Draufsicht an Areale angrenzen, in denen die Schaltelemente untergebracht seien. Auch hätten sie keinen relevanten Einfluss auf die Eingangsspannung. Hinzukomme, dass die MIM-Kondensatoren nicht zwischen Vhi und Vloc angeordnet seien, wie es die Klägerin in der Replik verlange, sondern – entsprechend dem Vortrag in der Klageschrift – nur allgemein zwischen Vin und GND. Diese Ausgestaltungen und Konfigurationseigenschaften würden hinsichtlich aller angegriffener Ausführungsformen gelten.
44Die angegriffenen X-Schaltungen würden, was unstreitig ist, nicht über ein separates dissipatives Element verfügen und auch aus diesem Grunde keine anspruchsgemäße Spannungsspitzenschutzschaltung aufweisen. Zudem sei die Ausgangsinduktivität nicht innerhalb der Spannungsspitzenschutzschaltung und damit nicht innerhalb der integrierten Schaltung angeordnet, was unstreitig ist. Die erfindungsgemäße Lehre verlange indes, sämtliche passiven Elemente innerhalb der Spannungsspitzenschutzschaltung oder der Schaltmodusreglerschaltung vorzusehen. Es gebe nur hinsichtlich dieser beiden Funktionseinheiten eine Differenzierung im Klagepatent. Weitere Elemente wie insbesondere eine Induktivität seien zwingender Bestandteil der Schaltmodusreglerschaltung, ohne die die beabsichtigte Funktion einer geregelten Spannung technisch nicht erreicht werden könne. Eine Anordnung an einer anderen Stelle auf dem Chip genüge nicht.
45Die MIM-Kondensatoren X und X seien funktional einheitlich zu betrachten. Es handele sich um einen Kondensator, der sich über den gesamten Chip erstrecke. Eine Unterteilung in Ladungsspeicherschaltsegmente liege nicht vor. Überdies fehle eine spezifische räumliche Anordnung zu einzelnen PMOS- und NMOS-FETs und damit eine erfindungsgemäße Verschachtelung. Diese ergebe sich auch nicht aus den Untersuchungen der Klägerin. In horizontaler Blickrichtung sei nur eine Anordnung der unterschiedlichen Segmente nebeneinander festzustellen. Auch sei nicht dargetan, dass die elektrischen Verbindungen nur kurz seien. Dies gelte für alle angegriffenen Ausführungsformen. Eine Anordnung der Schutzschaltungssegmente zwischen den Schaltblockelementen sei nicht erkennbar. Bei XProzessoren gebe es jedenfalls in vertikaler Richtung keine Verschachtelung.
46Aus denselben Erwägungen würden die weiteren angegriffenen Ausführungsformen das Klagepatent ebenso wenig verletzen.
47Die Vollstreckung eines etwaigen Unterlassungsanspruchs sei unverhältnismäßig. Es handele sich bei den angegriffenen Ausführungsformen um hochkomplexe Produkte, die eine Vielzahl von Komponenten beinhalten würden. Daher gestalte sich jede Umgestaltung als äußerst schwierig, da die einzelnen Hard- und Softwarekomponenten dergestalt aufeinander abgestimmt seien, dass jeder Austausch auch auf zahlreiche andere Komponenten Einfluss nehme. Daraus folge faktisch eine Neuentwicklung der angegriffenen Ausführungsformen, welche erhebliche Zeit in Anspruch nehme, woraus massive Schäden entstünden. Auf Prozessorebene betrage die Frist zur Umstellung mindestens 29 Monate, für Client-Produkte 12 Monate und für Server-Produkte 18-36 Monate. Hinzu käme, dass der Bedarf an angegriffenen Ausführungsformen nicht gedeckt werden könnte, was sich aufgrund ihrer besonderen gesellschaftlichen Bedeutung auch auf weitere Sektoren auswirken würde. Solche Auswirkungen wären auch gerade nicht die typische Folge einer Patentverletzung. Die Beklagte habe weder im Vorhinein durch eine Freedom-to-operate-Recherche das Klagepatent mangels Veröffentlichung (der Anmeldung) auffinden können noch könne sie nach einer Verurteilung durch einen zügigen Design-Around die Folgen einer Unterlassungsanordnung abmildern – dies gelte sowohl für ein Design-Around der angegriffenen Prozessoren als auch der Endprodukte, die mit diesen Prozessoren ausgestattet würden. Hinzukomme, dass der Gegenstand des Klagepatentes von geringer Bedeutung innerhalb der betroffenen komplexen Produkte sei. Das Klagepatent sei im Übrigen weder mit der X-Technologie noch mit den Prozessoren als solches gleichzusetzen. Das Klagepatent betreffe eine konkrete Gestaltung eines Spannungsreglers in Form eines Schaltreglers und beanspruche insofern eine spezifische räumliche Anordnung bestimmter Komponenten dieses Spannungsreglers.
48Zumindest sei der Rechtsstreit mangels Rechtsbestands des Klagepatents auszusetzen. Dieses werde sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit im Nichtigkeitsverfahren als nicht neu sowie nicht erfinderisch erweisen.
49Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die zur Akte gereichten Schriftstücke nebst Anlagen Bezug genommen.
50Entscheidungsgründe
51A.
52Die zulässige Klage ist begründet. Der Klägerin stehen die geltend gemachten Ansprüche zu, da die angegriffenen Ausführungsformen von der Lehre nach dem Klagepatent Gebrauch machen. Eine Veranlassung zur Aussetzung des Rechtsstreits besteht nicht.
53I.
54Das Klagepatent betrifft Überspannungsschutz für einen Schaltwandler in einer integrierten Schaltungseinheit.
55Aus dem Stand der Technik sind auf dem Fachgebiet der Leistungsumwandlung, wie in Abs. [0002] ausgeführt, Gleichspannungswandler und -regler wohlbekannt und werden häufig eingesetzt, um zu gewährleisten, dass die Gleichspannung, die elektronischen Bauelementen zur Verfügung gestellt wird, unabhängig von Schwankungen der verfügbaren Versorgungsspannung oder der Last, die von dem mit Strom versorgten Bauelement bereitgestellt wird, den richtigen Wert aufweist.
56Es kann zwischen Spannungsreglern im Linearmodus und im Schaltmodus unterschieden werden, wobei der Fokus vorliegend auf im Schaltmodus betriebenen Reglern liegt. Ein Schaltregler wandelt eine Eingangsgleichspannung in eine zeitveränderliche Spannung oder einen zeitveränderlichen Strom um und nutzt dann Gleichrichter- oder Schaltelemente sowie passive Komponenten wie Induktoren und Kondensatoren in Verbindung mit einer Steuerschaltung, um dieses zeitveränderliche Signal wieder in eine Gleichspannung mit einem festen Wert umzuwandeln, der von der Eingangsspannung abweicht (Abs. [0003]). Die im Folgenden gezeigte Figur 2 veranschaulicht den Aufbau eines aus dem Stand der Technik bekannten Schaltreglers:
57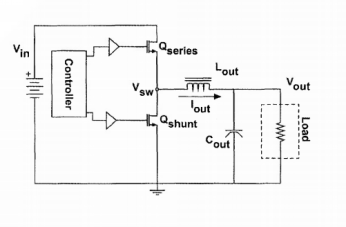
Wie in Abs. [0005] ausgeführt, waren für den Betrieb eines Schaltmodusreglers groß bewertete (und physikalisch große und dicke) externe Induktoren und Kondensatoren erforderlich. Der resultierende zeitabhängige Induktionsstrom im Grenzbereich des idealen (momentanen) Umschaltens ist in Fig. 3 dargestellt:
59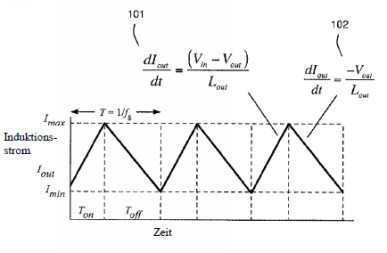
Im Betrieb wird der Reihenschalttransistor Qseries für ein Zeitintervall Ton eingeschaltet, so dass Strom von der Versorgung durch den Ausgangsinduktor Lout fließen kann. Während dieser Zeitperiode Ton wächst der Ausgangsstrom 101 linear mit der Zeit mit einer Geschwindigkeit, die proportional zur Differenz zwischen der Eingangs- und der Ausgangsspannung ist, wobei Letztere während des Schaltzyklus im Wesentlichen fest ist, wenn ein ausreichend großer Ausgangskondensatorwert Cout verwendet wird. Nach Ablauf von Ton wird der Schalter Qseries ausgeschaltet. Nach einer kurzen Totzeit wird dann der Schalter Qshunt eingeschaltet, und der Induktionsstrom fließt von der Masse durch Qshunt. Erneut ändert sich der Strom 102 linear mit der Zeit, wobei er in diesem Fall mit zunehmender Zeit abnimmt (Abs. [0006]).
61Dies hat, wie in Abs. [0007] beschrieben, für den Strom durch den Ausgangsinduktor („output inductor“) die Folge, dass er sich mit der Zeit ändert; diese Änderung ist als Induktionsstromwelligkeit bekannt. Wenn für irgendeinen bestimmten Induktorwert die Zeit Toff, während welcher der Reihenschalter Qseries ausgeschaltet ist, lang genug ist, sinkt der Induktionsstrom auf den Wert Null und kehrt entweder die Richtung um oder wird durch Ausschalten von Qshunt beendet. Die Betriebsart, in welcher der Strom beendet wird, ist als „diskontinuierlicher“ Betrieb bekannt, um vom „kontinuierlichen“ Betrieb unterschieden zu werden, bei dem stets Strom vom Ausgangsinduktor an die Last geliefert wird. Bei den meisten praktischen Wandlerkonstruktionen wird die Änderung des Stroms mit der Zeit (der Welligkeitsstrom) als Faustregel so gewählt, dass sie weniger als etwa 20 Prozent des durchschnittlichen Ausgangsstroms beträgt. Bei Wandlern, die im herkömmlichen Schaltfrequenzbereich von 50 kHz bis 1 MHz arbeiten, ist es offensichtlich, dass für den Dauerbetrieb Induktoren in der Größenordnung von 3 bis 30 µH erforderlich sind.
62Derart große Induktivitätswerte werden normalerweise erreicht, indem ein Leiter um einen ferromagnetischen Kern gewickelt wird, wodurch die für eine bestimmte Anzahl von Windungen eines bestimmten Radius erhaltene Induktivität stark erhöht wird (Abs. [0008]). Allerdings weisen Einschränkungen hinsichtlich der Betriebstemperatur und Einschränkungen hinsichtlich des Spitzenstroms aufgrund von Kernsättigungseffekten auf (Abs. [0009]). Für eine bestimmte Anwendung sind der maximale Laststrom sowie die Eingangs- und die Ausgangsspannung feste Anforderungen. Daher muss der Kern so dimensioniert sein, dass er den für die Anwendung erforderlichen Strom trägt (Abs. [0011]).
63In Abs. [0012] ist des Weiteren zu magnetischen Induktoren erklärt, dass sie vor allen Dingen am typischsten durch das Wickeln von Draht um einen Magnetkern hergestellt werden. Gewickelte magnetische Induktoren sind im Vergleich zu den an einem Halbleiterchip integrierten Komponenten sperrig. Bei batteriebetriebenen Geräten ist die Höhe der in der internen Leiterplatte (PCB) montierten elektronischen Bauelemente üblicherweise durch die Dicke der Induktoren begrenzt, die für die DC/DC-Leistungsumwandlung verwendet werden. Um eine minimale Ausgangswelligkeit sicherzustellen, muss die Kapazität einen ausreichend großen Wert haben, um die während des Schaltzyklus abgegebene zeitveränderliche Ladung ohne wesentliche Änderung der Spannung über den Kondensator hinweg zu speichern. Bei Wandlern, die mit 10 MHz oder weniger arbeiten, beträgt der Kondensator typischerweise 5 µF oder mehr, wodurch wiederum die Größe und die Kosten des Wandlers wesentlich erhöht werden.
64Vorbekannt war, dass zur Lösung des Problems immer größer und teurer werdender Wandler die Schaltfrequenz erhöht werden konnte, weil dadurch die Größe des Induktors verringert werden konnte. Die Verwendung von Induktoren mit niedrigerem Wert ermöglicht die Verwendung von planaren Geometrien, die auf Leiterplatten integriert oder in integrierten Schaltungen hergestellt werden können. Eine solche Veränderung der Schaltfrequenz birgt aber das Problem, dass die meisten magnetischen Materialien eine verringerte Permeabilität und erhöhte Verluste aufweisen, obwohl das genaue Verhalten in Abhängigkeit von dem verwendeten Material und den eingesetzten Herstellungstechniken stark variiert (Abs. [0013]). Das Anheben der Schaltfrequenz auf 10 bis 100 MHz oder mehr unter Aufrechterhaltung eines hohen Wirkungsgrads erfordert seinerseits, dass Verluste innerhalb der Schalter minimiert werden (Abs. [0014]).
65Die Lösungen nach dem Stand der Technik für das Problem der Dissipation innerhalb des Transistorkanals während des Schaltens bei hohen Frequenzen waren – wie von Abs. [0017] geschildert – darauf gerichtet, die Drain-Source-Spannung Vmax zu minimieren. Um die Dissipation aufgrund des Schaltens der kapazitiven Last, die von den Schalttransistoren bereitgestellt wird, zu minimieren, hat sich die Arbeit im Stand der Technik auf Konstruktionen konzentriert, welche die Schaltenergie des Gate-Kondensators in zusätzlichen induktiven Elementen speichern, wobei ein Resonanzwandler gebildet wird (Fig. 8).
66Ein alternativer Ansatz zur Minimierung beider Quellen von Schaltverlusten besteht darin, sehr schnelle Schaltzeiten zu verwenden, wodurch der Term Tsw in Gleichung (5) reduziert wird. Die zum Schalten des Transistors erforderliche Zeit sollte ein kleiner Bruchteil der Schaltsteuerperiode sein. Für den Betrieb bei 100 MHz, bei dem die Schaltsteuerperiode 10 ns beträgt, beträgt die Zeit Tsw für eine sinusförmige Spannung (geeignet zur Verwendung in einem ZVS-Wandler) etwa 1,6 ns. Um eine vergleichbare Schaltdissipation beim Schalten bei einer endlichen Spannung zu erreichen, sollte die Schaltzeit Tsw nicht mehr als etwa 1/5 dieser Zeit oder 350 ps betragen (Abs. [0019]). Solch schnellen Schaltzeiten können allerdings nur in hochentwickelte Transistoren implementiert werden, die sehr kurze Kanallängen und sehr dünne Oxide mit reduziertem Flächenverbrauch und niedrigeren Einschaltspannungen verwenden. Bei Anwendung solcher Technologien wird die Kapazität minimiert (für denselben RON), und die zum Ändern des Transistorzustands erforderliche Spannung wird verringert, und somit wird auch der Gate-Schaltverlust verringert (vgl. Abs. [0020]).
67Hieran kritisiert das Klagepatent, dass aber auch die maximal zulässigen Gleichspannungen ebenfalls verringert wurden und die erreichbaren Eingangsspannungen unterhalb dem für die Anwendung in tragbaren Geräten erforderlichen Betrag lag, wobei eine herkömmliche Abwärtswandlerschaltung nicht zuverlässig bereitgestellt werden konnte (Abs. [0021]).
68Das Klagepatent beschreibt deshalb in Abs. [0022] den Bedarf an einen DC/DC-Wandler, der gleichzeitig kompakt (einschließlich einer optimalen Fertigung aller aktiven und passiven Komponenten auf einem einzelnen Halbleiter-Die), kostengünstig und selbst bei geringen Verhältnissen von Ausgangs-zu Versorgungsspannung und niedrigem Ausgangsstrom hocheffizient ist.
69Das Klagepatent stellt sich daher entsprechend der Ausführungen in Abs. [0023] die Aufgabe, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Schützen von Schaltelementen eines Wandlers vor transienten Spannungen zur Verfügung zu haben, um schnelle verlustarme Schaltvorgänge ohne Verschlechterung der Zuverlässigkeit zu ermöglichen. Wegen des weiteren Standes der Technik wird auf die in den Abs. [0024] ff. erörterten Patentanmeldungen verwiesen.
70Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent im Patentspruch 1 eine Vorrichtung vor, welche in die folgenden Merkmale gegliedert werden kann:
71a) Spannungsregler, Folgendes umfassend:
72b) Eine Schaltmodusreglerschaltung zum Erzeugen einer geregelten Spannung mit Reihen- und Nebenwiderstandschaltelementen;
73c) Eine Spannungsspitzenschutzschaltung,
74c1. die über die Reihen- und Nebenwiderstandschaltelemente hinweg an dem Eingang der Schaltmodusreglerschaltung angeordnet ist,
75c2. zum Spannungsspitzenschützen der Schaltmodusreglerschaltung,
76c3. ein dissipatives Element (Rsp) und eine Ladungsspeicherschaltung (Csp) umfassend
77dadurch gekennzeichnet, dass:
78d) Die Schaltmodusreglerschaltung und die Spannungsspitzenschutzschaltung sind durch eine integrierte Schaltung in einer integrierten Schaltungseinheit implementiert;
79e) Die Reihen- und Nebenwiderstandschaltelemente der Schaltmodusreglerschaltung sind in verbundene Schaltblocksegmente unterteilt;
80f) Die Ladungsspeicherschaltung (Csp) der Spannungsspitzenschutzschaltung ist in verbundene Ladungsspeicherschaltungssegmente unterteilt, die zwischen den Schaltblocksegmenten verschachtelt sind
81II.
82Die Parteien diskutieren vorliegend zurecht ausschließlich über das Verständnis der Merkmale b) und d), der Merkmalsgruppe c) sowie des Merkmals f). Seitens der Kammer bedarf es deshalb nur insoweit an Ausführungen.
831.
84Der Anspruch 1 schützt einen Spannungsregler (Merkmal a)), dessen Zusammensetzung und Struktur in den anderen Merkmalen eine nähere Beschreibung erfährt. Als Hauptbestandteile werden in den Merkmalen b) und c) eine Schaltmodusreglerschaltung und eine Spannungsspitzenschutzschaltung beansprucht. Diese beiden Schaltungen weisen weitere, im Einzelnen streitige, Komponenten auf und sollen in einem bestimmten Verhältnis zueinander angeordnet sein (Merkmal f), wobei sie beide durch eine integrierte Schaltung in einer integrierten Schaltungseinheit implementiert sein sollen.
85Zwischen den Parteien steht außer Streit, dass in einem funktionstüchtigen Spannungsregler zusätzlich zu den vom Anspruch genannten Komponenten grundsätzlich auch passive Komponenten enthalten sind, wie beispielsweise die Ausgangsinduktivität Lout, welche ein zwingendes Bauteil darstellt, das zur Versorgung der elektrischen Last durch den Regler geleitete Spannung vorhält und deren konstante Stromversorgung gewährleisten soll.
86Die vom Klagepatent in Merkmal b) unter Schutz gestellte Schaltmodusreglerschaltung zum Erzeugen einer geregelten Spannung mit Reihen- und Nebenwiderstandschaltelementen muss nicht die Ausgangsinduktivität umfassen. Dementsprechend ist es nach Merkmal d) nicht erforderlich, die Ausgangsinduktivität in die integrierte Schaltung einzubeziehen.
87Das sprachliche Verständnis gibt nichts dafür her, dass die Ausgangsinduktivität Bestandteil der Schaltmodusreglerschaltung sein müsste. Die Formulierung „Schaltmodusreglerschaltung“ adressiert nur eine Schaltung, die eine spezifische Betriebsart (einen Modus) eines Spannungsreglers umsetzt, in dem mittels Schaltelementen und passiven Komponenten ein fester Wert einer Ausgangsgleichspannung erzeugt wird. Der gewählte Schaltmodus hängt zwar technisch notwendig mit der Implementierung von passiven Elementen zusammen, macht solche Elemente aber nicht zum Bestandteil der Schaltmodusreglerschaltung, sondern allenfalls des Spannungsreglers.
88Auch der Anspruch im Übrigen weist der Schaltmodusreglerschaltung mit den genannten Reihen- und Nebenwiderstandselementen ausdrücklich nur aktiv arbeitende Bestandteile zu. Nur weil der Anspruch keinerlei passiven Elemente wie eine Ausgangsinduktivität erwähnt, auch nicht im Kontext mit anderen Funktionseinheiten wie der Spannungsspitzenschutzschaltung, ist allein daraus auch keine Unterteilung eines erfindungsgemäßen Spannungsreglers in nur zwei funktionale Blöcke (Schaltmodusreglerschaltung und Spannungsspitzenschutzschaltung) zu folgern, was die unmittelbare Zuordnung passiver Elemente zu der einen oder anderen Funktionseinheit bedingen würde.
89Allenfalls die Angabe der Bezugszeichen 301, 302, 304 und 306 im Anspruch lässt für den Fachmann erkennen, dass eine anspruchsgemäße Schaltmodusregleranordnung weitere Elemente als die angeführten Reihen- und Nebenwiderstandsschaltelemente, ihrerseits mit 301 und 302 benannt, beinhalten kann. Dabei haben nur letztgenannte Schaltelemente explizit Eingang in den Anspruch gefunden, nicht dagegen auch die mit 304 und 306 gekennzeichneten Treiber (vgl. Abs. [0042]). Aus dem Umstand aber, dass für die Schaltung auch andere Bezugszeichen angegeben werden, die der Spannungsversorgung der Schaltelemente dienen und dementsprechend in den Figuren dargestellt sind, lässt sich gerade ableiten, dass darüber hinaus eben keine weiteren (passiven) Komponenten wie die Ausgangsinduktivität Gegenstand der Schaltung sein sollen. Im Übrigen handelt es sich bei den nur durch den Verweis auf die Bezugszeichen angeführten weiteren Elementen anders als bei der Ausgangsinduktivität um notwendige technische Mittel, ohne die die Schaltelemente nicht betrieben werden könnten.
90Die in Merkmal b) verwendete Zweckangabe „zum Erzeugen einer geregelten Spannung“ gibt keinen Hinweis auf die räumlich-körperliche Zusammensetzung einer Schaltmodusreglerschaltung mit Ausgangsinduktivität. Denn sie verdeutlicht den Einsatzzweck eines erfindungsgemäßen Spannungsreglers als solchen, wozu die Schaltmodusreglerschaltung beitragen soll. Er soll eine Ausgangsspannung bereitstellen, die an die elektrische Last weitergeleitet wird. Auf diese Spannung soll die Ausgangsinduktivität Einfluss nehmen, indem sie für eine weitgehend konstante Spannungsversorgung sorgt. Die Schaltmodusreglerschaltung trägt zur Erreichung dieses Ziels bei, was aber nicht dazu führt, ihr die Ausgangsinduktivität funktional zuzuordnen. Denn für den Betrieb eines Spannungsreglers im Schaltmodus sind zunächst nur die Schaltelemente erforderlich. Der Schaltmechanismus muss (in Abhängigkeit von Zeit) funktionsgemäß ausgebildet sein. Dies hat technisch zur Konsequenz, dass die jeweils erforderlichen Spannungseingaben in die als Transistoren ausgebildeten Schaltelemente zur Schaltmodusreglerschaltung hinzuzuzählen sind (vgl. Treiber 304, 306), da diese Spannungsversorgungen unerlässlich sind, damit der Spannungsregler überhaupt im Schaltmodus betrieben werden kann. Der Einsatz einer Ausgangsinduktivität hingegen ist nicht erforderlich, um die Schaltung der Reihen- und Nebenwiderstandsschaltelemente zu realisieren, sondern allenfalls eine technisch-bedingte Konsequenz für den Betrieb des ganzen Spannungsreglers.
91Dieses Verständnis steht in Einklang mit der Aufgabenstellung, kompakte Vorrichtungen bereitstellen zu wollen. Sofern der die Aufgabenstellung betreffende Abs. [0022] auch ausführt, dass Bedarf an einem kompakten Wandler „einschließlich einer optimalen Fertigung aller aktiven und passiven Komponenten auf einem einzelnen Halbleiter-Die“ besteht, führt dies nicht zu einem anderen Anspruchsverständnis. Denn allenfalls wird die objektive Aufgabe näher erläutert, was aber nicht zwingend heißt, dass der Optimalfall in der erfindungsgemäßen Lösung auch umgesetzt werden muss. Maßgeblich wird die kompakte Ausgestaltungsform des Spannungsreglers schon dadurch ermöglicht, dass Bauteile kleiner dimensioniert werden und zur Vorbeugung von Schaltverlusten ein separater Spitzenschutz vorgesehen wird. Erforderlich, aber auch ausreichend ist, die zu schützenden Komponenten in eine Schaltung zu integrieren. Die Induktivität dagegen bedarf dieses Schutzes nicht.
92Auch die Anspruchssystematik bestätigt das erläuterte Verständnis, insbesondere die Merkmale, die die Spannungsspitzenschutzschaltung betreffen. In Merkmal c2 wird der Gegenstand der Schutzschaltung als die Schaltmodusreglerschaltung beschrieben. Weder der Anspruch noch die Beschreibungsstellen lassen insofern erkennen, dass die Ausgangsinduktivität in diesen Schutzmechanismus einbezogen werden müsste, was aber zwingend so wäre, wenn sie Bestandteil der Schaltmodusreglerschaltung wäre. Etwas anderes ergibt sich ebenso wenig aus Merkmal d), wenn dort auf die Schaltmodusreglerschaltung abgestellt wird, die in einer integrierten Schaltung implementiert sein soll. Das Klagepatent vermeidet es auf diese Weise nur, deren einzelne für den Schalbetrieb erforderliche Bestandteile aufzuführen. Die Angabe der Schaltmodusreglerschaltung dient somit als Zusammenfassung und nicht als Hinweis auf eine strikte Zweiteilung der im Klagepatentanspruch 1 vorgesehenen Vorrichtungskomponenten.
93Die besonderen Beschreibungsstellen der Klagepatentschrift bestärken den Fachmann in dem Verständnis, die passive Komponente der Ausgangsinduktivität nicht der Schaltmodusregleranordnung zuzurechnen; selbst berücksichtigend, dass die beschriebenen bevorzugten Ausführungsformen den Schutzgegenstand des Klagepatents nicht auf eine bestimmte Ausgestaltung zu begrenzen vermögen. Jedenfalls geben sie dem Fachmann keinen positiven Hinweis, von einem solchen Verständnis der Schaltmodusreglerschaltung auszugehen.
94Eingangs der Beschreibung heißt es in Abs. [0032] ff. zur Funktionsweise der Schaltelemente einer erfindungsgemäßen Vorrichtung:
95„Abs. [0032]: Fig. 10 zeigt ein Beispiel eines Spannungswandlers 310, der zumindest einige der Elemente der beschriebenen Ausführungsformen enthält. Der Wandler 310 beinhaltet ein Reihenschaltelement 301 und ein Nebenschaltelement 302, die jeweils mit gestapelten Transistoren implementiert sind. […] Ein gestrichelter Blockabschnitt 350 in Fig. 10 stellt den gestapelten NMOS-Transistor Qssw, Qsp, Qshsw, QsE der Reihen- und Nebenschaltelemente 301, 302 und den Treiber sowie eine schwebende Stromversorgung 304 dar, welche die Gatespannungen der NMOS-Transistoren Qssw, Qsp des Reihenschaltelements 301 steuert.“
96[0033] Eine Steuerung stellt Schaltsteuersignale bereit, die den Zeitablauf des Öffnens und Schließens des Reihenschaltelements 301 und des Nebenschaltelements 302 steuern. Diese Ausführungsform des Wandlers 310 beinhaltet ferner einen Treiber und schwebende Stromversorgung 304 (auch als Bootstrap-Schaltung bezeichnet), die so konfiguriert ist, um Steuereingänge und Vorspannungseingänge für die Schalt- bzw. Schutztransistoren des Reihenschaltelements 301 bereitzustellen, wobei die Spannungen darin auf den zeitabhängigen Wert des Ausgangsschaltknotens Vsw bezogen sind.
97Die Beschreibungsstellen zu Figur 10, die einen vollständigen Spannungsregler zeigt, erläutern die Schaltszenarien und die durch die Betätigung der beiden Schaltelemente in der Vorrichtung anliegenden Spannungen. Eine Ausgangsinduktivität findet in diesem Zusammenhang keine Erwähnung. Die Darstellung aller Komponenten mit den Bezugszeichen 301, 302, 304 und 306 entspricht dem Anspruch und greift die darin erwähnten Bestandteile der Schaltmodusreglerschaltung auf. Zusätzlich erfahren diese Bestandteile dadurch eine Zuordnung zueinander, dass sie in dem gestrichelt dargestellten Blockabschnitt 350 zusammengefasst sind. Die an der rechten Ausgangsseite des Spannungsreglers abgebildete Ausgangsinduktivität ist nicht umfasst. Mithin sind die für den Betrieb der Schaltelemente benötigten Elemente gezeigt und nur optionale Komponenten sind außen vorgelassen worden, wie sich insbesondere bei einem Vergleich mit der Figur 12 zeigt.
98Die Orientierung der Parteien an den verwendeten Bezugszeichen vermag für das aufgefundene Verständnis im Übrigen auch nur einen Anhaltspunkt zu bieten. Denn es ist zu berücksichtigen, dass Bezugszeichen in erster Linie lediglich der Nachvollziehbarkeit der Erfindung dienen. Darüber hinaus können Bezugszeichen im Patentanspruch den Schutz auch nicht auf ein bestimmtes Ausführungsbeispiel einschränken und nicht dazu führen, dass nur die in den Ausführungsbeispielen gezeigte Umsetzung des Merkmals für patentgemäß erachtet wird. So verdeutlicht die Verwendung identischer Bezugszeichen im Anspruch, dass das hiermit in Bezug genommene Bestandteil bzw. Bauteil des bevorzugten Ausführungsbeispiels erfindungsgemäß als Ausführungsvariante sowohl des einen wie auch des anderen Merkmals angesehen werden kann (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2023, 237 Rn. 88, Waffenverschlusssystem II; OLG Düsseldorf Urt. v. 25.8.2022 – I-2 U 31/18, GRUR-RS 2022, 21391 Rn. 51, Faserstrangherstellung).
99Auch die Beschreibung in Abs. [0079] zur Segmentierung von Reihen- und Nebenwiderstandsschaltelementen unterstützt den Fachmann in dem Verständnis, eine Ausgangsinduktivität losgelöst von der Schaltmodusreglerschaltung zu betrachten. Es heißt dort:
100„Ein Beispiel ist in Fig. 21 dargestellt, in der die Schalter-Schaltung (die Schaltelemente) 301 und 302 in eine Reihe von Schaltblocksegmenten 2120, 2130, 2140 usw. unterteilt ist und jedem Segment Schutzschaltungsblöcke, wie z.B. 2121 und 2122, zugeordnet sind.“
101Die Segmentierung des Schaltblocks soll unterteilte, funktionsfähige Untereinheiten hervorbringen, was mit dem Verständnis der Beklagten bedeuten würde, dass auch eine Ausgangsinduktivität jeder Untereinheit zugewiesen ist. Dies ist aber nicht zu erkennen und technisch überdies nicht erforderlich. Die unterteilten Schaltungen sollen vielmehr gerade in eine gemeinsame Ausgangsinduktivität zurückgeführt werden.
102Vor dem bereits erläuterten Hintergrund erfordern technisch-funktionale Gesichtspunkte ebenso wenig ein anderes Verständnis. Unbestritten bedingen sich der Einsatz einer Schaltregelung mit hoher Schaltfrequenz einerseits und die Ausgestaltung einer Ausgangsinduktivität andererseits. Für den Betrieb des Schaltmodus ist für sich genommen die Induktivität aber keine unerlässliche Voraussetzung. Denn die Reihen- und Nebenwiderstandsschaltelemente funktionieren auch ohne die Induktivität, solange sie mit der erforderlichen Spannung versorgt werden.
103Umso mehr wird das hier vertretene Verständnis schließlich durch den Stand der Technik unterstützt, wie er in der Klagepatentschrift einleitend Anklang gefunden hat. Dort heißt es unter anderem:
104„Abs. [0003]
105Im Gegensatz dazu wandelt ein Schaltregler eine Eingangsgleichspannung in eine zeitveränderliche Spannung oder einen zeitveränderlichen Strom um und nutzt dann Gleichrichter- oder Schaltelemente sowie passive Komponenten wie Induktoren und Kondensatoren in Verbindung mit einer Steuerschaltung, um dieses zeitveränderliche Signal wieder in eine Gleichspannung mit einem festen Wert umzuwandeln, der von der Eingangsspannung abweicht.
106Abs. [0005]
107Leider benötigen die meisten Schaltmodusregler groß bewertete (und physikalisch große und dicke) externe Induktoren und Kondensatoren für den Betrieb.
108Abs. [0013]
109Die Verwendung von Induktoren mit niedrigerem Wert ermöglicht die Verwendung von planaren Geometrien, die auf Leiterplatten integriert oder in integrierten Schaltungen hergestellt werden können.“
110Die Beschreibungsstellen beziehen sich auf vorbekannte Ausgestaltungen von Spannungsreglern. Es wird auf den Schaltregler verwiesen, der die Eingangsgleichspannung wandelt und dabei bestimmte Komponenten benutzt. Die passiven Komponenten, sowie die Schaltelemente werden dem Schaltregler als Ganzes zugewiesen; eine Zuweisung untereinander findet nicht statt. Das Klagepatent knüpft an dieser vorbekannten, grundlegenden Systemarchitektur an und will daran Verbesserungen vornehmen, jedoch nicht notwendigerweise im Bereich der Ausgangsinduktivität, weshalb diese nicht in eine integrierte Schaltung implementiert werden muss.
1112.
112Die Merkmalsgruppe c) betrifft die Spannungsspitzenschutzschaltung. Die Merkmale c1 bis c3 konkretisieren die Schaltung in ihrer räumlichen Anordnung, ihres Einsatzzwecks sowie ihrer Bestandteile.
113a.
114Unter einer Spannungsspitzenschutzschaltung versteht das Klagepatent beispielsweise Kondensatoren, die in der Lage sind, im Betrieb des Spannungsreglers durch schnelle Schaltfrequenzen der Schaltelemente auftretende Überspannungen, ausgelöst von parasitären Induktivitäten, zu eliminieren, damit die zulässige Eingangsspannung nicht überschritten wird.
115Die Schutzschaltung sorgt dafür, dass die Spannungshöchstgrenze, für die die Schaltmodusreglerschaltung ausgelegt ist, nicht erreicht wird und der gesamte Spannungsregler so vor vorzeitiger Alterung und Zerstörung bewahrt wird. Dessen ordnungsgemäßer Betrieb wird sichergestellt und eine übermäßige Strapazierung des Spannungsreglers verhindert. Es muss sich nicht um ein derartiges Überschreiten eines Höchstwertes handeln, das unmittelbar und schon einmalig zu einer Zerstörung der Transistoren führt. Entscheidend ist, dass der regelmäßig verträgliche Maximalwert einer Eingangsspannung ohne das Eingreifen der Spannungsspitzenschutzschaltung überschritten würde. Die Schutzschaltung befindet sich am Eingang der Schaltmodusregleranordnung und ist dieser insbesondere elektronisch vorgelagert. Sie bezieht sich auf die Bestandteile der Reglerschaltung. Dabei ist eine räumlich-körperliche Anordnung der Schutzschaltung im Halbleiteraufbau oberhalb der Schaltmodusreglerschaltung nicht erforderlich. Ausreichend ist es, eine (elektrische) Nähe dieser Bestandteile zueinander herzustellen und eine (parallele) Schaltung, so dass alle Reglerelemente in den Schutz einbezogen und keinen schädigenden Überspannungen ausgesetzt sind.
116Seinem rein-sprachlichen Verständnis nach beschreibt der Begriff der „Spannungsspitzenschutzschaltung“ eine elektronische Anordnung, die vor solchen Spannungen schützen soll, die gelegentlich auftreten und dabei im Vergleich zu der regulären Spannung deutlich nach oben abweichen. Diese Ausschläge sollen aufgefangen und gedämpft werden, indem auf die Oszillation Einfluss genommen wird
117Der Schutzgegenstand ist die Schaltmodusreglerschaltung, wie es auch in Merkmal c2 zum Ausdruck kommt. Eigene räumlich-körperliche Anforderungen an die Ausgestaltung der Spannungsspitzenschutzschaltung ergeben sich aus dieser Zweckangabe für eine erfindungsgemäße Vorrichtung aber nicht.
118Indem die Spannungsspitzenschutzschaltung auf die gesamte Schaltmodusreglerschaltung bezogen ist, wird das in Merkmal c1 beanspruchte Erfordernis unterstrichen, sie über die Reihen- und Nebenwiderstandsschaltelemente hinweg am Eingang anzuordnen („across“). Selbst wenn dem Fachmann ein schichtweiser Aufbau von Halbleitern bekannt ist, folgt daraus nicht, dass das Klagepatent eine rein physische Vorgabe machen wollte und eine bei bloßer Draufsicht übergreifende Anordnung der Schutzschaltung über die Schaltelemente hinweg erforderlich wäre.
119Die Klagepatentbeschreibung unterstützt den Fachmann in dem Verständnis, dass sich die Spannungsspitzenschutzschaltung auf das Überschreiten einer für den Betrieb der Transistoren zulässigen Höchstspannung bezieht und genau davor Schutz bieten soll.
120Schon in Abs. [0043] findet der Fachmann Hinweise auf dieses Verständnis. Dort ist ausgeführt:
121„Wie gezeigt, enthält jeder Schaltblock 301 und 302 zwei Transistoren, einen Schalttransistor und einen Schutztransistor, und ist für den Betrieb mit Versorgungsspannungen von etwa dem Doppelten der maximalen Gleichstrom-Drain-Source-Spannung, die für die verwendete Transistortechnologie zulässig ist, geeignet.“
122Die Dimensionierung der Schutzschaltung orientiert sich ausdrücklich an einem Höchstwert, auf den die Schalttransistoren ausgelegt sind. Dies beinhaltet, dass ein solcher Maximalwert feststeht oder zumindest zu bestimmen ist. Dadurch wird klar, dass die Schalttransistoren eine bestimmte Spannungsobergrenze aufweisen, bis zu der ein zuverlässiger Betrieb der Schaltelemente möglich ist. Nicht erforderlich ist, dass allein durch ein einmaliges Überschreiten der Obergrenze die Schaltelemente zerstört würden. Dies verlangt das Klagepatent nicht.
123Die Beschreibungsstellen ab Abs. [0065] befassen sich sodann mit der Spitzenschutzschaltung im Einzelnen und bestätigen das Verständnis von Maximalwerten als Spannungsspitze überdies. Auch sie geben keine ausdrücklichen Anhaltspunkte auf eine physische Anordnung der Spitzenschutzschaltung oberhalb der Schaltmodusreglerschaltung. So skizziert Abs. [0066] zunächst die Problematik, weshalb es in einer erfindungsgemäßen Vorrichtung eines Spannungsspitzenschutzes bedarf:
124„Erneut bezugnehmend auf Fig. 12 fließt der volle Ausgangsstrom folglich durch den parasitären Induktor Lpar,hi, wenn der Reihenschalter 301 eingeschaltet ist. Wenn der Reihenschalter 301 schnell ausgeschaltet wird, versucht dieser parasitäre Induktor, den gleichen Ausgangsstrom aufrechtzuerhalten, wodurch die Spannung Vhi dazu gebracht wird, ohne vorbeugende Maßnahmen schnell anzusteigen. Es kann auch erwartet werden, dass in Abwesenheit einer Verlustleitung innerhalb des Schaltkreises die parasitäre Induktivität mit parasitären Kapazitäten in Wechselwirkung treten kann, um eine Hochfrequenz-Resonanzschaltung zu bilden, die infolge des anfänglichen schnellen Spannungsübergangs einen anhaltenden Überschwingungszustand erzeugen wird. […] Es ist offensichtlich, dass in dem Moment, in dem sich der Reihenschalter ausschaltet, die lokale Versorgungsspannung auf bis zu 12,5 Volt ansteigt, was selbst für eine gestapelte (Kaskaden-)Konfiguration bei Verwendung von 0,18-Mikrometer-Baulelementen weit über dem maximalen Grenzwert liegt.“
125In Abs. [0067] heißt es weiter:
126„Während das in Fig. 18 dargestellte detaillierte Verhalten spezifisch für die beschriebenen Ausführungsformen sein kann, tritt das allgemeine Phänomen von übermäßigen Spannungsausschlägen (Spitzen) und Überschwingungen außerdem jedes Mal auf, wenn ein schneller Schaltübergang ohne hinzugefügte Nebenkapazität in einem Wandler zum Einsatz kommt.“
127Die vorgenannten Beschreibungsabsätze lassen erkennen, dass die durch die schnellen Schaltvorgänge auftretenden Überschwingungen am Eintreffen auf die Schalter gehindert werden sollen. Dabei beschreibt das Klagepatent diese parasitären Reaktionen als „übermäßig“ und „weit über dem maximalen Grenzwert“, wodurch der Fachmann einen Anhalt erhält, was das Klagepatent als Spannungsspitzen ansieht.
128Mit dem Schutz der Schaltelemente will das Klagepatent einen ordnungsgemäßen und langfristigen Betrieb des Spannungsreglers sicherstellen. Die Abnutzung durch extreme Beanspruchung soll minimiert werden. Dies belegen die Abs. [0023] und [0031], indem die Zuverlässigkeit des Wandlers erhalten werden soll:
129„[0023] Es ist wünschenswert, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Schützen von Schaltelementen eines Wandlers vor transienten Spannungen zur Verfügung zu haben, um schnelle verlustarme Schaltvorgänge ohne Verschlechterung der Zuverlässigkeit zu ermöglichen. Als weiteren Hintergrund wird auf die folgenden veröffentlichten Patentanmeldungen verwiesen.
130[0031] Die beschriebenen Ausführungsformen umfassen Vorkehrungen zum Schutz der Schaltelemente des Wandlers vor transienten Spannungen, um schnelle verlustarme Schaltvorgänge ohne Verschlechterung der Zuverlässigkeit zu ermöglichen.“
131Nur eine Zerstörung der Schaltelemente und damit der Funktionstüchtigkeit des Wandlers zu verhindern, ist nicht das Ziel der klagepatentgemäßen Lehre.
132Aus den Abs. [0066] f. wird zugleich ersichtlich, dass die Spannungsspitzen in Relation zur verarbeitbaren Versorgungsspannung der Schalterbauelemente gesetzt werden. Dies wirkt sich auf die relevante Anordnung der Spitzenschutzschaltung am Eingang (at the input) aus. Denn, da diejenige Spannung verändert werden soll, die auf die Schaltelemente einwirkt, ist die Positionierung der Spitzenschutzschaltung im Eingangsbereich der Schaltelemente beansprucht.
133Die Beschreibungsstellen stützen somit das Verständnis der Positionierung am Eingang. So nimmt das Klagepatent in dem Abs. [0066] konkret die mit Vhi gekennzeichnete Spannung in den Blick, die bei einem Schaltvorgang schnell ansteigen und sich unvorteilhaft auf die Eingangsspannung in die Reglerschaltung auswirken kann. Das dient dem Fachmann als Hinweis auf die Anordnung der Spitzenschutzschaltung, da diese auch die durch Vorrichtungskomponenten selbst verursachte Spannung bereinigen soll. Denn andernfalls fließt sie in die Eingangsspannung ein, die in den Schaltelementen angelangt und sich dort schädigend auswirken kann.
134Einen Hinweis auf die konkrete Positionierung in einem Schaltkreis bietet zudem Abs. [0068], wo ausgeführt ist:
135„Idealerweise beinhaltet der Spitzenschutz kapazitive Elemente zwischen der ersten Spannungsversorgung und der zweiten Spannungsversorgung, die zuvor beschrieben wurden.“
136Der Abs. [0034] liefert Hinweise darauf, wie das Klagepatent die zuvor genannte erste und zweite Spannungsversorgung bezeichnet, nämlich als Vhi und Vloc.
137Zur Anordnung der Spitzenschutzschaltung am Eingang der Spannungsreglermodusschaltung erhält der Fachmann aus Abs. [0069] einen weiteren Hinweis:
138„Die Spitzenschutzschaltung 1910 stellt eine Ladungsspeicherschaltung zwischen der ersten Spannungsversorgung (Stromversorgung) und der zweiten Spannungsversorgung (Stromversorgung) bereit. Wie gezeigt, befindet sich die Spitzenschutzschaltung 1910 auf derselben integrierten Schaltung 1930 wie die Reihen- und Nebenschaltelemente. Die Ladungsspeicherschaltungen enthalten kapazitive Elemente (CSP), die auf derselben integrierten Schaltung angeordnet sind wie das Reihenschaltelement und das Nebenschaltelement, und zwar neben sowohl dem Reihenschaltelement als auch dem Nebenschaltelement. Die integrierte Schaltung befindet sich in einer Einheit 1940. Insbesondere ist die Spitzenschutzschaltung 1910 proximal direkt auf der integrierten Schaltung 1930 platziert und kann auf beiden Seiten der Schalter-Schaltung ohne Funktionsblöcke angeordnet sein, abgesehen von Verbindungen zwischen der Schalter-Schaltung und der Spitzenschutzschaltung 1910.“
139Hier wird die Spitzenschutzschaltung derselben integrierten Schaltung zugewiesen wie auch die Schaltelemente. Wiederum wird Bezug genommen auf die erste und zweite Spannungsversorgung, zwischen derer die Ladungsspeicherschaltung angeordnet sein soll. Damit liegt die Ladungsspeicherschaltung denknotwendig auch zwischen Vin, als der Eingangsspannung in den Spannungsregler, und der Masse, gnd. Es wird aber ersichtlich, dass dies nicht die entscheidenden Bezugspunkte für die erfindungsgemäße Schutzschaltung sind. Deren beliebige Anordnung überhaupt vor dem Eingang der Schalter würde dem erfindungsgemäßen Gedanken nicht hinreichend Rechnung tragen und innerhalb des Chips auftretende störende Spannungen nicht bereinigen, womit zwar ein kompakterer Spannungsregler bereitgestellt würde, der aber erheblichen Funktionsbeeinträchtigungen ausgesetzt sein dürfte.
140Zwingende Anforderungen an eine physische Überordnung der Schutzschaltung ergeben sich aus Abs. [0069] aber ebenso wenig. Als Indiz ist dieser Beschreibung aber auch eine räumliche Nähe in der Anordnung von Schutzschaltung im Verhältnis zur Schaltmodusregleranordnung zu entnehmen.
141Diverse Beschreibungsstellen belegen vielmehr, dass das Klagepatent den Ausdruck „über hinweg“ („across“) im elektrischen Sinne benutzt, ohne (eindeutigen Hinweis) auf eine Anordnung der Vorrichtungskomponenten in bestimmten Halbleiterschichten (vgl. Abs. [0058], [0070] und [0075]). Entscheidend ist damit bei dem Verständnis des Ausdrucks „über hinweg“ die elektrische Wirkweise der Spannungsspitzenschutzschaltung, welche die Schaltelemente umfassen/einbeziehen soll.
142Die Figuren des Klagepatents bieten weitere Unterstützung für das Verständnis, dass die Spitzenschutzschaltung Maximalwerte verhindern soll und dafür eine entsprechende Anordnung erfahren muss. Dass dies einer bestimmten physischen Ausgestaltung bedarf, neben der erforderlichen Anordnung derart am Eingang, dass parasitäre Induktivität berücksichtigt wird, lässt sich den Figuren nicht entnehmen. Die Figuren 12 und 19 zeigen die Spitzenschutzschaltung jeweils in einer Parallelschaltung zwischen den Potentialknoten Vloc und Vhi und nicht irgendwo zwischen der Eingangsspannung Vin und der Ableitung zur Masse. Die Figur 18 veranschaulicht Spannungsspitzen, die auftreten, wenn gerade keine Spannungsspitzenschutzschaltung integriert ist. Die gemessenen Spannungswerte beziehen sich auf diejenige Höchstspannung, auf die die Schaltblocksegmente insgesamt, sprich die Schaltmodusreglerschaltung, ausgelegt sind. Zur Ermittlung des Maximalwerts wird nicht etwa auf jedes einzelne Schaltblocksegment abgestellt. Die Umklammerung der Segmente und der Buchstabe „V“ stehen für die einheitliche Betrachtung. Dies deckt sich auch mit der etwa in den Figuren 10 und 12 enthaltenen Abbildung der Ausgangsinduktivität. Es ist nur eine Ausgangsinduktivität gezeigt, in die sämtliche Leitungen münden, bevor die elektrische Last mit Spannung versorgt wird.
143Abschließend bestätigen auch funktionale Erwägungen das dargestellte Verständnis. Denn technisch-funktional erklärt sich die Anordnung am Eingang der Reglerschaltung zum einen dadurch, dass dort lokale elektrische Schwingungen auftreten können, die gedämpft werden sollen. Zum anderen sind die Schaltelemente auf bestimmte Spannungswerte ausgelegt, sodass bei einer bedeutenden und/oder konstanten Überschreitung dieser Grenze Beeinträchtigungen in der Funktionsfähigkeit des Spannungsreglers drohen, bis hin zu dessen Zerstörung. Um einen Transistor zu schützen, stellen deshalb dessen Spannungsobergrenzen technisch funktional einen validen Anhaltspunkt dar, an dem sich die weiteren Komponenten der Vorrichtung orientieren und messen lassen müssen. Es ist sinnvoll, die Schutzschaltung so zu positionieren am Eingang der Schaltanordnung, dass auch diese störenden Überschwingungen einbezogen werden.
144Der Fachmann versteht überdies aus der Ausgestaltung der Ladungsspeicherschaltung als Kondensator sowie deren Anordnung am Eingang der Schaltmodusreglerschaltung, dass die in die Schaltelemente eingehende Spannung beeinflusst werden soll und zwar so, dass zu hohe Werte eliminiert werden. Der dazu eingesetzte Kondensator soll also nicht einen Ausgleich der Spannung bei Spannungsschwankungen bieten, indem er Spannung puffert und sodann zur Verfügung stellt, sondern überschüssige Spannung verarbeiten. Solche Kondensatoren waren im Stand der Technik bekannt und wurden als Entkopplungskondensatoren bezeichnet. Entscheidend für einen klagepatentgemäßen Kondensator ist damit seine funktionelle Ausrichtung und nicht dessen Bezeichnung, weil die allenfalls ein Indiz auf die technische Funktion ist.
145b.
146In Merkmal c3 werden, nachdem zuvor insbesondere die Anordnung und die Ausrichtung der Spitzenschutzschaltung thematisiert wurden, Bestandteile der Spannungsspitzenschutzschaltung angeführt. Eine erfindungsgemäße Spitzenschaltung soll ein dissipatives Element und eine Ladungsspeicherschaltung umfassen.
147Das Klagepatent verlangt das Vorhandensein eines dissipativen Elements, wobei dessen räumlich-körperliche Ausgestaltung nach Anspruch 1 sowohl als eigene Komponente innerhalb der Schutzschaltung als auch als in einen Kondensator integrierten Bestandteil möglich ist. Es genügt, die Funktionalität des dissipativen Elements, einen elektrischen Widerstand bereitzustellen, in den Kondensator zu implementieren, durch den die Ladungsspeicherschaltung umgesetzt wird. Das dissipative Element, ob selbständig oder integriert, muss so dimensioniert sein, dass Überspannungen und ein Reihenresonanzkreis, ausgelöst durch die parasitären Induktivitäten erfolgreich eliminiert wird.
148Der Anspruch benennt nebeneinander eine Ladungsspeicherschaltung und ein dissipatives Element, ohne aber für diese Bauteile konkrete räumlich-körperliche Anforderungen aufzustellen. Beansprucht werden nur zwei unterschiedliche Komponenten mit verschiedenen Funktionen in einem elektrischen Schaltkreis, die der Schutzschaltung zugewiesen sind („umfassend“). Daraus ergeben sich keine Anhaltspunkte für ein Verständnis, dass das dissipative Element auch einer eigenständigen räumlich-körperlichen Ausgestaltung bedürfte, um technisch wirksam zu sein. Dem Anspruch ist nicht zu entnehmen, welchen Vorteil ein selbständiges dissipatives Element gegenüber der bloßen Bereitstellung derselben technischen Beschaffenheit durch die Integration eines elektrischen Widerstands in einen Kondensator aufweisen sollte.
149Die separate Benennung des dissipativen Elements im Anspruch wird bei einem solchen Verständnis nicht obsolet, sondern hebt gerade die technische Bedeutung dieses Bauteils hervor – losgelöst von der technischen Möglichkeit, das dissipative Element mit der Ladungsspeicherschaltung zu kombinieren und beide Bauteile innerhalb desselben Kondensators zusammenzufassen. Denn dabei handelt es sich letztlich um eine dem Fachmann obliegende Anweisung, einen elektrischen Widerstand in eine Vorrichtung zu integrieren; dass ein Bedürfnis an einer Implementierung eines spezifischen Widerstandes besteht, gibt der Anspruch aber klar vor. Dies ist die technisch zwingende Konsequenz der von der erfindungsgemäßen Lehre vorgeschlagenen Lösung, einen Spannungsspitzenschutz bereitzustellen.
150Außerdem unterstützt die Klagepatentbeschreibung das dargestellte Verständnis. In den Beschreibungsstellen finden sich sowohl Hinweise auf ein selbständig vorhandenes dissipatives Element als auch auf dessen Unterbringung in der Ladungsspeicherschutzanordnung. Der Fachmann entnimmt den Ausführungen daher, dass ein separates dissipatives Element nicht die einzige Ausgestaltungsmöglichkeit ist.
151In Abs. [0070] f. erläutert das Klagepatent ausführlich, weshalb Bedarf an einem dissipativen Element besteht und dass es dazu dient, aufkommende Überschwingungen (auch als „Ringing“ bezeichnet) in den Reihen-/Nebenschalttransistoren zu eliminieren. Dies bewahrt den Betrieb eines Spannungsreglers vor Störungen. Wörtlich heißt es:
152„Es ist wichtig zu beachten, dass die Spitzenschutzkapazität in Abwesenheit der dissipativen Impedanz, die in Fig. 19 durch Rsp in vereinfachter Form dargestellt ist, einen Reihenresonanzkreis mit hohem Qualitätsfaktor (Hoch-Q) mit den parasitären Induktivitäten Lpar,pk und Lintl bilden kann, wobei Lintl eine parasitäre Induktivität der internen On-Chip-Schaltung ist. Die Reaktion einer solchen Schaltung auf eine Stufenfunktionsanregung, wie sie gewissermaßen bereitgestellt wird, wenn der Reihenschalter plötzlich von EIN zu AUS übergeht, führt zu einer anhaltenden sinusförmigen Spannung bei der Resonanzfrequenz, wie in Fig. 18 dargestellt. Außerdem kann die Größe dieser Resonanzspannung über jede Reihenkomponente hinweg die Größe der Gesamtspannung über den Resonator hinweg weit überschreiten. Die sinusförmige Spannung bleibt bestehen, bis ihre Energie durch Verluste innerhalb des Resonators oder zugehöriger Bauteile abgeführt wird. Dies ist eine höchst unerwünschte Situation, da jede Auslenkung der Knotenspannung eine zusätzliche Belastung für die Reihen- und/oder Nebenschalttransistoren hervorruft und Überschwingungen auch zu Störungen des Betriebs benachbarter Schaltkreise sowohl im DC/DC-Wandler als auch in anderen Schaltkreisen am gleichen Chip führen können, wenn der Wandler Teil eines integrierten Systems ist. Überschwingungen könnten auch zu einem Verlust an Wirkungsgrad führen, wenn die Überschwingungen auf das Öffnen oder Schließen eines der Schalter zeitlich schlecht abgestimmt sind. Daher ist es wichtig, ein dissipatives Element in die Spitzenschutzimpedanz einzubauen, schematisch repräsentiert durch Rsp, um unerwünschtes Überschwingen in der Spitzenschutzschaltung zu minimieren. Das bedeutet, dass das dissipative Element Überschwingen einer Stromversorgung der Reglerschaltung dämpft.“
153Die Beschreibungsstelle spricht von einem dissipativen Element in Alleinstellung und seiner separaten Darstellung „Rsp“ in den Figuren. Eine Zusammenfassung mit anderen Vorrichtungskomponenten ist an dieser Stelle nicht zu erkennen, Gründe, die dagegensprechen aber ebenso wenig. Dass Abs. [0070] keine dahingehenden Vorgaben macht, ergibt sich im Übrigen daraus, dass er lediglich den funktionalen Bedarf eines elektrischen Widerstandes erläutert, ohne räumlich-körperliche Voraussetzungen aufzustellen. Überdies handelt es sich bei den Figuren um eine sehr schematische Darstellung, welche keinen zwingenden Rückschluss auf die räumlich-körperliche Ausgestaltung zulässt.
154In diesem Lichte ist auch Abs. [0076] zu verstehen, dem ebenso wenig ein ausschließliches Anspruchsverständnis für ein separat vorliegendes dissipatives Element zu entnehmen ist. Dort wird ausgeführt:
155„Dissipative Elemente Rsp können in Reihe mit den Kondensatoren eingebaut werden. Diese dissipativen Elemente können als Polysilizium-Widerstände, metallische Dünnfilm-Widerstände oder andere geeignete Widerstandselement realisiert werden. Der äquivalente Reihenwiderstand, der den Kondensatorstrukturen zugeordnet ist, variiert je nach dem verwendeten Verfahren und der Vorgehensweise bei der Herstellung der Kondensatoren und kann in einigen Fällen so groß sein, dass keine zusätzlichen dissipativen Elemente erforderlich sind.“
156Hierin beschreibt das Klagepatent im ersten Satz, wie ein dissipatives Element in eine Vorrichtung integriert werden kann und aus welchen Materialien es bestehen kann. Es kann in Reihe mit den Kondensatoren eingebaut werden, was eine Differenzierung dieser beiden Komponenten bedeutet, die dann in ein bestimmtes Schaltungsverhältnis zueinander gesetzt werden. Dies ist nur mit einem räumlich-körperlich eigenständigen dissipativen Element möglich. Neben dem eigentlichen dissipativen Element beschreibt das Klagepatent einen äquivalenten Reihenwiderstand, der sich dadurch von einem dissipativen Element unterscheidet, dass er (von vornherein) den Kondensatoren zugeordnet wird. Möglich ist es zudem, diesen Reihenwiderstand so zu dimensionieren, dass keine zusätzlichen dissipativen Elemente erforderlich sind. Damit zeigt das Klagepatent dem Fachmann grundsätzlich zwei Wege auf, einen hinreichenden Widerstand in eine erfindungsgemäße Vorrichtung zu implementieren. Einen qualitativen Unterschied macht das Klagepatent zwischen diesen beiden Ausgestaltungsmöglichkeiten nicht. Das Klagepatent bezeichnet den in einem Kondensator realisierten Reihenwiderstand als „äquivalent“, was deutlich macht, dass es sich zwar nicht um dieselbe, aber um eine gleichwertige alternative bzw. entsprechende Ausgestaltung handelt. Für diesen Fall ist dem Abs. [0076] zu entnehmen, dass es eben keines separaten anderen („zusätzlichen“) dissipativen Elements bedarf.
157Etwas anderes ist entgegen der Auffassung der Beklagten nicht dem Abs. [0071] zu entnehmen, welcher sich mit einer ausreichenden Dimensionierung eines dissipativen Elements befasst. Es werden Kriterien aufgestellt, anhand derer der Fachmann die Größe des elektrischen Widerstands wählen kann, um einen effektiven Schutz vor Überschwingungen bereitzustellen. Zu Anforderungen in räumlich-körperlicher Hinsicht, um eine solche Bestimmung vorzunehmen, äußert sich der Abs. [0071] jedoch nicht und es sind keine technischen Gründe ersichtlich – und auch von der Beklagten nicht angeführt worden –, weshalb die Wertbemessung des dissipativen Elements bei seiner Integration in einen Kondensator Schwierigkeiten bereiten sollte.
158Vor diesem Hintergrund schlägt Abs. [0076] auch nicht bloß zwei Ausgestaltungsmöglichkeiten für einen elektrischen Widerstand vor, wobei sich der Anspruch in Merkmal c3 auf eine Variante festgelegt hätte. Auch der Anspruch umfasst beide der in Abs. [0076] genannten Formen des dissipativen Elements.
159Der abhängige Unteranspruch 2 bestärkt den Fachmann in dem Verständnis, dass nach Anspruch 1 ein separat ausgebildetes dissipatives Element vorgesehen sein kann, aber nicht muss. Denn erst dieser Unteranspruch eröffnet die Möglichkeit, den die Ladungsspeicherungsschaltung bildenden Kondensator so auszugestalten, dass er wenigstens einen Abschnitt des dissipativen Elements beinhaltet. Denkbar und zulässig wäre danach auch eine Vorrichtung mit einem Kondensator, der das dissipative Element insgesamt umfasst („wenigstens“). Die Aufzählung in Merkmal c3 verlöre aber ihre Bedeutung, wenn schon sie dieses Verständnis zulassen würde. Außerdem spricht die Formulierung in Unteranspruch 2 auch deshalb für ein eigens ausgebildetes dissipatives Element in Anspruch 1, da auf einen „Abschnitt“ dieses Elements Bezug genommen wird. Ein Abschnitt bedeutet eine räumlich-körperliche Ausprägung, die gegenüber anderen Komponenten abgrenzbar ist. Somit zeigt der Unteranspruch 2, dass das Klagepatent die Kombination verschiedener Funktionalitäten in einem Bauteil genau dort beansprucht, wo sie auch beabsichtigt ist. Der einschränkende Gehalt des abhängigen Unteranspruchs 2 liegt zumindest in der Konkretisierung des Materials, das für den Kondensator eingesetzt werden soll.
160Diesem Verständnis stehen die Unteransprüche 8, 11 und 12 mit der darin thematisierten Möglichkeit, einen Widerstandswert zu bestimmen und festzulegen, nicht entgegen. Ihnen ist nicht zu entnehmen, dass für deren Umsetzung das Vorliegen eines selbständigen dissipativen Elements notwendig wäre. Denn auch einem integrierten Widerstand kann aufgrund der Parameter der Vorrichtung ein bestimmter Wert zugewiesen werden. Insoweit gelten die Ausführungen zu Abs. [0071] der Klagepatentschrift entsprechend. Die Beklagte hat auch im Zusammenhang mit diesen Unteransprüchen nicht dargelegt, weshalb die Bestimmung des dissipativen Elements dem Zufall überlassen bleiben sollte. Diese These würde vielmehr nahelegen, dass die Dimensionierung eines Kondensators technisch gar nicht möglich ist. Dieser Ansatz ist aber nicht haltbar, weil dann kein Halbleiter und Kleinstbauteil sicher funktionieren könnte.
161Die Figuren des Klagepatents belegen das erläuterte Verständnis, indem auch sie kein eindeutiges Verständnis für eine ausschließlich räumlich-körperlich eigenständige Variante des dissipativen Elements zulassen. So zeigt Figur 19 in vereinfachter Form eine Impedanz Rsp. Auch die Figur 20 zeigt ein dissipatives Element, das neben dem Zeichen Csp für die Ladungsspeicherungsschaltung abgebildet ist. Diese separaten Zeichen können dem Fachmann ein Hinweis auf die auch körperliche separate Ausbildung dieses Elements sein. Zwingend ist dieser Rückschluss jedoch nicht, weil die Schaltdiagramme eine schematische Wiedergabe der Schaltungen einer erfindungsgemäßen Vorrichtung sind und insbesondere die technischen Anforderungen skizzieren sollen.
162In technisch-funktionaler Hinsicht finden sich schließlich ebenso Argumente für das skizzierte Verständnis. Denn es fehlen Erkenntnisse, dass ein in einer Ladungsspeicherschaltung untergebrachter gegenüber einem eigenständigen Widerstand die Funktionsfähigkeit der Vorrichtung nur schlechter absichern könnte und deshalb nachteilig gegenüber einem separaten dissipativen Element ist.
1633.
164Das Merkmal e. verlangt für eine erfindungsgemäße Vorrichtung ferner, dass die Reihen- und Nebenwiderstandsschaltelemente der Schaltmodusreglerschaltung in verbundene Schaltblocksegmente unterteilt werden.
165Darunter versteht das Klagepatent eine Aufteilung einer Schaltmodusreglerschaltung in mehrere kleinere, parallel geschaltete Untereinheiten, die jeweils aus einem Reihen- und Nebenwiderstandsschaltelement bestehen. In ihrer Gesamtheit bilden sie eine erfindungsgemäße Schaltmodusreglerschaltung. Es wird diejenige Ausgangsspannung auf die einzelnen Segmente aufgeteilt, die während einer Phase/zu derselben Zeit an der Schaltmodusreglerschaltung angelangt. Nur bei einer parallelen Schaltung der Schaltblocksegmente für dieselbe Zeit kommt die den Segmenten zugedachte Entlastungsfunktion zum Tragen, welche es zudem ermöglicht, die Kondensatoren der Spannungsspitzenschutzschaltung so zu dimensionieren, dass sie nur eine geringe parasitäre Induktivität erzeugen.
166Schon dem Anspruch ist ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den Schaltblocksegmenten und der Schaltmodusreglerschaltung mit Reihen- und Nebenwiderstandsschaltelementen zu entnehmen. Die Schaltblocksegmente sollen diejenigen (aktiven) Bauteile beinhalten, aus denen sich die Schaltmodusreglerschaltung zusammensetzt. Ein „Schaltblocksegment“ soll auf einen Schaltvorgang ausgelegt und dafür technisch-funktional ausgebildet sein. Die einzelnen derart segmentierten Teilströme münden in eine gemeinsame Ausgangsinduktivität zur Versorgung der elektrischen Last. Zuzugeben ist der Beklagten, dass die zitierten Beschreibungsstellen ebenso wenig wie der Anspruch ausdrücklich verlangen, dass die Schaltblocksegmente für dieselbe Phase vorgesehen sein müssen bzw. in dieselbe Ausgangsinduktivität münden. Dies ergibt sich aber aus dem Gesamtzusammenhang der erfindungsgemäßen Lehre und insbesondere dem zu lösenden technischen Problem.
167Der vom Klagepatent zur Verfügung gestellte Spannungsregler soll im Schaltmodus betrieben werden und eine elektrische Last mit einer konstanten Spannung versorgen. Die Ausführungen im Klagepatent lassen schon nicht erkennen, dass der Aufbau eines Spannungsreglers über mehrere verschiedene Phasen hinweg erläutert wird und technisch Geltung haben soll. Die vom Klagepatent adressierten Problemstellungen ergeben sich vielmehr dann, wenn im Spannungsregler eine Eingangsspannung verarbeitet und gewandelt werden soll. Das Klagepatent hat bei der Bereitstellung seiner Vorrichtung vor Augen, die physische Größe einzelner Reglerkomponenten zu reduzieren, aber störende Faktoren ebenso limitiert zu halten. Betrachtet werden die einem Spannungsregler bei der Wandlung immanenten Vorgänge – vor allem die durch die verschalteten Komponenten verursachten parasitären Induktivitäten – die sich auf eine bestimmte Eingangsspannung zu einer bestimmten Zeit beziehen.
168Dieses Verständnis findet Bekräftigung in den Beschreibungsstellen des Klagepatents. Hierzu skizziert das Klagepatent zunächst in Abs. [0077] nochmals die Problematik, zu deren Beseitigung die Schaltblocksegmente beitragen sollen:
169„Bei zunehmendem Maximalstrom wird es jedoch schwierig, einen einzigen Kondensator mit ausreichend niedriger Induktivität zu konstruieren. So muss beispielweise bei einer Verdoppelung des maximalen Ausgangsstroms die Schutzkapazität verdoppelt, die Induktivität (die mit der Kapazität skaliert) jedoch halbiert werden. Bei jeder gegebenen Technologie und Kondensatorstruktur und -anordnung wird ein Ausgangsstrom erreicht, bei dem die parasitäre Induktivität zu groß wird.“
170Die Bezugnahme dieses Beschreibungsabsatzes auf einen Maximalstrom sowie einen Ausgangsstrom zeigt, dass eine bestimmte Phase und der darin zu wandelnde Strom betrachtet werden. Darauf, dass ein Ausgangsstrom ausgegeben wird, soll kein Einfluss genommen werden durch die Segmentierung.
171In Abs. [0078] heißt es dann weiter:
172„Dieses Problem kann dadurch gelöst werden, dass die Schaltelemente der Schalter-Schaltung 301 und 302 weiter in parallel geschaltete Segmente (Schaltblocksegmente) unterteilt werden, so dass jedes Segment einen Teil des gesamten Ausgangsstroms führt, und dass die Schutzschaltung Csp-Rsp weiter in separate Segmente unterteilt wird, die jeweils eines der Schaltblocksegmente schützen.“
173Hieraus ersieht der Fachmann wiederum den Bezug aller Segmente zu demselben Ausgangstrom, welcher auf diese Segmente verteilt werden soll. Dies dient dazu, dass auch der Strom, der jeder Kapazität, also der als Kondensator ausgebildeten Ladungsspeicherschaltung, zugeteilt würde, verringert wird. Deshalb kann die Kapazität verkleinert werden, was zu einer geringeren parasitären Induktivität führt. Dies bietet insgesamt einen besseren Schutz vor Spannungsspitzen. In Abs. [0079] ist dazu ausgeführt:
174„Ein Beispiel ist in Fig. 21 dargestellt, in der die Schalter-Schaltung (die Schaltelemente) 301 und 302 in eine Reihe von Schaltblocksegmenten 2120, 2130, 2140 usw. unterteilt ist und jedem Segment Schutzschaltungsblöcke, wie z.B. 2121 und 2122, zugeordnet sind. In dieser Konfiguration wird der maximale Strom, der jeder Kapazitätsstruktur zugeordnet ist, reduziert (um einen Faktor n, wenn n Blöcke vorhanden sind), und somit wird die erforderliche physikalische Größe ausreichend verringert, um die parasitäre Induktivität zu minimieren. Im Allgemeinen wird der Gesamtausgangsstrom ungefähr zu gleichen Teilen zwischen den verschiedenen Segmenten der Schalter-Schaltung aufgeteilt […].“
175Die Verteilung eines Stroms auf die Segmente, der zu einer bestimmten Zeit/Phase in dem Spannungsregler zu wandeln ist, ergibt sich ferner aus Abs. [0080]:
176„Eine beispielhafte Implementierung eines solchen segmentierten Wandlers ist in Fig. 22 schematisch dargestellt. In dem Ausführungsbeispiel stellen vier Segmente 2220, 2230, 2240 und 2250 jeweils einen maximalen Ausgangsstrom von 150 mA für einen maximalen Ausgangsstrom von insgesamt 600 mA bereit. Bei einer Ausführungsform ist jedes Segment etwa 400 Mikrometer hoch und hat drei Kontakte, die für das Segment 2220 als 2221, 2222 und 2223 dargestellt sind und mit der Versorgungsspannung Vhi, dem Ausgangsinduktor (der den Strom Iout führt) bzw. der lokalen Masseverbindung Vloc verbunden sind.“
177Danach verfügt jedes Segment über eine eigene Verbindung zum Ausgangsinduktor.
178Die Figuren 18 und 20 zeigen in derselben Weise ausgebildete Schaltblockelemente. Deren parallele Schaltung ist zu erkennen. Die diese Segmente umfassende eckige Klammer mit dem Buchstaben „V“ zeigt, dass auf diese einzelnen Teile einer Schaltmodusreglerschaltung der Eingangsstrom verteilt wurde und anschließend wieder zusammengeführt wird. Dementsprechend sind in Abs. [0074], der die Figur 20 erläutert, auch Spannungswerte für den „gesamten Wandler“ angegeben. Es wird ausdrücklich auf seine Funktionsweise beim Umschalten eines Versorgungsstroms abgestellt. Dies kann aber immer nur der Eingangsstrom pro Phase sein, da verschiedene Phasen nicht gemeinsam betrachtet würden. Anderes vermag die Kammer nicht festzustellen. Die Figur 21 zeigt den Leitungsverlauf von den einzelnen Schaltblocksegmenten und macht deutlich, dass es sich zunächst um einen Teil des Eingangsstroms handelt (lout/n), der schließlich aber in dieselbe und einzige Ausgangsinduktivität geführt wird.
179Die Beklagte hat keinerlei Argumente angeführt, die unter technischen Gesichtspunkten erläutern würden, dass auch über unterschiedliche Phasen hinweg eine erfindungsgemäße Ausgestaltung funktionstüchtig wäre und den gewünschten Vorteil bringen könnte. Zudem bezieht sie sich bei ihren Ausführungen zu einer verschachtelten Anordnung (Merkmal f) auf ein fachmännisches Verständnis, das von 3 Leitern pro Phase spricht und diese Leiter untereinander verschachtelt. Dies zeigt, dass die Auslegung der Komponenten innerhalb einer Vorrichtung auf bestimmte Strom- und Spannungsverhältnisse auf dieselbe Phase bezogen sind.
180Überdies unterstützt die Anspruchssystematik in Merkmal f das Verständnis. Denn nicht nur die Reihen- und Nebenwiderstandsschaltelemente sollen unterteilt werden, sondern auch die Ladungsspeicherschaltung. Deren Reduzierung und Untergliederung dient, wie erläutert, der Verringerung der parasitären Induktivität; hat aber andererseits zur Folge, dass sie nur noch eine kleinere Kapazität zur Verfügung stellen kann. Auf reguläre Schaltmodusreglerschaltungen, die auf den gesamten Eingangsstrom bezogen sind, können solche Kondensatoren nicht angewendet werden. Sie sind technisch nur effektiv, wenn ebenso der Eingangsstrom aufgeteilt wird. Auch für die Ladungsspeicherschaltungssegmente ist nicht zu ersehen, dass sie phasenübergreifend arbeiten sollten.
1815.
182Das Klagepatent beansprucht in Merkmal f schließlich, die Ladungsspeicherschaltung der Spannungsspitzenschutzschaltung in verbundene Ladungsspeicherschaltungssegmente zu unterteilen, die zwischen den Schaltblocksegmenten verschachtelt sind.
183Ein anspruchsgemäßes Ladungsspeicherschaltungssegment bezeichnet eine Untereinheit einer Spannungsspitzenschutzeinheit, die zum Spannungsspitzenschützen geeignet ist. Inwieweit dieses Segment auch das für einen wirksamen Spannungsspitzenschutz erforderliche dissipative Element aufweisen muss (vgl. BPatG-Beschluss, S. 13), bedarf hier keiner Klärung, da die angegriffenen Kondensatoren ein dissipatives Element und damit sogar unter Umständen mehr beinhalten als nach der erfindungsgemäßen Lehre notwendig wäre.
184Unter der verschachtelten Anordnung der Ladungsspeicherschaltungssegmente mit den Schaltblocksegmenten versteht das Klagepatent eine alternierende Anordnung dieser Bauteile, die zu kurzen elektronischen Verbindungen zwischen einem Schaltblocksegment und einem Ladungsspeicherschaltungssegment führt. Auch ohne ein spezifisches festes Muster zu verlangen, werden zumindest solche äußerlichen Anforderungen an das Layout gestellt, die zu der elektronischen Nähe der Bauteile führen, indem eine klare Zuordnung eines Ladungsspeicherschaltungssegments zu einem Schaltblocksegment erfolgt, mithin eine Verschachtelung im elektrischen Sinn vorliegt. Erforderlich ist dafür die Zuordnung mindestens eines Ladungsspeicherschaltungssegments zu einem Schaltblocksegment derart, dass das Segment der Schutzschaltung in kurzem zeitlichen Abstand auf eine auftretende Spannungsspitze reagieren kann. Es muss räumlich näher an dem zu schützenden Schaltblocksegment liegen als an anderen Schaltblocksegmenten. Jedenfalls grenzt sich das Klagepatent von einer in zeitlicher Hinsicht verstandenen Verschachtelung ab (vgl. BPatG-Beschluss, S. 13, 17).
185Aus dem Wortsinn von „verschachtelt“ folgt nicht das Erfordernis eines spezifischen, zwingend wiederkehrenden Musters für eine Verschachtelung. Denn dem reinen sprachlichen Verständnis nach bedeutet „verschachtelt“ „wie ineinandergefügt, ineinandergeschoben wirkend“. Die gewählte deutsche Übersetzung mit „verschachtelt“ ist damit eine genaue Wiedergabe des originalen englischen Wortlauts, wo es „interleaved“ heißt.
186Der Anspruch macht deutlich, dass eine Verschachtelung zwischen den Ladungsspeichersegmenten und den Schaltblocksegmenten bestehen soll. Indem die Ladungsspeichersegmente zwischen den Schaltblocksegmenten verschachtelt sein sollen, wird die angestrebte räumlich-körperliche Trennung, zumindest realisiert durch entsprechende elektronische Schaltwege, der einzelnen Schaltblocksegmente voneinander erreicht. Der Anspruch lässt im Übrigen offen, wie die Verschachtelung in physischer Hinsicht auszugestalten ist und gibt nicht vor, ob bei einer Draufsicht in verschiedenen Sichtachsen eine Verschachtelung der Segmente erkennbar sein muss. Insoweit macht es nach Ansicht der Kammer auch keinen technisch relevanten Unterschied, ob die Ladungsspeichersegmente zwischen den Schaltblocksegmenten verschachtelt sind, oder die Schaltblocksegmente zwischen den Ladungsspeichersegmenten. Diese Ausgestaltungen bedingen einander. Wenn die Ladungsspeichersegmente zwischen den Schaltblöcken liegen, liegen die Schaltblöcke ihrerseits zwischen den Ladungsspeichersegmenten. Hierfür ist es außerdem unerheblich, wie viele der jeweiligen Segmente jeweils zwischen den anderen liegen, da auch bei einer Verteilung von 2:1, wie sie etwa in der Figur 21 dargestellt ist, die maßgebliche alternierende Anordnung gegeben ist.
187Die Beschreibungsstellen bestärken den Fachmann in dem Verständnis, dass für eine Verschachtelung kein konkretes Anordnungsmuster eingehalten werden muss. Vielmehr erläutert die Klagepatentschrift die Bedeutung der Segmentierung der Schaltmodusregleranordnung sowie der Spitzenschutzschaltung und setzt diese so erhaltenen Unterteilungen insbesondere in elektrotechnischen Bezug zueinander. Der Schutz vor Spannungsspitzen der Schaltblocksegmente durch ein entsprechendes Ladungsspeicherschaltungssegment ist entscheidend. Dazu trägt auch eine Anordnung der Komponenten in der integrierten Schaltung bzw. durch entsprechende Verschaltungen bei. Zwingende Vorgaben für eine räumliche Anordnung stellt das Klagepatent jedoch nicht auf.
188So besagt Abs. [0074]:
189„In der beispielhaften Ausführung, deren Simulationsergebnisse in Fig. 20 dargestellt sind, sind die Schalter-Schaltung und die zugehörige Spitzenschutzschaltung in vier Segmente unterteilt, wie an anderer Stelle beschrieben.“
190Hierin nimmt das Klagepatent eine Unterteilung der Schalter-Schaltung und Spitzenschutzschaltung in je vier Segmente vor. Zudem erkennt der Fachmann eine Zuordnung von Schaltungssegmenten zur Spitzenschutzschaltung („zugehörige“), welche sich in der Figur 20 insbesondere durch eine räumliche Nähe und dadurch ermöglichte kurze elektrische Zuleitungen auszeichnet. Hinweise darauf, dass der Zuordnung ein bestimmtes Muster zugrunde liegen müsste, ergeben sich aus dieser grundsätzlichen Beziehung zwischen diesen Vorrichtungselementen nicht.
191Die Abs. [0078] und Abs. [0079] geben weitere Hinweise auf Anordnungsmöglichkeiten der unterschiedlichen Segmente, sodass eine anspruchsgemäße Verschachtelung entsteht. Beschrieben wird ein Lösungsansatz für Spannungsspitzenschutz, der den von den Kondensatoren verursachten parasitären Induktivitäten durch eine Aufgliederung bestimmter Vorrichtungskomponenten Rechnung trägt:
192„Dieses Problem kann dadurch gelöst werden, dass die Schaltelemente der Schalter-Schaltung 301 und 302 weiter in parallel geschaltete Segmente (Schaltblocksegmente) unterteilt werden, so dass jedes Segment einen Teil des gesamten Ausgangsstroms führt, und dass die Schutzschaltung Csp-Rsp weiter in separate Segmente unterteilt wird, die jeweils eines der Schaltblocksegmente schützen. In einer Ausführungsform ist der Schutzschaltkreis weiter unterteilt, so dass ein Abschnitt der Schutzschaltung an jeder Seite des Schalter-Schaltungssegments und gegebenenfalls an anderen geeigneten Stellen in der Nähe der Schalter selbst angeordnet ist. Bei einer Ausführungsform befindet sich zumindest ein Teil der Spannungsspitzenschutzschaltung zwischen den mehreren Schaltblocksegmenten. Die Spitzenschutzschaltung kann Ladungsspeicherschaltungssegmente enthalten. Eine Ausführungsform umfasst, dass jedes Ladungsspeicherschaltungssegment der Spitzenschutzschaltung physikalisch näher an dem von ihm geschützten Schaltblocksegment als an jedem anderen Schaltblocksegment angeordnet ist.“
193Ein Beispiel ist in Fig. 21 dargestellt, in der die Schalter-Schaltung (die Schaltelemente) 301 und 302 in eine Reihe von Schaltblocksegmenten 2120, 2130, 2140 usw. unterteilt ist und jedem Segment Schutzschaltungsblöcke, wie z.B. 2121 und 2122, zugeordnet sind.
194Die dargestellten bevorzugten Ausführungsformen zu der Anordnung der Segmente verdeutlichen, dass grundsätzlich ein 1:1-Schutz zwischen Schaltblocksegment und Schutzsegment gegeben sein soll, wenn sich nicht sogar je ein Abschnitt des insoweit zusätzlich unterteilten Schutzsegments an jeder Seite eines Schaltblocks befindet. Eine abschließende Vorgabe zu einem Verschachtelungsmuster lässt sich auch hier nicht feststellen. Deutlich wird aber eine erforderliche Nähe des Schutzsegments zu dem Schaltblocksegment, wobei wiederum nicht eingegrenzt wird, dass diese Nähe räumlich-körperlich hergestellt sein muss und nicht auch mittels elektrischer Verbindungen bereitgestellt werden kann. Der Fachmann versteht in diesem Zusammenhang, dass nur kurze elektrische Verbindungen für einen wirksamen Spannungsschutz in Betracht kommen. Denn nur dann ist der den Vias eigene parasitäre Widerstand gering genug, um sich nicht seinerseits störend auszuwirken.
195Entgegen der Ansicht der Beklagten ergibt sich aus diesen Ausführungen in Verbindung mit der Figur 21 auch kein Gegensatz zu den Anforderungen des Merkmals. Die Figur 21 offenbart nicht, dass die Schaltblocksegmente zwischen den Ladungsspeichersegmenten angeordnet seien, obwohl nach Merkmal f die Ladungsspeichersegmente zwischen den Schaltblocksegmenten verschachtelt sein sollten. Denn Figur 21 zeigt ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel, welches sich durch eine über die eigentliche Segmentierung der Ladungsspeicherschaltung hinausgehende Aufteilung auszeichnet und somit einem Schaltblocksegment zwei Abschnitte der Schutzschaltung zugewiesen werden. Sogar selbst dann, wenn jeder der dargestellten Abschnitte ein Ladungsspeicherschaltungssegment wäre, bestünde kein Widerspruch zum Anspruchswortlaut, weil auch dann zu erkennen ist, dass die Ladungsspeicherschaltungssegmente zwischen Schaltblocksegmenten liegen. Aus der Formulierung „zwischen verschachtelt“ ergibt sich jedenfalls nicht, dass immer nur ein Ladungsspeicherschaltungssegment zwischen den Schaltsegmenten vorgesehen werden dürfte.
196Unterstützung findet dieses Verständnis auch durch die vorläufige Meinung des BPatG. Denn danach unterfalle insbesondere die Figur 21 dem fachmännischen Verständnis, dass mehrere Ladungsspeichersegmente zwischen Schaltblocksegmenten angeordnet sind (vgl. S. 17 BPatG-B). In dieser Zusammenstellung sieht das BPatG ein anspruchsgemäßes Verschachteln. Bedenken, dass bei Anordnung zweier Abschnitte von Ladungsspeicherschaltsegmenten zwischen einem Schaltblocksegment ein „Verschachteln zwischen“ nicht mehr gegeben wäre, finden sich in den Ausführungen des BPatG nicht.
197Die Figuren des Klagepatents sprechen aus vorstehenden Erwägungen deshalb durchweg für die Ansicht, dass kein spezifisches Muster einer Verschachtelung vorgegeben ist, sondern nur die räumliche Nähe eines Schutzsegments zu einem Schaltbocksegment hergestellt sein muss. Dies ergibt sich bereits aus dem Umstand, dass die auf die Figuren bezogenen Beschreibungsabsätze keine Angaben dazu enthalten, in welcher Perspektive sie jeweils schematisch einen Spannungsregler zeigen. Anforderungen an eine optische Verschachtelung in vertikaler/horizontaler Sichtachse können daraus nicht abgeleitet werden. Die Figur 21 zeigt eine mögliche Anordnung der unterschiedlichen Segmente. Es ist zu erkennen, dass jedes Schaltblocksegment unmittelbar von Schutzsegmenten umgeben ist. Es handelt sich um eine sehr schematische Zeichnung, die vorwiegend die elektrische Schaltung veranschaulichen soll, und zudem um eine bevorzugte Ausführungsform, welche nur eine mögliche verschachtelte Ausgestaltung zeigt.
198Das erörterte Verständnis steht schließlich mit technisch-funktionalen Erwägungen in Einklang. Denn das Klagepatent will die Schaltblocksegmente vor übergroßen Eingangsspannungen bewahren, weshalb Kondensatoren mit zusätzlichen elektrischen Kapazitäten eingesetzt werden. Um diesen Schutz effektiv zu erreichen, ist es erforderlich, die Schutzsegmente besonders nah an dem Schaltsegment anzuordnen. Diese Nähe kann insbesondere durch kurze elektrischen Verbindungen hergestellt werden. Ebenfalls über die elektrischen Leitungen wird sichergestellt, dass die Schaltsegmente voneinander weiter entfernt sind als zu einem Schutzsegment.
199III.
200Vorstehend beschriebenes Verständnis zugrundlegend machen die angegriffenen Ausführungsformen von der Lehre nach dem Klagepatent Gebrauch.
2011.
202Der grundsätzliche Aufbau von X-Schaltungen, wie sie auch in den angegriffenen Prozessoren/Chips enthalten sind, ist zwischen den Parteien (weitgehend) unstreitig. In Frage stehen vielmehr die konkreten Funktionalitäten von seitens der Klägerin identifizierten Schaltungskomponenten.
203Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich in erster Linie auf den auch von den Parteien hauptsächlich erörterten Prozessor X. Soweit hinsichtlich der anderen Prozessoren relevante Unterschiede für die hier in Streit stehenden Fragen bestehen, werden diese gezielt bei der Verletzungsprüfung erörtert.
204Die Klägerin und die Laboratorien haben einen XProzessor-Chip des Typs „X“ mit vier Prozessorkernen untersucht. Daneben ergeben sich maßgebliche Erkenntnisse zur allgemeinen Funktionsweise der Prozessoren und ihrer Schaltungen aus von D stammenden Dokumenten selbst (vgl. Anlagen ES 5d, 5e).
205Der auf einer Platine angeordnete, untersuchte Chip weist äußerlich nachfolgende Strukturen auf (Abbildung 43 mit Anmerkungen der Klägerin):
206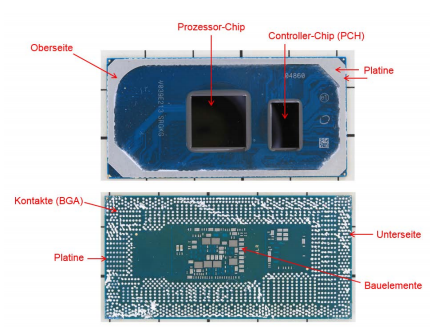
Die Schaltung dieses integrierten Spannungswandlers kann ausweislich der Anlage ES 5d wie folgt veranschaulicht werden (Abbildung aus Klageschrift nebst Bemerkungen der Klägerin):
208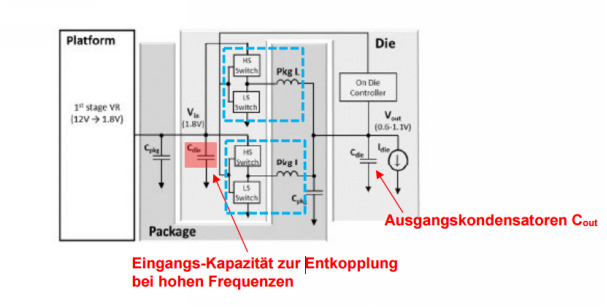
Dem obigen Schaltplan lässt sich Folgendes entnehmen: Es gibt zwei parallel geschaltete Spannungsregler-Blöcke, die jeweils mit einer Induktivität ausgangsseitig verbunden sind, deren Spannung mit Vsw gekennzeichnet ist. Nach der eigenen Beschreibung der Beklagten sind die Induktivitäten als Air-Core-Induktoren ausgestaltet. Ein Spannungsregler-Block bezieht sich auf eine Phase. Jede Phase (blauer Block) verfügt über zwei hintereinandergeschaltete Schaltelemente HS Switch und LS Switch, über denen die Eingangsspannung Vin anliegt (im obigen Schaltbild beträgt diese 1,8 V). Die Schaltelemente werden durch FETs realisiert, die in dem Chip enthalten sind. Die miteinander verbundenen Anschlüsse der Schaltelemente sind über die zugehörige Induktivität Pkg L mit dem Ausgang verbunden, an dem die Ausgangsspannung Vout bereitgestellt wird, die niedriger als die Eingangsspannung ist und im Schaltbild mit zwischen 0,6 V und 1,1 V angegeben wird. Zudem dient ein Ausgangskondensator der Stabilisierung der Spannungsversorgung der angeschlossenen Last. Bereits auf der Eingangsseite des Spannungsreglers sind Eingangs-Kondensatoren Cpkg und Cdie vorhanden. Die Kondensatoren Cpkg sind auf dem Package angeordnet und die Cdie-Kondensatoren auf dem Chip selbst. Die Cdie-Kondensatoren sind als MIM-Kondensatoren ausgebildet, wobei deren genauen technischen Funktionalitäten in Streit stehen.
210Auf einem Chip sind mehrere X enthalten, bei denen es sich – unstreitig – jeweils um einen Schaltmodus-Abwärtswandler zur Spannungsverringerung handelt, die jeweils ein oder mehrere Phasen aufweisen. Die X-Schaltungen werden jeweils für die Versorgung bestimmter Abschnitte des Mikroprozessors mit der jeweils benötigten elektrischen Leistung (Spannung, Strom) eingesetzt. In öffentlich zugänglichen Internetseiten ist die Anordnung der X wie folgt bildlich dargestellt (Abbildung 42):
211X
212Eine Mikroskopaufnahme zeigt die Ebene der Siliziumschicht des Prozessorchips und die dort angesiedelte Gesamtstruktur, wozu die oberhalb angebrachten Metallschichten sukzessiv entfernt wurden. Die insgesamt 9 Schaltkreise auf der Siliziumschicht sind gemäß der nachfolgenden Abbildung erkennbar (Abbildung 45):
213X
214Die Schaltung eines X ist nach folgendem Schaltplan ausgestaltet (Abbildung 47):
215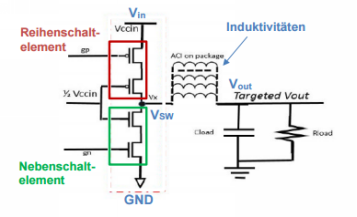
Die aus diesem Schaltplan ersichtlichen Schaltelemente (Reihenschaltelement und Nebenschaltelement) sind zwischen der Eingangsspannung Vin und der Ableitung zur Masse GND in Reihe geschaltet. Die Anschlüsse dieser Elemente sind miteinander verbunden und gehen in eine Ausgangsinduktivität (mit einer Ausgangsspannung Vout) über.
217Das Reihenschaltelement besteht aus zwei PMOS-Transistoren, die in einer sogenannten Kaskodenschaltung miteinander verschaltet sind. Das Nebenschaltelement wird durch zwei NMOS-Transistoren gebildet, die ebenfalls als Kaskodenschaltung in Reihe geschaltet sind. Reihen- und Nebenschaltelemente sind zueinander ebenfalls in Reihe geschaltet. Dies lässt sich im Schaltdiagramm wie folgt darstellen (Abbildung 58):
218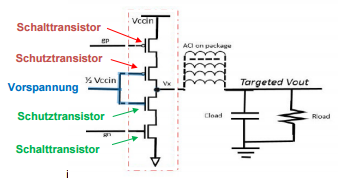
Konkret werden die Schaltelemente als Fin-FETS ausgestaltet, was eine technologische Weiterentwicklung von MOSFETs ist. Bei den Fin-FETs handelt es sich um FETs, deren Source-Drain-Kanal in Form einer Finne (wie ein Haifischflosse) ausgebildet ist, die von der Substratoberfläche des Siliziumchips nach oben absteht. Diese Finnen werden von dem Gate-Anschluss überspannt, wobei ein Gate-Anschluss in der Regel mehrere Finnen überspannt und steuert und ein FET auch mehrere parallele Gate-Anschlüsse aufweisen kann.
220Zur Veranschaulichung der angegriffenen Ausführungsform wird nachstehend ein Querschnitt eingeblendet:
221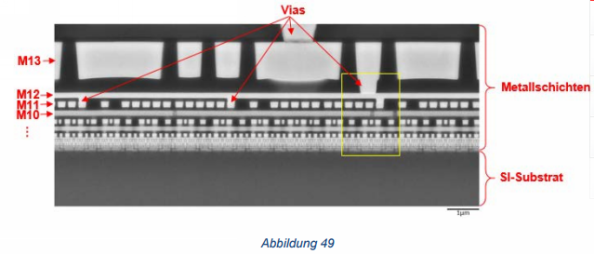
Insgesamt enthält der Prozessor-Chip des X-Prozessors 14 Metallschichten, wobei in vorstehender Abbildung die Schicht 14 entfernt wurde, die (abgesehen von den Vias) voneinander isoliert auf das Siliziumsubstrat aufgebracht worden sind. Jede Metallschicht weist in Isolatormaterial eingebettete Leiterbahnen auf. Aufeinanderfolgenden Metallschichten enthalten senkrecht zueinander verlaufende Leitbahnen (Vias). Die die Schaltelemente bildenden Fin-FETs befinden sich an der Oberfläche der Silizium-Substratschicht.
223Die Struktur der X auf der obersten Metallschicht einer angegriffenen Ausführungsform kann in einem Gesamtchip wie folgt identifiziert werden (Abbildung 51):
224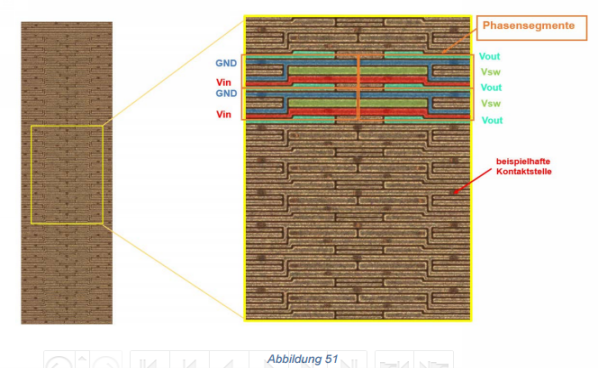
Die Klägerin unterteilt einen X weiterhin in „Phasensegmente“, wobei ein Phasensegment einem orangen Kasten in obiger Abbildung entspricht. Die sich gegenüberliegenden Phasensegmente sind jeweils einer anderen Phase zuzuordnen. Eine Phase umfasst mehrere Phasensegmente. Bezogen auf einen X mit zwei Phasen hat ein Schaltplan den nachfolgend eingeblendeten Aufbau:
226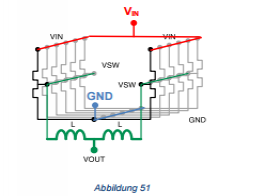
Die (hier beispielhaft angeführten) beiden Phasen liegen einander gegenüber und weisen spiegelbildlich die gleichen Komponenten auf. Ersichtlich ist, dass ein X mehrere Ausgangsinduktivitäten aufweist und jeder Phase mehrere FETs zugeordnet sind, welche ihrerseits jeweils mit einer der vorhandenen Ausgangsinduktivitäten verbunden sind. Für den Verletzungsnachweis bezogen auf einen Spannungsregler genügt daher die Betrachtung einer konkreten X-Schaltung mit ihren jeweiligen Komponenten für eine Phase, bestehend aus mehreren Phasensegmenten.
228Die in einem Phasensegment enthaltenen Schaltelemente sind ihrerseits in Untereinheiten aufgeteilt. Zunächst ist bei einer Draufsicht dazu je Phasensegment ein Bereich auszumachen, in dem die Schaltelemente positioniert sind (p-förmig bzw. rechteckig). Diese Bereiche weisen ihrerseits jeweils eine Vielzahl von PMOS- und NMOS-FETs auf (und MOS-Kondensatoren, wobei diese für die Verletzungssubsumtion keine Relevanz haben dürften). Nach den Untersuchungen der Klägerin, deren Ergebnisse unstreitig sind, lässt sich folgende Anzahl feststellen: insgesamt 2 x 6384 + 3168 + 720 = 16.656 parallel geschaltete PMOS-FET-Paare sowie insgesamt etwa 2 x 5472 + 960 + 864 = 12.768 Paare von NMOS-FETs.
229Die zuvor geschilderten Strukturen können als der Grundaufbau der angegriffenen Ausführungsformen verstanden werden und beruhen mitunter auf eigenen Angaben der Chipherstellerin D aus dem Jahr 2014. Änderungen an neuen Chips/Packages demgegenüber haben sich nur in den Induktivitäten ergeben, wo die Air-Core-Induktivitäten durch sogenannte Magnetic Inductor Array (MIA)-Module ersetzt worden sind, sodass die wesentlichen Grundfunktionalitäten identisch geblieben sind.
230An der Richtigkeit der vorstehenden tatsächlichen Schilderungen zur Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsformen bestehen nach Auffassung der Kammer keine durchgreifenden Zweifel. Die Klägerin hat diesen strukturellen Aufbau unter Heranziehung zweier Fachunternehmen ermittelt. Die Kritik der Beklagten gegen die in Bezug genommenen Untersuchungen von TechInsights (Anlage ES 5a sowie Anlage ES 5b) verfangen nicht. Insbesondere entbehrt der seitens TechInsights gefertigte Bericht nicht jeder tatsächlichen Grundlage.
231Eine fälschliche Bezeichnung des untersuchten Prozessors auf dem Deckblatt der TechInsights Untersuchungen schmälert ohne spezifische Anhaltspunkte nicht die inhaltliche Richtigkeit der Ergebnisse. Angegeben wurde die Bezeichnung „X“, die auf den Prozessor D X hindeuten würde, wohingegen die Bezeichnung des untersuchten Prozessors unstreitig „X“ lautet. Es handelte sich bei der Angabe in der Überschrift der Untersuchungen um einen Fehler, der durch eine aktualisierte Version des TechInsights-Berichts in der Anlage ES 5n behoben worden ist.
232Auch darüber hinaus weist dieser Bericht im Hinblick auf die untersuchten Prozessoren keine Unrichtigkeiten auf, aufgrund derer er unberücksichtigt bleiben müsste. Neben dem berichtigten Untersuchungsbericht hat die Klägerin als Anlage ES 5m ein weiteres Dokument als Übersicht und zum Abgleich der untersuchten Prozessoren zur Akte gereicht. Zu erkennen ist jeweils die interne Nummer, die TechInsights den untersuchten Prozessoren zugewiesen hat. Beispielhaft sieht dies wie folgt eingeblendet aus:
233X
234Hiervon ausgehend rügt die Beklagte, dass in der korrigierten Berichtsfassung in einigen Abbildungen nunmehr auch andere „Item IDs“ aufgeführt wurden und insoweit eine Abweichung gegenüber der ursprünglichen Fassung vorliegt. Damit vermag sie nicht durchzudringen. Die Kammer hält die hierzu seitens der Klägerin gegebenen Erklärungen für überzeugend. Es verwundert zunächst nicht, wenn in einem Abgleich des ursprünglichen mit dem aktualisierten Report in den Abbildungen nunmehr andere Item IDs aufzufinden sind. Dies beruht gerade auf dem Austausch einiger Abbildungen durch das Prüfinstitut, um die Prozessor-Bezeichnung klarzustellen. Die Beklagte behauptet im Übrigen nicht, dass abgesehen von der Bezeichnung einiger Bilder auch die Bilder selbst verändert worden wären oder anderweitig inhaltlich falsch sein sollten. Der Aussagegehalt der Untersuchungen ist demnach nicht beeinträchtigt.
235Letztlich kommt es auf die geäußerte Kritik der Beklagten aber auch deshalb nicht an, da es mit der Anlage ES 5a einen zweiten Untersuchungsbericht gibt, auf den die Klägerin zur Herleitung der Strukturen auf den angegriffenen Prozessoren außerdem Bezug nimmt und deren Richtigkeit von der Beklagten nicht in Abrede gestellt wurde. Selbst bei Außerachtlassung des TechInsight Reports verbleiben daher hinreichende tatsächliche Anknüpfungspunkte über die tatsächliche Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsformen.
236Schließlich ist bei der seitens der Beklagten angeführten Kritik zu den Untersuchungsergebnissen zu bedenken, dass es sich um aus ihrer Sphäre bzw. der Chipherstellerin aber ihrer Sphäre zuzurechnende Tatsachen handelt, weshalb die Beklagte gehalten gewesen wäre, selbst zum Aufbau der angegriffenen Ausführungsformen vorzutragen, wenn sie inhaltliche Abweichungen gesehen hätte. Denn die vorstehenden Ausführungen, wie sie auch die Klägerin in ihrer Klageschrift vorgenommen hat, betreffen zunächst nur den tatsächlichen Aufbau eines angegriffenen Chips und identifizieren die unterschiedlichen Bestandteile, noch losgelöst von deren konkreten technischen Funktionalitäten.
2372.
238Die untersuchten angegriffenen Ausführungsformen machen insbesondere auch von den hier in Streit stehenden Merkmalen b), Merkmalsgruppe c) sowie Merkmal f) Gebrauch.
239a.
240aa.
241Die Kammer vermag eine Verletzung der Merkmalsgruppe c) festzustellen.
242(1)
243In den angegriffenen Ausführungsformen konnten die MIM-Kondensatoren X, X_L und X_R identifiziert werden. Unstreitig ist hinsichtlich dieser Komponenten, dass es sich um Kondensatoren handelt, die elektrisch parallel zu den die Schaltelemente bildenden Transistoren geschaltet sind.
244Die Anordnung der Kondensatoren auf dem Chip kann wie folgt veranschaulicht werden:
245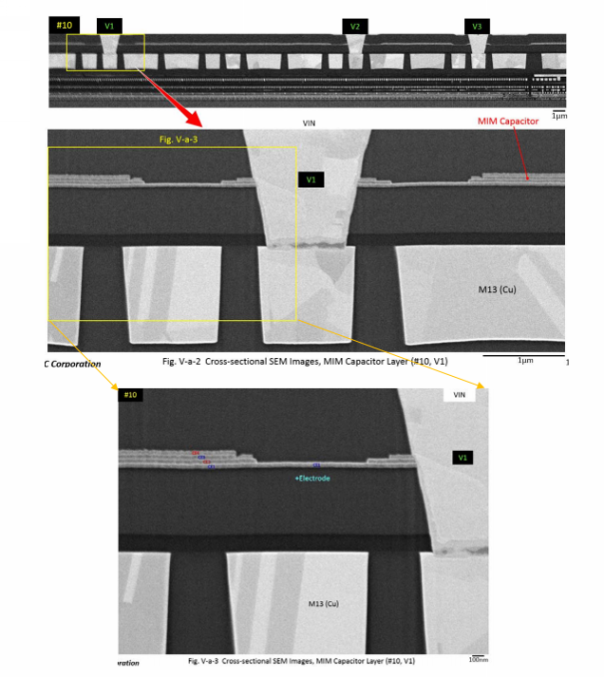
Die MIM-Kondensatoren sind zwischen den beiden obersten Metallschichten (M13 und M14) des Prozessor-Chips angeordnet, was in dem Bild als die dünnen Schichten mit Versatz zu sehen ist. Die einzelnen Kondensatoren sind Bestandteil eines Stapels von Schichten, der vier Metallschichten CE1 bis CE4 umfasst, die durch drei dünne Isolatorschichten voneinander getrennt sind (vgl. Anlage ES 5j). Je nach elektrischer Konfiguration, welche von der elektrischen Verbindung der Metallschichten in einer Schaltordnung abhängig ist, werden verschiedene Metallschichten im Verhältnis zueinander aktiviert, um einen Kondensator zu bilden. Diese unterschiedlichen Zusammensetzungsmöglichkeiten schlagen sich in unterschiedlichen Spannungsbereichen nieder, auf die die Kondensatoren ausgelegt sind. Der untere Kondensator MIM1 ist so für einen anderen Spannungsbereich bis zu 1,98 V optimiert und die oberen Kondensatoren für einen Bereich bis zu 1,26 V. Bildlich hat die Klägerin diesen seitens der Beklagten nicht in Abrede gestellten Aufbau mittels der nachfolgenden Skizze dargestellte Abbildung 69 der Klageschrift:
247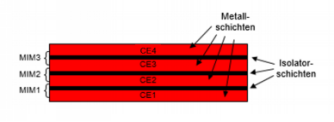
Auf diese Weise können ein, zwei oder drei Kondensatoren parallelgeschaltet werden (MIM 1, MIM 2, MIM 3).
249Die Klägerin hat in einer Draufsicht nachfolgende Kondensatoren (über mehrere Phasensegmente hinweg) auf dem Chip ausgemacht (Abbildung 74), wobei der mit „X“ bezeichnete Kondensator durch den Kondensator MIM 1 gebildet wird:
250
Die nachfolgend gezeigte Tabelle veranschaulicht, zwischen welchen Leiterbahnen die verschiedenen Kondensatoren geschaltet sind:
252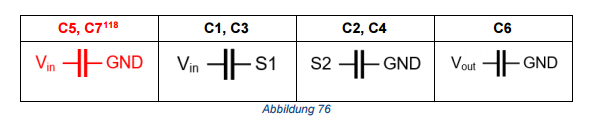
(2)
254Die identifizierten Kondensatoren stellen zur Überzeugung der Kammer einen Spitzenspannungsschutz entsprechend der Lehre des Klagepatents bereit.
255(a)
256Für die Feststellung, dass die als Entkopplungskondensatoren bezeichneten Kondensatoren in den angegriffenen Ausführungsformen losgelöst von ihrer Benennung tatsächlich dazu eingesetzt werden, Spannungsspitzen zu dämpfen, hat die Klägerin ihrer Darlegungslast folgend hinreichende Nachweise erbracht.
257Maßgeblicher Bezugspunkt für die Frage, ob die vorhandenen Kondensatoren zu einem Spannungsspitzenschutz eingesetzt werden, ist das Auftreten sowie Verarbeiten solcher Spannungswerte in den angegriffenen Ausführungsformen, die oberhalb eines zulässigen Maximalwertes liegen, bis zu dem die Transistoren regulär betrieben werden können.
258(aa)
259Zugrunde gelegt hat die Klägerin ihrer Simulation jedenfalls nur eine Phase des X, obwohl sie eine Full-up-Simulation des gesamten X#7 durchgeführt hat, wie sie auf die Kritik der Beklagten hin erläutert hat. Die andere nicht betriebene Phase hat keinen Einfluss auf das Verhalten der Spannungsdifferenz Vhi-Vloc am Eingang der Schaltmodusreglerschaltung und konnte bei den Untersuchungen daher außer Acht bleiben.
260Bevor die Klägerin die Simulation durchführen konnte, hat sie die Schaltungskomponenten wertmäßig bestimmt und ist zu folgenden Ergebnissen gekommen (vgl. Bl. 167):
261Kondensator X: Spannungsspitzenschutzschaltung beträgt 14,1 Ohm, die Kapazität beträgt 161 pF.
262Kondensatoren XL und XR jeweils 282,5 pF, und ihr Widerstandswert jeweils 1,2 Ohm.
263Hinsichtlich des X#7 hat die Klägerin sodann untersucht, wann es zu welchen Spannungsspitzen kommt und die Situation mit implementierten Spitzenschutz derjenigen ohne Spitzenschutz gegenübergestellt. Ermitteln will die Klägerin auf diese Weise eine Spannungsdifferenz zwischen den in der obigen Schaltungsskizze angezeigten Punkten V_hi am Eingang des Reihenschaltelements und Vloc am Ausgang des Nebenschaltelements. Ein Schaltzyklus dauert ca. 7 Nanosekunden, die Schaltfrequenz beträgt 140 MHz.
264Die Simulation, gezeigt im nachstehend wiedergegebenen Graphen, betrifft das An- und Ausschalten von Reihen- sowie Nebenwiderstandselement. Die voreingestellte Eingangsspannung beträgt, wie auch in den angegriffenen Ausführungsformen unter realen Umständen, 1,8 V. Mit dem Abschalten des Nebenschalters verändert sich der elektrische Widerstand des Reihenschaltelements, was zu einem Stromimpuls am Eingang der Reglerschaltung führt und intensive Schwingungen verursacht. Dazu tragen insbesondere die parasitäre Induktivität L_par GND sowie die parasitäre Kapazität C_par bei. Diese hochfrequenten Schwingungen übertragen sich unmittelbar auf die über dem Eingang der Spannungsreglerschaltung abfallende Spannungsdifferenz (V_hi - V_loc) und sind in der grünen Kurve ab diesem Zeitpunkt als Amplituden sichtbar. Die höchsten zwei Spannungsspitzen am Anfang dieses Ausschlags haben einen Betrag von etwa 4,4 V und 2,59 V und sind etwa 174 Pikosekunden (0,174 Nanosekunden) voneinander entfernt, entsprechend einer Schwingungsfrequenz von 5,61 Gigahertz. Diese Schwingungen klingen ab, noch bevor an einem Zeitpunkt von etwa 294,5 Nanosekunden die Schaltzustände umgedreht werden, also der Reihenschalter angeschaltet und der Nebenschalter abgeschaltet wird. Hier treten in der Folge ähnliche Schwingungen der Spannungsdifferenz (V_hi - V_loc) auf, die jedoch in diesem Fall von der parasitären Induktivität auf dem Eingangspfad L_par_Vin und der parasitären Kapazität des soeben abgeschalteten Nebenschalters verursacht werden. Die Ausschläge erreichen etwa dieselbe maximale Höhe auf der Spannungsskala, haben jedoch eine vergleichsweise etwas höhere Frequenz von 5,75 Gigahertz. Dieser Frequenzunterschied der Schwingungen folgt aus den modellierten unterschiedlichen Werten der parasitären Induktivitäten L_par_Vin und L_par_GND. Diese Schwingungen klingen ab, bevor der nächste Schaltzyklus mit gleichem Verlauf wie geschildert von Neuem beginnt. Im Graphen (Abbildung 114) lassen sich diese Schwingungen so darstellen:
265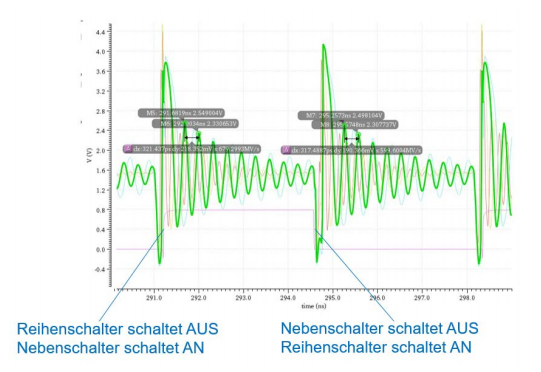
Da die parasitären Induktivitäten variieren können, hat die Klägerin mögliche Spannungshöchstwerte anhand anderer Induktivitätswerte errechnet und kam so zu dem Ergebnis, dass die Spannungsspitzen insgesamt zwischen 4,2 V und 4,4 V lagen.
267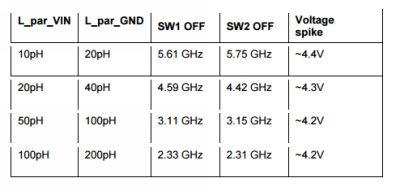
Bei integrierter Schutzschaltung ergab sich die nachfolgende Grafik, die die Spannungswerte in Abhängigkeit von der Frequenz aufzeigt (Abbildung 116):
269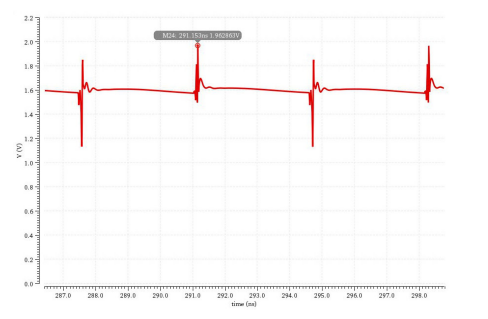
Es treten nur Spannungsspitzen mit einem Maximalbetrag von 1,96 V auf (Vergleichswert oben: >3 V). Dieser Wert liegt unterhalb des Grenzwerts von 2,0 V – die Klägerin nimmt eine unwidersprochene Höchstgrenze von ca. 1 V je Transistor (2 V je Kaskode) an. Auch für die Variante mit Schutzschaltung hat die Klägerin weitere Berechnungen angestellt, die unterschiedliche Werte der parasitären Induktivität aufweisen. Es ergaben sich die nachfolgenden Resultate:
271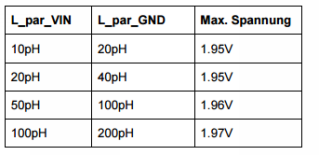
Diese Untersuchungen belegen, dass sich die Situationen mit und ohne Kondensatoren unterscheiden und bei vorhandenen Kondensatoren keine Spannungswerte oberhalb von 2 V mehr auftreten. Dies zeigt eine Veränderung der auf die Schaltelemente einwirkenden Spannungen. Der für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Schaltelemente anzusetzende Höchstwert wird eingehalten, was ohne aktiv eingesetzte Kondensatoren nicht der Fall war.
273(bb)
274Der so durch die Untersuchungen untermauerte Verletzungsvorwurf wird nicht durch das G-Gutachten der Beklagten (Anlage B4) entkräftet. Denn die seitens der Klägerin an diesen gutachterlichen Ausführungen aufgeworfene Kritik vermochte die Beklagte bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung nicht in überzeugender Weise auszuräumen.
275Das Gutachten setzt sich mit dem Inhalt des Klagepatents auseinander und will aufzeigen, weshalb die On-Die Kapazitäten in den angegriffenen Ausführungsformen keine Spannungsspitzenschutzschaltung darstellen würden. Eingangs macht G Ausführungen zum Chip-Design als solchen und knüpft dieses an den maximalen Stromverbrauch des Chips an.
276Unter Ziff. 4.1 geht G auf das Erfordernis von On-Die Kapazitäten im Chip ein und erläutert die Begriffe Kapazität und Induktivität, insbesondere auch deren Umsetzung in einem Chip durch die entsprechenden Bauteile und fügt dazu den nachfolgenden Schaltplan an:
277X
278Dies soll derjenigen Schaltung entsprechen, welche die Klägerin in der Klageschrift für das ohne MIM-Szenario gewählt habe. G betont bei diesen Darstellungen, dass ein Spannungsabfall durch eine Stromentnahme die Hauptursache für Spannungsschwankungen auf der Stromversorgung sei und daher ein Rauschen resultiere. Er nimmt somit den Ladungsverbrauch in der Last in den Blick, die zu einem Spannungsabfall auf dem Chip führt (vgl. S. 23). Um diesem Problem abzuhelfen, kämen die On-Die Kapazitäten zum Einsatz. Der Spannungseinbruch kann verringert werden, indem die Kapazität erhöht wird. Denn Strom und Spannung oszillieren zwischen Induktivität und Kapazität mit einer Frequenz f. In den sich daran anschließenden Ausführungen und mittels der Software Spice erstellten Schaltungssimulationen erläutert G vorwiegend Spannungseinbrüche und zeigt auf, wie hohe Spannungsausschläge verringert werden können, mit der Folge, dass die Spannungsversorgung auf dem Chip nicht mehr zusammenbricht. Hiervon ausgehend werden in den weiteren Abbildungen 7 und 8 Situationen mit Spannungseinbrüchen aufgezeigt, weil die Last mehr Strom ziehen will als bereitgestellt wird. Es sind verschiedene Spannungsverläufe in Abhängigkeit von unterschiedlich groß gewählten Kondensatoren gezeigt (vgl. Abb. 8). Daraus folgert G, dass die unerwünschten Oszillationen gar nicht erst auftreten, wenn durch genügend On-Die Kapazität dafür gesorgt wurde, dass die Spannung nicht einbricht. Die Abbildungen lassen wiederum erkennen, dass G Strom-/Spannungsänderungen betrachtet, die durch die Last hervorgerufen werden.
279Die folgenden Feststellungen von G betreffen die örtliche Platzierung der On-Die Kapazitäten auf dem Chip. Es wird erläutert, dass da, wo besonders viel Strom benötigt wird, die Kapazität platziert wird. Es besteht dabei ein maximaler Abstand zur Stromlast, um so ein Gesamtrauschen der Stromverteilung herunterzudrücken. G stellt auch hierbei auf die Eigenschaft der Kondensatoren als Entkopplungskondensatoren ab. Dies gilt auch für die Erklärungen hinsichtlich der Abb. 18 und 19. Es handelt sich um Untersuchungen zum Spannungsverlauf in Abhängigkeit von dem seitens der Klägerin in der Klageschrift angesetzten Widerstandswert. Ein hoher Widerstandswert zeige eine nahezu gänzlich unterdrückte Oszillation, weise aber immer noch eine Spannungsspitze beim Abschalten auf. Bei einem minimalen Widerstandswert komme es zu starken Oszillationen und einer Spannungsspitze von fast 13 V, beim Einschalten des Schalters brecht die Spannung auf fast Null ein. Daraus folgert G, dass nur eine Erhöhung des Widerstandswerts nicht effektiv vor Spannungseinbrüchen schützt. Wesentliche Anforderungen des Chipdesigns würden bei dieser Herangehensweise nicht hinreichend berücksichtigt (vgl. S. 37). Wie er auf Seite 40 weiterausführt, ist die Maximierung der On-Die Kapazität entscheidend. Im Rahmen der Auseinandersetzung mit den klägerischen Simulationen betont er wiederum das Erfordernis einer genügenden On-Die Kapazität, um einen Spannungseinbruch zu verhindern (vgl. S. 56 Mitte).
280Auf geübte Kritik der Klägerin an dem vorstehend grob skizzierten Inhalt des Gutachtens hat es die Beklagte nicht vermocht, die Kammer von der Relevanz der gutachterlichen Ausführungen für die streitgegenständliche Verletzungsdiskussion zu überzeugen. Allein die Begriffswahl Gs, wenn er von Entkopplungskondensatoren spricht, kann den Bedeutungsgehalt seiner Ausführungen nicht per se schmälern, da – wie zwischen den Parteien Einigkeit besteht – es auf die elektrische Verschaltung ankommt, um zu beurteilen, welche Wirkung ein Kondensator bereitstellt. Es verbleibt dennoch bei Unstimmigkeiten hinsichtlich der von G gewählten Schaltsimulation, da ein Aufbau eines Spannungsreglers ohne Ausgangsspule gewählt wurde. Selbst wenn nie ein Schaltbild einer angegriffenen Ausführungsform abgebildet werden sollte und vor dem Hintergrund von einer Ausgangsinduktivität abgesehen werden konnte, so stellt sich die Frage, welchen Aussagegehalt die Abb. 6 mit Blick auf die technische Lehre des Klagepatents und deren Verwirklichung durch die angegriffenen Ausführungsformen haben soll. Dies gilt umso mehr, da dieses Schaltbild im Folgenden auch in konkret angestellten Simulationen und Berechnungen zugrunde gelegt wird und somit gerade doch auf Verhältnisse in den angegriffenen Ausführungsformen Bezug genommen wird, zumal auch mit den tatsächlichen Werten gerechnet wird. In diesem Zusammenhang wäre es ferner an der Beklagten gewesen, die Ausgangsspannung Vout, so wie sie von G bzw. der Software als Artefakt verwendet worden sein soll, näher zu erläutern, um klarzustellen, dass eine Bezugnahme auf die vom Klagepatent adressierten Spannungsspitzen vor dem Eingang der Schaltmodusreglerschaltung erfolgt ist, mithin die relevanten Eingangsspannungen zwischen Vhi und Vloc bewertet werden sollten.
281Die vorstehenden Kritikpunkte sowie eine Würdigung der weiteren Ausführungen des Gutachters geben nach Auffassung der Kammer zu erkennen, dass sich G vorwiegend mit der Problematik von Spannungseinbrüchen befasst hat, zu deren Überwindung tatsächlich Kondensatoren zum Einsatz kommen können. Dies hebt er so auch auf Seite 56 (Mitte) seines Gutachtens hervor. Indes findet eine überzeugende Auseinandersetzung mit den hier maßgeblichen Kondensatoren als Spannungsspitzenschutz nicht statt.
282Vor diesem Hintergrund verfängt auch die von G an den klägerischen Simulationen geübte Kritik nicht. Sie begründet keine durchgreifenden Zweifel an der Tauglichkeit der klägerischen Simulation als Verletzungsnachweis. Losgelöst von den vielen, nur abstrakten Ausführungen zu Kondensatoren im Gutachten nimmt G auch bei dem Graphen der Klägerin in erster Linie die Spannungseinbrüche in den Blick, wobei insoweit zweifelhaft ist, dass er den richtigen Bezugspunkt der Messungen, nämlich zwischen Vhi und Vloc, und nicht Vin und GND, seiner Beurteilung zugrunde gelegt hat. Dass die Kritik von G darüber hinaus an den errechneten Spannungswerten plausibel ist und die Untersuchung der Klägerin erschüttern kann (vgl. S. 57 ff.), vermag die Kammer jedenfalls anhand der gutachterlichen Ausführungen nicht positiv festzustellen. Hinzukommt, dass G Überlegungen zu einer Zeitkonstanten anstellt und einen Zusammenhang von Frequenz, Induktivität und Kapazität aufstellt, ohne jedoch zu erklären, weshalb es im Zusammenhang mit Spannungsspitzenschutz auf ebenjenen ankäme, sodass die aufgefundenen Ergebnisse zwar erstaunen mögen, hinsichtlich der vorliegenden Streitfragen aber keine Relevanz haben.
283(b)
284Dass die Beklagte darüberhinausgehend das klägerische Verletzungsvorbringen erheblich entkräften kann, vermag die Kammer nicht positiv festzustellen, da auch nach der mündlichen Verhandlung erhebliche Unklarheiten an ihrem Vorbringen verblieben sind.
285(aa)
286Die Behauptung der Beklagten, weshalb es ihrer Ansicht nach nicht zu Spannungsspitzen in den angegriffenen Ausführungsformen komme, wenn die Kondensatoren nicht implementiert sind, stützt sich noch nicht aus einer Wertberechnung der parasitären Widerstände. Diese hat die Beklagte zunächst ausgehend von den der klägerischen Simulation zu entnehmenden Werten für parasitären Widerstand und parasitäre Kapazität vorgenommen, um daraufhin die von G angeführte zeitliche Komponente zu ermitteln, binnen derer sich ein Kondensator vollständig mit elektrischer Spannung aufgeladen hat. Auf Grundlage der seitens der Klägerin angegebenen Werte für Widerstand R und Kapazität C gelangt die Beklagte für „X“ und „X“ jeweils zu folgenden Zeitkonstanten:
287„X“: 14,1 Ω*161 pF = 2,27 ns.
288„X“: 1,2 Ω*282,5 pF = 339 ps.
289Diese im Wesentlichen unstreitigen Berechnungen sollen nach Auffassung der Beklagten belegen, dass die beiden Kondensatoren zu „langsam“ sind, um eine wirkungsvolle Dämpfung etwaiger Spannungsspitzen vorzunehmen, wobei die unterschiedlichen Berechnungsergebnisse für die Kondensatoren aus der unterschiedlichen Größe dieser beiden Bauteile resultieren (vgl. Bl. 555 GA). Dass die Kondensatoren zu langsam seien, leitet die Beklagte aus der unstreitigen Schwingungsdauer der Oszillationen von 174 ps ab, die deutlich unterhalb der errechneten Zeitkonstante liegt. Umso deutlicher sei die zu geringe Geschwindigkeit der Kondensatoren unter Berücksichtigung dessen, wie lange die „ohne X / X“ angegebene Spitzenspannung von4,4V überhaupt anliegt – nämlich nur für ca. 80 ps.
290Der Kammer fehlen indessen hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte, dass es für die Frage eines effektiven Spannungsspitzenschützens auf die Reaktionszeit ankommt. Insbesondere nachdem die Klägerin in der Replik die Relevanz dieser Zeitkonstante in Abrede gestellt hat, hat die Beklagte keine neuen Argumente dazu angeführt. Es verbleibt deshalb bei dem seitens der Klägerin erläuterten Verständnis, wonach ein zur Schutzschaltung eingesetzter Kondensator durch die von ihm bereitgestellte Kapazität vorteilhaft auf die Oszillation/den Schwingkreis am Eingang der Schaltmodusreglerschaltung zwischen der parasitären Induktivität und der parasitären Kapazität einwirkt, indem er die dynamischen Eigenschaften des Schwingkreises verändert. Dieser Vorgang ist unabhängig von der seitens der Beklagten angeführten Zeitkonstante t. Zumindest hat die Beklagte nichts Anderes aufzuzeigen vermocht.
291Umso weniger stehen diese errechneten Werte einer Patentverletzung entgegen, als sich der ermittelte Widerstandswert zumindest hinsichtlich des Kondensators X deutlich oberhalb eines vom Klagepatent exemplarisch angeführten Widerstandswertes liegt. Denn in Abs. [0074] beschreibt das Klagepatent, dass jedes Spitzenschutzsegment eine äquivalente Kapazität von 50pF und einen äquivalenten Widerstand von 2 Ohm hat. Der Größenordnung nach fügt sich das Messergebnis der Klägerin somit auch in denjenigen Wertbereich ein, den das Klagepatent bei Vorhandensein von Kondensatoren mit dissipativem Element annimmt.
292(bb)
293Ebenso wenig durchzudringen vermag die Beklagte mit ihrer Berechnung von maximalen Obergrenzen, im Sinne einer sogenannten “Breakdown Voltage” VBD, welcher die angegriffenen Ausführungsformen maximal ohne Schutzschaltung Stand halten würden. Er würden sich danach folgende Werte ergeben: 1,8 V + 3,6 V = 5,4 V für einen PMOS-FET und 1,8 V + 2,8 V = 4,6 V für einen NMOS-FET. Die zu 1,8 V hinzugerechneten Werte repräsentieren den Wert, auf den die Gate-Spannung jeweils erhöht werden konnte, bis der Transistor durchgebrochen ist. Hierzu verweist die Beklagte auf die als Anlage B6 (B7b als Übersetzung) zur Akte gereichte D-Veröffentlichung. Darin wird die die Zuverlässigkeit von CMOS-Transistoren der 10nm-Technologie erörtert. Bezugspunkt der Spannung ist allerdings die Gate-Spannung, mithin diejenige Spannung, die in die Schaltelemente gegeben werden muss, um einen Schaltvorgang zu initiieren. Diese Spannung ist abzugrenzen von der Eingangsspannung, die über den Spannungsregler als solchen in die Schaltelemente einfließt. Dies hat so auch die Klägerin in der Replik kritisiert. Maßgeblicher Ausgangspunkt für eine nach dem Klagepatent entscheidende Spannung sei das Verhältnis Source-Drain (vgl. auch Anlage BP 3g, S. 4). Diesem Vorbringen ist die Beklagte in der Duplik nicht in erheblicher Weise entgegengetreten. Insbesondere hat sie unter Bezugnahme auf die Veröffentlichung nicht konkret aufgezeigt, woraus sich dort der richtige Anknüpfungspunkt für die Obergrenze ergeben soll.
294(cc)
295Im Ergebnis vermag die Beklagte indes auch nicht mit den in der Duplik vorgebrachten eigenen Simulationsergebnissen durchzudringen, anhand derer sie aufzeigen will, dass die streitgegenständlichen Kondensatoren nicht dazu eingesetzt werden, Spannungsspitzen zu kompensieren. Die Beklagte war nicht in der Lage, der seitens der Klägerin formulierten Kritik an dem H-Gutachten (Anlage B 23), insbesondere in der hier nur relevanten korrigierten Fassung (Anlage B 26), in überzeugender Weise zu begegnen.
296(α)
297Es kann zunächst dahingestellt bleiben, ob die gutachterlichen Untersuchungen und der entsprechende Vortrag der Beklagten in der Duplik berücksichtigungsfähig oder als verspätet zurückzuweisen sind, da die Kammer jedenfalls inhaltliche Mängel erkennt, aufgrund derer ihnen kein überzeugender Aussagegehalt mehr zukommt.
298(β)
299Mithilfe des H-Gutachtens wollte die Beklagte aufzeigen, dass in den angegriffenen Ausführungsformen Spannungsspitzen in einem Bereich von rund 4 V gar nicht auftreten, wie sie die Klägerin behauptet.
300H kommt zu den nachfolgend eingeblendeten und erläuterten Messergebnissen. Zunächst wird das MIM-Szenario dargestellt in einer vergrößerten Ansicht:
301X
302Das noMIM-Szenario stellt sich nach den Erkenntnissen Hs wie folgt dar:
303x
304Bei einer Überblendung dieser beiden Messausschnitte ergibt sich die nachfolgende Grafik:
305x
306Hs Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass die Situationen mit und ohne Kondensatoren nur einen Unterschied von X aufweisen, wobei es in keinem Szenario zu Spannungswerten oberhalb von X kommt. Damit liegen die Werte von H deutlich unterhalb der von D ermittelten Spannungswerte.
307Die zuvor beschriebenen Messwerte stehen dem Verletzungsvorwurf aber deshalb nicht in beachtlicher Weise entgegen, da sowohl Messgrundlagen als auch die Herangehensweise bei den Untersuchungen/Simulationen Unstimmigkeiten aufweisen, die die Beklagte auch nach Durchführung der mündlichen Verhandlung nicht beheben konnte.
308Dabei sind die vorgenommenen Korrekturen selbst nicht der ausschlaggebende Grund für die Zweifel an den Aussagen des Gutachtens. Die Neuerungen gegenüber dem ersten Gutachten bestehen in einer Anpassung eines Scripts/Codes, da ein eingegebener Wert nicht bei allen Berechnungen übernommen wurde. Auf dieser Basis hat H neue Impedanzprofile erzeugt. Hinzukommend finden in dem aktualisierten Gutachten nunmehr auch die Driver Decoupling Kapazität als Teil des On Chip Impedanznetzwerks Berücksichtigung. H hat sein D Modell und auch die Schaltung eigens um diese Komponenten ergänzt (= „updated D matched model“).
309Allerdings bleiben nach der Kritik der Klägerin einige Fragen hinsichtlich der Vorgehensweise weiterhin ungeklärt. Dies betrifft schon da HSPICE-Model, welches dem Gutachter von D bereitgestellt wurde. Es handelt sich um ein theoretisches Modell, das vor Herstellung des „Die“ erstellt wird, bestimmte Schaltungselemente umfasst und so die X-Schaltung simulieren soll. Dieses Modell wird der Erstellung eines Impedanzprofils zugrunde gelegt und zudem der eigenen Ermittlung eines Impedanzprofils durch H („D matched model“). Ungeklärt in diesem Zusammenhang ist aber schon, in welcher Design-Phase des Chips das D-Model entwickelt wurde und auf welche Stelle einer X-Schaltung es konkret bezogen ist. Nicht nachvollziehbar ist des Weiteren die händische Ergänzung der Kondensatoren in den Schaltplänen und welche Kondensatoren bei der Simulation der Szenarien mit/ohne MIM Eingang gefunden haben.
310Die im H-Gutachten geschilderten Grundlagen zur Verschaltung eines X decken sich im Ausgangspunkt zunächst noch mit dem Verständnis der Klägerin von einem grundsätzlichen Chip-Aufbau (vgl. Figur 6). Dargestellt sind insbesondere auch nach dem Verständnis der Klägerin MIM-Kondensatoren, welche den von ihr in den angegriffenen Ausführungsformen identifizierten Kondensatoren X und X entsprechen.
311Hiervon abweichend zeigt sich nun vor allem das „updated D matched model“, wie es in Figuren 24/25 nach der Aktualisierung des Gutachtens dargestellt wird. Nach den Ausführungen Hs sind in den folgenden Figuren 24 und 25 alle Elemente des On-Chip-Impedanznetzwerks berücksichtigt, insbesondere die Treiber-Entkopplungskondensatoren für das (no)MIM Szenario:
312x
313Der nachfolgende Schaltplan stammt aus der Triplik und hebt durch Markierungen der Klägerin, die ihrer Ansicht nach entscheidenden Bereiche des Schaltplans hervor:
314X
315Nach dem Verständnis der Klägerin unterscheidet sich die Figur 24 gegenüber der Figur 18 durch den rot markierten Abschnitt, welcher in der Figur 24 ergänzt wurde. Den einzigen Unterschied wiederum zwischen den Figuren 24 und 25 sieht die Klägerin in dem gelb markierten Bereich. Hervorgehoben wird dort ein Kondensator (bezeichnet als C11 – Figur 18 bzw. C34 – Figur 25), welcher nach dem Verständnis der Klägerin von dem Schaltplan allerdings in Reihe mit den Schaltelementen geschaltet ist und seiner Anordnung nach schon nicht die Funktion des Spannungsspitzenschutzes erfüllen kann.
316Diesem Vorbringen ist die Beklagte nicht auf überzeugende Weise entgegnet; auch nach Durchführung der mündlichen Verhandlung bleibt unklar, in welchem Szenario der Untersuchungen welche Kondensatoren wie im Verhältnis zu den Schaltelementen geschaltet waren. Schriftsätzlich hat die Beklagte die Schaltpläne, insbesondere wie sie sich nach dem Update ergeben, nicht erörtert. Aus den gutachterlichen Ausführungen ergeben sich derlei Erklärungen ebenso wenig. H hat lediglich beschrieben, dass er Änderungen aufgrund des festgestellten Fehlers an den Schaltplänen vornehmen würde; was ihn zu welchen Änderungen im Konkreten bewogen hat, hat er jedoch nicht mitgeteilt. Ohne nähere Hinweise auf die ein- oder ausgeschalteten Kondensatoren folgen auf die angepassten Schaltpläne vielmehr unmittelbar die Impedanzprofile. Das erforderliche Vorbringen zu den jeweils geschalteten Kondensatoren wird auch nicht dadurch obsolet, dass H seine Vorgehensweise grundsätzlich schrittweise erklärt hat und seine Methodik so nachvollziehbar sein mag. Denn es hätte auch innerhalb eines Arbeitsschritts detaillierter Darstellungen bedurft, insbesondere zu berücksichtigten Bauteilen und umso mehr, nachdem hinsichtlich des ersten Gutachtens aufgefallen ist, dass genau an der Berücksichtigung aller Elemente Mängel bestanden. Ebenso wenig hat die Beklagte in der mündlichen Verhandlung eine nähere Begründung zu diesem Kritikpunkt der Beklagten geliefert, weshalb die Kammer nicht davon überzeugt ist, dass bei den Messszenarien von H die für die Umsetzung der klagepatentgemäßen Lehre erforderlichen Kondensatoren berücksichtigt wurden und trotz ihres Nichtvorhandenseins keine Spannungsspitzen auftreten.
317Überdies hat H ideale Transistoren verwendet, also ideale Schalter ohne parasitäre Kapazitäten, wie sie – was zwischen den Parteien unstreitig ist – in den angegriffenen Ausführungsformen nicht vorkommen. Eine nähere Begründung zu dieser Vorgehensweise hat H nicht erbracht. Die Beklagte hat dies in der mündlichen Verhandlung zumindest deshalb als unschädlich angesehen, weil bei solchen Schaltern sogar höhere Spannungsspitzen auftreten würden als in der Realität. Diese Behauptung vermag die Kammer indes ohne näheres Tatsachenvorbringen nicht nachzuvollziehen, wobei selbst bei Richtigunterstellung die anderweitigen Gründe der Nachvollziehbarkeit des H-Gutachtens entgegenstehen.
318Unerwähnt lässt die Beklagte schließlich, weshalb H überhaupt, anders als die Klägerin, auf einen Vergleich der Impedanzprofile abstellen will und nicht die Simulationen im Zeitbereich für taugliche Ansatzpunkte sieht, um das (Nicht-) Auftreten von Spannungsspitzen nachzuweisen. Die Kammer ist ohne nähere Erläuterungen nicht davon überzeugt, dass dieser Messansatz zuverlässig Hinweise auf Impedanzen spezifischer Bauelemente in einer spezifischen Schaltung gibt. Der Sachverständige der Klägerin, Hofmann, hat derlei jedenfalls plausibel ausgeschlossen (vgl. Anlage ES 5p).
319bb.
320Ausgehend von dem dargelegten Verständnis verwirklichen die angegriffenen Ausführungsformen die Voraussetzung, dass die Spannungsspitzenschutzschaltung am Eingang angeordnet ist.
321(1)
322Als Verletzungsnachweis nimmt die Klägerin Bezug auf die Abbildung 92, welche – unstreitig – dahin zu verstehen ist, dass die Kondensatoren zwischen den Spannungsniveaus Vin und GND liegen:
323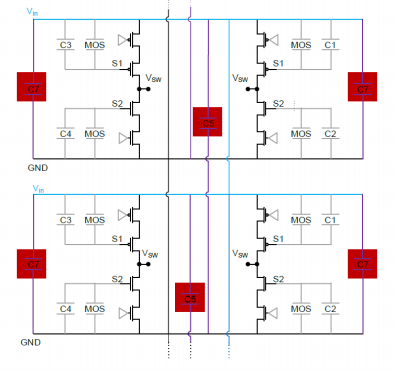
Diese Darstellung ist als Verletzungsnachweis ausreichend. Denn die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung auf Nachfrage des Gerichts erläutert, dass die mit den Untersuchungen betrauten Unternehmen die Kondensatoren zwar zwischen „Vin und GND“ verortet haben, damit aber tatsächlich eine erfindungsgemäße Anordnung beschrieben werden sollte. Maßgeblich seien auch nach dem Verständnis der Prüfunternehmen die vom Klagepatent als Potentialknoten Vhi und Vloc bezeichneten Abzweigungen der Leiterbahnen, zwischen denen die Kondensatoren angeordnet sein müssen, um die unterschiedlichen Potentiale sowie die parasitären Induktivitäten berücksichtigen zu können.
325Nachdem die Klägerin diese Erläuterungen vorgenommen und damit einen Widerspruch ihres tatsächlichen Vorbringens zwischen Klageschrift und Replik nachvollziehbar ausgeräumt hat, hat sich die Beklagte gegen diesen Vortrag nicht mehr gewendet.
326(2)
327Die Kondensatoren sind ferner im Sinne des Klagepatents über die Schaltelemente hinweg angeordnet.
328Die Spitzenschutzschaltung ist über die Reihen- und Nebenwiderstandselemente hinweg angeordnet, weil eine räumliche Nähe besteht. Diese ergibt sich nach Ansicht der Klägerin aus einer Betrachtung der MIM-Ebene in Überlagerung mit der Ebene der FET-Gatekontakte, woraus sich weitgehend gerade nach unten verlaufende Verbindungen ergeben würden. In der Draufsicht sind die Komponenten unmittelbar nebeneinander angeordnet (Replik, Abbildungen 80 und 79):
329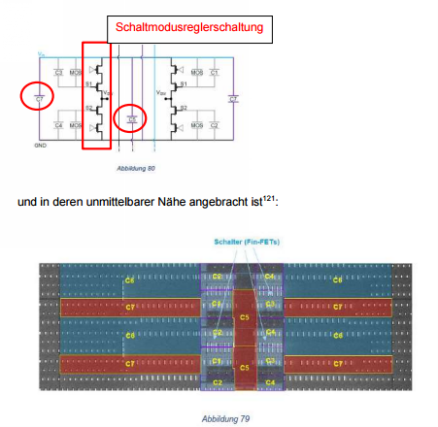
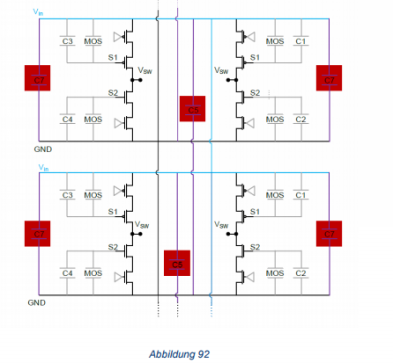
Die Beklagte stellt zwar in Abrede, dass die MIM-Kondensatoren X und X über die Schaltelemente hinweg angeordnet seien. Es sei der Abbildung 93 allenfalls zu entnehmen, dass die Kondensatoren in einer Draufsicht an die Areale, beinhaltend die Schaltelemente, angrenzen würden:
332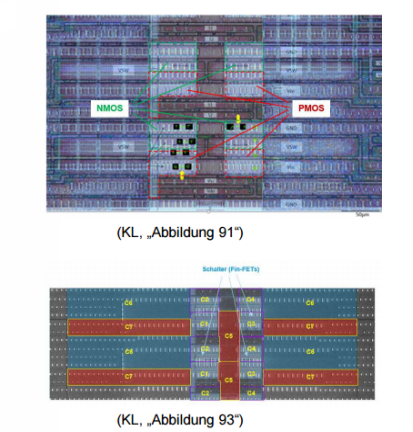
Wie im Rahmen der Auslegung ausgeführt, gibt das Klagepatent mit dem Ausdruck „über hinweg“ allenfalls Hinweise auf die elektrische Ausgestaltung der Komponenten zueinander, indes nicht in physischer Hinsicht. Eine elektrische Beziehung derart, dass die Kondensatoren parallel zu den Schaltelementen implementiert sind, ist hier festzustellen, und für eine Verletzung ausreichend. Es ist zwischen den Parteien unstreitig, dass die Schalter und Kondensatoren elektrisch parallelgeschaltet sind; sie liegen bei horizontaler Betrachtung des Chips räumlich beieinander und befinden sich bei vertikaler Betrachtung im Schichtaufbau des Halbleiters auf unterschiedlichen Schichten. Die Verbindung erfolgt über senkrecht nach oben verlaufende Vias, welche allenfalls einen geringfügigen ohmschen Widerstand aufweisen.
334cc.
335Zwischen den Parteien besteht außerdem Einigkeit darüber, dass die angegriffenen Ausführungsformen kein eigenständig ausgebildetes dissipatives Element neben einem Kondensator aufweisen, sondern in dem Kondensator auch ein elektrischer Widerstand enthalten ist. Dies genügt für eine Verletzung, da es – wie vorstehend ausgeführt – in den angegriffenen Ausführungsformen tatsächlich nicht zu Spannungsspitzen kommt, was Beleg für eine ausreichende Dimensionierung des dissipativen Elements ist.
336dd.
337Merkmal d) ist durch die angegriffenen Ausführungsformen verwirklicht. Denn nach dem zwischen den Parteien unstreitigen tatsächlichen Aufbau der angegriffenen Ausführungsformen ist eine Ausgangsinduktivität als passives Element vorhanden, das sich zwar nicht in einer integrierten Schaltung mit der Schaltmodusreglerschaltung und der Spannungsspitzenschutzschaltung befindet, was für eine erfindungsgemäße Vorrichtung auch nicht erforderlich ist.
338ff.
339Die angegriffenen Ausführungsformen gebrauchen zudem Merkmal f).
340(1)
341Die angegriffene Ausführungsform X weist Ladungsspeicherschaltungssegmente auf. Die Klägerin nimmt insoweit Bezug auf über die Phasensegmente hinweg angeordneten Kondensatorblöcke, die sie mit „X_L“ kennzeichnet. bzw. mit „X“. Zumindest jeder der als X_L bezeichneten MIM-Kondensatoren stellt ein Segment der Ladungsspeicherschaltung der Spannungsspitzenschutzschaltung dar. Nach dem letzten Vorbringen der Parteien in Replik und Duplik wurde nur noch die linke Seite, stehend für zwei Phasensegmente innerhalb derselben Phase, mit den Kondensatoren X_L, bei der Verletzungsdiskussion in den Blick genommen, weshalb auch die Kammer diesen Bereich ihrer Würdigung zugrunde legt.
342Das Verständnis dieser Kondensatoren als Bestandteile eines einzigen Kondensators bestätigt die Beklagte letztlich mit ihren eigenen Ausführungen. Sie will sich nämlich damit gegen die Verwirklichung der Ladungsspeichersegmente verteidigen, dass es sich sowohl bei X als auch bei X nur um einen Kondensator handele, der aus räumlichen Gründen aufgeteilt sei und sich über den ganzen Chip erstrecke. Genau dies ist aber nach Auffassung der Kammer Ausdruck einer Aufteilung des Kondensators in mehrere einzelne Segmente, die jeweils geeignet sind, einen Spitzenschutz bereitzustellen.
343Die technische Eignung der einzelnen Blöcke zum Spannungsspitzenschützen stellt die Beklagte nicht in Abrede. Auch in der Duplik verteidigt sie sich zuvörderst mit einer in räumlich-körperlicher Hinsicht nicht feststellbaren Verschachtelung und mit einer nicht erkennbaren nur kurzen Länge der Vias zwischen Schutz- und Schaltelementen. Dieses Vorbringen ist nicht geeignet, durchgreifende Zweifel am Verletzungsvortrag der Klägerin zu begründen. Denn unter Berücksichtigung nur der einzelnen X_L-Elemente vermag die Kammer eine anspruchsgemäße Verschachtelung der Segmente festzustellen. Bei Betrachtung der ausschließlich linken Seite bezogen auf eine Phase lassen sich die angegriffenen Ausführungsformen Xwie folgt darstellen:
344X
345In Draufsicht ist zu erkennen, dass jeweils ein Kondensatorteil einem p-förmigen Schaltblockelement zugewiesen ist, dieses in der schematischen Darstellung „berührt“. Die einzelnen Schaltblockelemente zueinander haben keine Verbindung, sondern lassen durch den schmalen grauen Bereich eine Trennung erkennen. So ist eine alternierende Anordnung von Schalt- und Schutzsegmenten zu ersehen. Entsprechendes gilt auch bei einer Betrachtung der X-Kondensatoren. Denn zwischen diesen Kondensatorkomponenten ist jeweils ein Schaltblock angeordnet und auch ein X-Kondensator ist spezifisch einem dieser Blöcke zugeordnet, was dadurch kenntlich wird, dass zwischen dem unteren Bereich eines X-Blocks und dem folgenden Schaltelement ein grauer Bereich, mithin eine Trennung, zu sehen ist. Auch dies offenbart eine abwechselnde Anordnung der unterschiedlichen Elemente bei einer Draufsicht auf den Chip.
346Auch unter dem Gesichtspunkt einer nur kurzen elektrischen Verbindung zwischen diesen Bauteilen mag die Kammer eine Verletzung des Klagepatents anzunehmen. Denn, da das Klagepatent keine konkreten Längenangaben für diese Verbindungen aufstellt, musste die Klägerin entsprechendes nicht konkret vortragen. Es genügt als Nachweis für kurze Verbindungen, mit denen ein geringer elektrischer Widerstand einhergeht, deren Verlauf aufzuzeigen. Hierzu hat die Klägerin in einer Abbildung grüne Doppelpfeile eingezeichnet, welche ersichtlich den grundsätzlichen Verlauf der Vias veranschaulichen und nicht deren exakten Verlauf skizzieren sollen:
347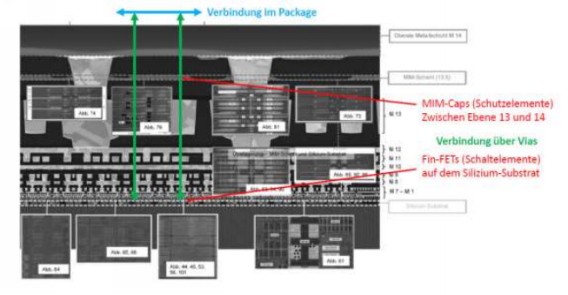
Dieses Vorbringen ist ausreichend, um eine hinreichende elektrische Nähe sowie Zuordnung von je Schutz- und Schaltelementen darzutun. Ferner hat die Klägerin zu dieser Abbildung erläutert, dass die Verbindung von einem Schaltblocksegment zu einem anderen elektrisch immer nur über ein Ladungsspeichersegment führt und zwei Schaltblöcke daher nicht unmittelbar miteinander verbunden sind. Dies hat die Beklagte nicht in Abrede gestellt, womit das maßgebliche Ziel des Klagepatents erfüllt ist, die unterschiedlichen Segmente nah beieinander und im Wechsel zueinander anzuordnen. Zudem hat die Beklagte keinen erheblichen Gegenvortag zu dem Umstand angeboten, dass die in der angegriffenen Ausführungsform gewählte Konfiguration tatsächlich eine nur geringe parasitäre Induktivität zwischen Schutz- und Schaltelementen bewirkt. Dies bedeutet aber zugleich, dass elektrisch die Verbindungen derart gewählt wurden, dass sie als „kurz“ im elektrischen Sinne zu erachten sind. Auf einen Verlauf der Vias durch mehrere Schichten und die so konkret überwundene Höhe im Chip kommt es für einen Verletzungsnachweis mithin nicht an. Überdies ist es der Halbleitertechnologie immanent, dass es sich um Kleinstabmessungen handelt und allein die räumliche Ausdehnung, wie von der Beklagten in den Blick genommen, nicht zwingend Hinweis auf die elektrische Nähe geben muss.
349Die Schaltung in der angegriffenen Ausführungsform bewirkt somit, dass zwei Schaltelemente nicht unmittelbar aneinandergrenzen und sich gegenseitig weniger beeinträchtigen. Durch die konkrete Zuordnung von Schutzelementen können diese kompakter ausgestaltet werden und trotzdem eine hinreichende Kapazität bereitstellen, ohne zugleich eine zu hohe Impedanz zu bewirken.
350(2)
351Vorstehende Ausführungen gelten auch für die weiteren Modelle der angegriffenen Ausführungsformen. Auch insoweit stellt die Beklagte maßgeblich auf die äußerliche Anordnung der Vorrichtungsbestandteile ab, ohne die elektrischen Verbindungswege in den Blick zu nehmen. Aber selbst bei einer Draufsicht auf die angegriffenen Ausführungsformen vermag die Kammer eine anspruchsgemäße alternierende Anordnung von Ladungsspeicherschaltungssegmenten und Schaltblocksegmenten zu erkennen. Diese beiden Segmente liegen einander jeweils näher als gleichartigen Segmenten. Umso deutlicher wird der Verletzungsnachweis unter Berücksichtigung des klägerischen Vorbringens zum Verlauf der elektronischen Verbindungen. Dieser ist wie bei den X-Modellen ausgestaltet, sodass insoweit auf vorstehende Würdigung verwiesen werden kann.
352Die X-Prozessoren lassen zur Überzeugung schon optisch erkennen, dass die Schaltblocksegmente nicht aneinandergrenzen, sondern immer ein Schutzelement dazwischenliegt. Denn die Schutzelemente ragen leicht – bei Draufsicht – über die Schaltblocksegmente hinaus. Dies führt zu einer alternierenden Anordnung dieser Komponenten. Außerdem gilt insoweit Obiges für die Ausgestaltung der kurzen elektrischen Verbindungen entsprechend.
353X
354Auch die XProzessoren weisen eine verschachtelte Anordnung der Segmente auf:
355X
356Bezüglich des XChips stellt die Beklagte in der Klageerwiderung auch nur eine vertikale Verschachtelung in Abrede. Dass somit in Draufsicht und damit zumindest in einer räumlichen Anordnung eine verschachtelte Anordnung von Schalt- und Schutzelementen vorliegt, ist unstreitig. Dass auch mit Blick auf die vertikalen elektrischen Verbindungen eine anspruchsgemäße Ausgestaltung vorliegt, ergibt sich aus obigen Ausführungen sinngemäß auch für diese angegriffene Ausführungsform.
357IV.
358Aufgrund der vorstehenden Ausführungen resultieren die folgenden Rechtsfolgen:
3591.
360Da die Beklagte das Klagepatent widerrechtlich benutzt hat, ist sie gemäß § 139 Abs. 1 PatG zur Unterlassung der Benutzungshandlungen verpflichtet.
361Gemäß § 139 Abs. 1 S. 3 PatG ist der Unterlassungsanspruch ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. Der Unverhältnismäßigkeitseinwand des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG ist auf besondere Ausnahmefälle begrenzt. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass der Unterlassungsanspruch die logische Folge des Ausschließlichkeitsrechts ist. Mit der Erteilung des Patents entstehen an der patentierten Erfindung absolute Rechte, die neben ihrem Zuweisungsgehalt einen Ausschlussgehalt besitzen, so dass der Inhaber des Rechts grundsätzlich jedermann von der Nutzung der patentierten Lehre ausschließen kann. So erlauben sie insbesondere - im Rahmen der übrigen gesetzlichen, insbesondere der patent- und kartellrechtlichen Vorgaben - den Ausschluss Dritter von der Nutzung der patentierten Lehre. Um sein Ausschließlichkeitsrecht durchzusetzen, ist der Patentinhaber in aller Regel auf den Unterlassungsanspruch angewiesen.
362Der Gesetzgeber hat in der Begründung des 2. PatModG klargestellt, dass eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs nur in besonderen Ausnahmefällen in Betracht kommt. Der Unterlassungsanspruch ist die regelmäßige Sanktion der Patentrechtsordnung bei einer Patentverletzung. Aus diesem Regel-Ausnahme-Verhältnis folgt, dass den Patentverletzer die Darlegungs- und Beweislast für die behauptete Unverhältnismäßigkeit der Inanspruchnahme trifft. Der Patentverletzer hat hiernach ganz konkrete, einer gerichtlichen Beweiserhebung zugängliche Tatsachenbehauptungen vorzutragen, und nicht nur Allgemeinplätze. Zweifel gehen, wie die Gesetzesbegründung bestätigt, zu Lasten des Patentverletzers.
363Wenn der Patentverletzer besondere Umstände darlegt, die im Einzelfall eine nicht gerechtfertigte Härte begründen können, kann es im Rahmen einer Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls und bei einer sorgfältigen Abwägung aller Umstände unter Berücksichtigung des Gebotes von Treu und Glauben und der grundsätzlich vorrangigen Interessen des Verletzten an der Durchsetzung seines Unterlassungsanspruchs ausnahmsweise darauf ankommen, ob der Verletzte selbst Produkte oder Komponenten herstellt, die mit dem patentverletzenden Produkt in Wettbewerb stehen, oder ob primär eine Monetarisierung seiner Rechte das Ziel des Patentinhabers ist (BT-Drs. 19/25821, S. 53). Im Übrigen können wirtschaftliche Auswirkungen der Unterlassungsverfügung, die Komplexität von Produkten, subjektive Gesichtspunkte auf beiden Seiten und Drittinteressen zu berücksichtigen sein. So kann etwa zu Lasten des Verpflichteten eine fehlende Lizenzwilligkeit gesehen werden (BT-Drs. 19/25821, S. 54).
364Bei Anwendung dieser Maßstäbe greift der von der Beklagtenseite erhobene Einwand der Unverhältnismäßigkeit nicht durch. Unter Berücksichtigung aller Umstände des zwischen den Parteien geführten Rechtsstreits und ihrer maßgeblichen Interessen hat die Beklagtenseite eine Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs nicht dargetan.
365Soweit auf Verletzerseite zu berücksichtigen ist, ob dieser vor Markteintritt die Patentfreiheit des Produkts sorgfältig geprüft hat oder durch einen Dritten (wie dem Zulieferer der patentverletzenden Komponente eines Endprodukts) hat prüfen lassen, etwa durch eine Freedom-to-operate-Analyse, oder ob er solche Maßnahmen bei Markteinführung des Produkts unterlassen und damit Patentverletzungen in Kauf genommen hat, kann festgestellt werden, dass die Beklagte jedenfalls bereits seit September 2018 – Datum der Veröffentlichung der Anmeldung des Klagepatentes – die Möglichkeit der Kenntnisnahme von diesem hatte und seither keine nachvollziehbaren Anstrengungen unternommen hat, ihre Produkte, die zu diesem Zeitpunkt bereits entwickelt waren, auf eine patentfreie Alternative umzustellen. Der Einwand der Beklagten, man habe erst die Ansicht des Gerichts zur Frage der Auslegung des Klagepatentes und der Verletzung abwarten wollen, überzeugt insoweit nicht. Denn der Verletzer ist gehalten, insbesondere, wenn er sich auf den Unverhältnismäßigkeitseinwand berufen will, frühzeitig Maßnahmen, u.a. im Sinne von Umgehungslösungen, zu ergreifen, die aus einer Patentverletzung herausführen können. Damit erst zu beginnen, wenn eine gerichtliche Entscheidung zu Lasten des Verletzers ergeht, reicht insoweit nicht. Denn die dann erforderliche Zeitspanne, welche nach dem Vorbringen der Beklagten bis zu 29 Monate betragen soll, kann nicht zu Lasten des Patentinhabers gehen.
366Zugunsten der Beklagten fällt im Rahmen der Gesamtabwägung auch nicht ihr Verhalten nach Kenntnis des erhobenen Verletzungsvorwurfs aus. Insoweit kann es von Bedeutung sein, ob ein Verletzer diesen nach Abmahnung oder Erhebung der Verletzungsklage zum Anlass für Bemühungen zur Erlangung einer Lizenz vom Patentinhaber zu angemessenen Bedingungen nimmt (BGH GRUR 2016, 1031 Rn. 53 – Wärmetauscher) oder ob er untätig geblieben ist. Entsprechendes ist vorliegend nicht erfolgt. Die Unternehmensgruppe der Beklagtenseite hat erstmalig kurz vor Ablauf der Duplikfrist versucht, ihr patentverletzendes Handeln durch Abschluss eines Lizenzvertrags zu legitimieren. Die Gespräche führten allerdings offensichtlich nicht zum Erfolg.
367Auch kann der Umstand, dass es sich bei den angegriffenen Ausführungsformen um komplexe Produkte handelt, der Beklagten nicht zum Erfolg verhelfen. Sowohl die angegriffenen Prozessoren als auch die patentgeschützte Technologie sind für den Betrieb der angegriffenen Ausführungsformen unerlässlich und ermöglichen diesen erst. Auch nach Ansicht der Beklagten ist die CPU für die angegriffenen Ausführungsformen unverzichtbar. Die Beklagte bezeichnet die CPU als „Kernstück“ aller Computer. Diese herausragende Bedeutung der CPU spiegelt sich auch im Anteil des Prozessors am Preis des Laptops wider; der Wert des Prozessors im Vergleich zum Laptop beträgt ungefähr ein Drittel. Die Vollstreckung des Unterlassungstenors geht daher nicht über die geschützte Technologie hinaus.
368Es kann auch nicht festgestellt werden, dass – wie von der Beklagten behauptet – Drittinteressen über das übliche Maß hinaus betroffen sind. Die Beklagte behauptet lediglich pauschal, dass sie einen nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung mit Computer-Produkten ausstatten würde und die fehlende Verfügbarkeit ihrer Produkte spürbare Beeinträchtigungen auf die Kunden hätte. Ein solches Vorbringen genügt für die Darlegung von Drittinteressen nicht. Erforderlich wäre es vielmehr, dass die Beklagte vorträgt, dass die spezifischen von ihr angebotenen angegriffenen Ausführungsformen einen maßgeblichen Einfluss für den Erhalt der Gesellschaft haben. Entsprechendes ist auch zweifelhaft, da es sich bei den angegriffenen Produkten nicht um Verbrauchsmaterialien handelt, zu denen die Kunden der Beklagten fortwährend neuen Zugang benötigen. Ein Austausch der Produkte ist erst nach mehreren Jahren der Nutzung üblich. Darüber hinaus bietet die Beklagte selbst Alternativen zu den angegriffenen Produkten an, ebenso wie diverse Konkurrenten der Beklagten. Ein Versorgungsnotstand im Falle eines durchsetzbaren Unterlassungsanspruchs gegen die Beklagte ist mitnichten absehbar, ebenso wenig wie andere für die Gesellschaft als solche spürbaren Beeinträchtigungen.
369Hinzukommt, dass die Beklagte nicht zur Überzeugung der Kammer hinreichend dargetan hat, dass sie die Folgen des Unterlassungsanspruchs unzumutbar hart treffen würden. Die Beklagte nutzt das Klagepatent der Klägerin seit mehreren Jahren ohne Zahlung eines Entgelts und hat die Möglichkeit, einen Lizenzvertrag abzuschließen, der dem Unterlassungsanspruch entgegenstehen würde. Besondere Härten durch den Unterlassungsanspruch, die angesichts dieser Umstände zu einer Unverhältnismäßigkeit führen würden, hat die Beklagtenseite nicht dargelegt. Dass der Verletzer die Herstellung oder den Vertrieb des patentverletzenden Erzeugnisses einstellen und dieses erst dann wieder auf den Markt bringen kann, wenn er sich die dafür erforderlichen Rechte verschafft oder das Erzeugnis patentfrei abgewandelt hat, gehört zu den zwangsläufig mit einer Unterlassungsanordnung verbundenen Härten, die vom Verletzer grundsätzlich hinzunehmen sind.
3702.
371Die Beklagte trifft auch ein zumindest fahrlässiges Verschulden. Denn die Beklagte als Fachunternehmen hätte bei Anwendung der von ihr im Geschäftsverkehr zu fordernden Sorgfalt die Benutzung des Klagepatents erkennen und vermeiden können, § 276 BGB. Für die Zeit ab Erteilung des Klagepatents schuldet die Beklagte daher Ersatz des Schadens, welcher der Klägerin entstanden ist und noch entstehen wird, § 139 Abs. 2 PatG.
372Da die genaue Schadensersatzhöhe derzeit noch nicht feststeht, die Klägerin nämlich keine Kenntnis über den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen durch die Beklagte hat, hat sie ein rechtliches Interesse gemäß § 256 ZPO daran, dass die Schadensersatzpflicht der Beklagten dem Grunde nach festgestellt wird.
3733.
374Um die Klägerin in die Lage zu versetzen, den ihr zustehenden Schadensersatz zu beziffern, ist die Beklagte verpflichtet, im zuerkannten Umfang über ihre Benutzungshandlungen Rechnung zu legen, § 140b PatG i.V.m. § 242 BGB. Entgegen der Auffassung der Beklagten schuldet sie vorliegend auch Rechnungslegung über Gestehungskosten und Gewinne.
375Soweit die Beklagte mit Schriftsatz vom 4. Dezember 2023 die Einstufung der unter Ziffer I. genannten Informationen als geheimhaltungsbedürftig nebst dem Erlass flankierender Anordnungen gemäß der Anträge nach Ziffer II., III. und IV. beantragt hat, ist der entsprechende Antrag bereits unzulässig, § 145a PatG i.V.m. §§ 16 ff. Abs. 1 GeschGehG.
376Schon nach dem Vortrag der Beklagten handelt es sich bei den Informationen, deren Einstufung als geheimhaltungsbedürftig sie begehrt, nicht um streitgegenständliche Informationen im Sinne des § 145a PatG. Als solche gelten gemäß Satz 2 der Norm sämtliche von Kläger und Beklagtem in das Verfahren eingeführten Informationen. Als Verfahren in diesem Sinne ist hierbei das konkret anhängige Gerichtsverfahren zu verstehen (vgl. auch Benkard PatG/Tochtermann, 12. Aufl. 2023, PatG § 145a Rn. 5; ebenso im Übrigen auch das LG Mannheim, Beschluss vom 13.10.2021, Az. 2 O 73/20 ZV II, Rz. 51 f., zitiert nach juris). Der verfahrensrechtliche Geheimnisschutz ist damit streng auf das konkrete anhängige Verfahren bezogen und Regelungen für bislang nicht anhängige Folgeverfahren nicht zugänglich (so zutreffend auch das LG Mannheim, aaO, Rz. 52).
377Die Beklagte begehrt vorliegend die von ihr beantragten Anordnungen für Informationen bei denen bereits unklar ist, ob diese jemals in ein Verfahren eingeführt werden sollen. Soweit die Beklagte einen Geheimnisschutz in einem potentiellen Zwangsvollstreckungsverfahren begehrt, kommt ein solcher bereits deswegen nicht in Betracht, weil ein solches Verfahren nicht anhängig ist. Eine Einführung der Informationen, für welche die beantragten Anordnungen begehrt werden, in das hiesige Erkenntnisverfahren, ist von der Beklagten offenkundig nicht beabsichtigt.
378Die Ausführungen der Beklagten, es handele sich um streitgegenständliche Informationen, da die Beklagte zu ihrer Herausgabe im Rahmen der Auskunft- und Rechnungslegung verpflichtet sei, können nicht überzeugen. Dem Wortlaut der Gesetzesbegründung, auf den die Beklagte abstellt, lässt sich allenfalls entnehmen, dass potentiell schutzfähige Informationen von beiden Parteien in das Verfahren eingeführt sein können und insbesondere der Begriff der streitgegenständlichen Informationen jedenfalls im Anwendungsbereich des § 145a PatG nicht mit dem zivilprozessualen Begriff des Streitgegenstands gleichzusetzen ist. Demgegenüber spricht auch die von der Beklagten zitierte Passage der Begründung von dem konkreten Verfahren, in welche die Information eingeführt werden.
379Die Kammer verkennt nicht, dass die Beklagte sich gegebenenfalls von der Rechtsprechung der Kammer (LG Düsseldorf, Beschluss vom 26. September 2022, Az. 4c O 59/20 ZV I) sowie des Oberlandesgerichts Düsseldorf (OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2023, 873 – Geheimnisschutz II; GRUR 2020, 734 – Cholesterinsenker), nach welcher entsprechende Einschränkungen – sofern man solche annehmen will – der Auskunfts- und Rechnungslegungsverpflichtung materiell-rechtlicher Natur sind und deshalb im Erkenntnisverfahren geltend gemacht werden müssen, aus prozessualer Vorsicht veranlasst sah, einen entsprechenden Geheimnisschutzantrag zu stellen. Indes ist der verfahrensrechtliche Geheimnisschutz nach § 145a PatG für die Geltendmachung solcher potentieller materiell-rechtlicher Einschränkungen prinzipiell nicht geeignet.
3804.
381Die Beklagte ist nach § 140a Abs. 1 und 3 PatG in der zuerkannten Weise auch zur Vernichtung und zum Rückruf der das Klagepatent verletzenden Gegenstände verpflichtet.
382Der Anspruch ist auch nicht unverhältnismäßig, § 140a Abs. 4 PatG. Auch der Unverhältnismäßigkeitseinwand nach § 140a Abs. 4 PatG ist auf enge Ausnahmen beschränkt (zum Vernichtungsanspruch siehe BeckOK PatR/Rinken PatG § 140a Rn. 28, zum Rückrufanspruch BeckOK PatR/Rinken PatG § 140 a Rn. 46). Hier gilt das zum Unterlassungsanspruch Gesagte entsprechend.
383V.
384Der Rechtsstreit war nicht auszusetzen. Die Kammer vermochte nicht festzustellen, dass die im Wege der Nichtigkeitsklage vorgebrachten Einwände gegen den Rechtsbestand des Klagepatents hinreichend wahrscheinlich erfolgreich verlaufen würden.
385Nach Auffassung der Kammern (Mitt. 1988, 91 – Nickel-Chrom-Legierung, BlPMZ 1995, 121 – Hepatitis-C-Virus), die durch das Oberlandesgericht Düsseldorf (GRUR 1979, 188 – Flachdachabläufe; Mitt. 1997, 257, 258 - Steinknacker) und den Bundesgerichtshof (GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug; GRUR 2014, 1237 ff. – Kurznachrichten) bestätigt wurde, stellen ein Einspruch gegen das Klagepatent oder die Erhebung der Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen, da dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist (§ 58 Abs. 1 PatG). Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen.
386Wenn das Klagepatent mit einer Patentnichtigkeitsklage angegriffen ist, verurteilt das Verletzungsgericht, wenn es eine Verletzung des in Kraft stehenden Patents bejaht, grundsätzlich nur dann wegen Patentverletzung, wenn es eine Nichtigerklärung nicht für (überwiegend) wahrscheinlich hält; andernfalls hat es die Verhandlung des Rechtsstreits nach § 148 ZPO auszusetzen, bis jedenfalls erstinstanzlich über die Nichtigkeitsklage entschieden ist (BGH, GRUR 2014, 1237, 1238 – Kurznachrichten). Denn eine – vorläufig vollstreckbare – Verpflichtung des Beklagten zu Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung sowie Vernichtung patentgemäßer Erzeugnisse ist regelmäßig nicht zu rechtfertigen, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten steht, dass dieser Verurteilung durch die Nichtigerklärung des Klagepatents die Grundlage entzogen werden wird. Der aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) in Verbindung mit den Grundrechten folgende und damit verfassungsrechtlich verbürgte Justizgewährungsanspruch gebietet, dem Verletzungsbeklagten wirkungs-vollen Rechtsschutz zur Verfügung zu stellen, wenn er sich gegen den Angriff aus dem Klagepatent mit einem Gegenangriff gegen den Rechtsbestand dieses Patents zur Wehr setzen will. Dies erfordert nicht nur eine effektive Möglichkeit, diesen An-griff selbst durch eine Klage auf Nichtigerklärung führen zu können auch eine angemessene Berücksichtigung des Umstands, dass in diesem Angriff auch ein – und gegebenenfalls das einzige – Verteidigungsmittel gegen die Inanspruchnahme aus dem Patent liegen kann. Wegen der gesetzlichen Regelung, die für die Ansprüche nach §§ 139 ff. PatG lediglich ein in Kraft stehendes Patent verlangt und für die Beseitigung dieser Rechtsposition nur die in die ausschließliche Zuständigkeit des Patentgerichts fallende Nichtigkeitsklage zur Verfügung stellt, kann der Angriff gegen das Klagepatent anders als in anderen Rechtsordnungen nicht als Einwand im Verletzungsverfahren oder durch Erhebung einer Widerklage auf Nichtigerklärung geführt werden. Dies darf indessen nicht dazu führen, dass diesem Angriff jede Auswirkung auf das Verletzungsverfahren versagt wird. Die Aussetzung des Verletzungsstreits ist vielmehr grundsätzlich, aber auch nur dann geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent der erhobenen Nichtigkeitsklage nicht standhalten wird (BGH, GRUR 2014, 1237, 1238 – Kurznachrichten).
387Das BPatG hat am 29. November 2023 einen qualifizierten positiven Hinweis erlassen, wonach es der Nichtigkeitsklage derzeit keine Erfolgsaussichten beimisst. In dem Hinweis finden sich ausführliche Auseinandersetzungen mit der erfindungsgemäßen Lehre einerseits sowie mit den Entgegenhaltungen andererseits. Die Kammer hat keine Erkenntnisse darüber, dass die vorläufigen Feststellungen des BPatG unzutreffend sein könnten. Es besteht daher kein Bedürfnis, entgegen dem Hinweis der fachkundig besetzten Instanz den Rechtsbestand des Klagepatents abweichend zu beurteilen und den Rechtsstreit auszusetzen. Wegen des konkreten Inhalts der Stellungnahme des BPatG wird auf den qualifizierten Hinweis Bezug genommen.
388B.
389Die Entscheidung über die Kosten folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO.
390Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckung ergibt sich aus §§ 709 Satz 1 und 2, 108 ZPO.
391Dabei war die Sicherheitsleistung für die Vollstreckung des Unterlassungsanspruchs in Höhe X € festzusetzen.
392Die Vollstreckungsschäden – und damit die Sicherheitsleistung – entsprechen in aller Regel dem festgesetzten Streitwert. Denn die Bestimmung des Streitwerts richtet sich nach dem Interesse der klagenden Partei an der begehrten gerichtlichen Entscheidung, für dessen Berechnung bei einem – auch hier im Vordergrund stehenden – Unterlassungsanspruch nicht nur der Wert und die Bedeutung der verletzten Rechtsposition des Klägers, sondern ebenso der Umfang der angegriffenen Handlungen maßgeblich sind (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2007, 256 – Sicherheitsleistung/Kaffeepads). Jedenfalls ist die Vollstreckungssicherheit typischerweise nicht höher als der Streitwert einzuschätzen. Denn während es für die Höhe der vom Landgericht anzuordnenden Vollstreckungssicherheit nur auf den mutmaßlichen Vollstreckungsschaden des Schuldners im kurzen Zeitraum bis zur Berufungsverhandlung und der sich daran anschließenden Verkündung der Berufungsentscheidung ankommt, weil mit ihr eine eigene, neue Vollstreckungsgrundlage geschaffen wird, und darüber hinaus nicht vollstreckbare Teile des Urteilsausspruchs (wie der Feststellungstenor) außer Betracht zu bleiben haben, fallen für die Streitwertbemessung sämtliche Klageansprüche und der gesamte Zeitraum bis zum regulären Ende der Patentlaufzeit ins Gewicht (OLG Düsseldorf, GRUR RR 2012, 304 – Höhe des Vollstreckungsschadens). Ist dagegen – ausnahmsweise – zu erwarten, dass eine in Höhe des Streitwerts festgesetzte Sicherheit den drohenden Vollstreckungsschaden nicht vollständig abdecken wird, ist es Sache des Beklagten, dem Gericht die dafür bestehenden konkreten Anhaltspunkte darzulegen (vgl. OLG Düsseldorf, InstGE 9, 47). Hierfür bedarf es weder einer ins Einzelne gehenden Rechnungslegung noch der Ausbreitung von Geschäftsinterna. Ausreichend, aber auch erforderlich ist vielmehr eine generalisierende Darstellung, die die behaupteten Umsatz- und Gewinnzahlen nachvollziehbar und plausibel macht. Hierzu wird es vielfach genügen, auf Dritte ohnehin zugängliche Unterlagen wie Geschäftsberichte oder dergleichen zurückzugreifen oder eine nach Maßgabe der obigen Ausführungen spezifizierte eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers oder eines sonst zuständigen Mitarbeiters vorzulegen (vgl. OLG Düsseldorf, InstGE 9, 47).
393Vorliegend hat die Beklagte mit der eidesstattlichen Versicherung von xxxxxxxxxxxxxxxxxx vorgetragen, dass die Beklagte im Jahr 2022 mit der Sparte Personal Systems der Beklagten eine Marge von ungefähr X erwirtschaftete. Dabei soll die durchschnittliche Bruttomarge (Gross Margin, d.h. Umsatz abzüglich direkter Kosten) für die Sparte Personal Systems X betragen haben. Zum Bereich der Personal Systems gehören, wie die Beklagte in der mündlichen Verhandlung deutlich machte, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Ungeachtet dessen, dass nicht deutlich gemacht wird, wie die Bruttomarge ermittelt wurde, hat die Klägerin durch Vorlage einer Creditreform-Auskunft (Anlage BP 7) vorgetragen, dass die Beklagte in 2022 einen Verlust vom 17.000.000,00 € erlitten hat. Insoweit ist die genannte Marge erst recht nicht nachvollziehbar.
394Geht man zugunsten der Beklagten von einer Bruttomarge von X aus und legt man pauschal einen Prozentsatz von 30 % für weitere Kosten zur Ermittlung der Nettomarge zugrunde, kommt man auf einen relevanten Gewinn von gerundet X Bei einer voraussichtlichen Dauer eines Berufungsverfahrens von einem Jahr, dürfte dieser Wert dem ungefähren Vollstreckungsschaden der Beklagten entsprechen. Soweit die Beklagte ferner eine Festsetzung für eine Sicherheitsleistung für den Rückruf und Vernichtungsanspruch begehrt, kann dem mangels nachvollziehbaren Zahlenmaterials nicht entsprochen werden. Maßgeblicher Schaden sind allenfalls die (Herstellungs-)Kosten der Beklagten. Hierzu erfolgte kein Vortrag. Ferner sind die angegriffenen Ausführungsformen nur für einen Teil des Umsatzes verantwortlich. Auch ist davon auszugehen, dass sich der weit überwiegende Teil der Produkte nicht mehr im Vertriebsweg befinden wird und nur ein Bruchteil der Kunden dem Rückruf nachkommen werden. Da zu diesen Punkten aber kein Vortrag erfolgte, ist die Sicherheitsleistung am Streitwert zu orientieren, wobei sie geringer ausfällt, als der in die Zukunft gerichtete Unterlassungsanspruch.
395Vollstreckungsschutz nach § 712 ZPO war der Beklagten nicht zu gewähren, da die insoweit darlegungs- und beweisbelastete Beklagte einen nicht zu ersetzenden Nachteil bereits nicht glaubhaft gemacht hat.
396Streitwert: 10.000.000,00 €
397Klepsch Wimmers Dr. Janich