 Seite drucken
Seite drucken
 Entscheidung als PDF runterladen
Entscheidung als PDF runterladen
 Seite drucken
Seite drucken
 Entscheidung als PDF runterladen
Entscheidung als PDF runterladen

I. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin X nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz hieraus seit dem 17. August 2022 zu zahlen.
II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages.
Tatbestand
2Die Klägerin macht gegen die Beklagte Schadensersatz der Höhe nach wegen einer Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents 0 955 267 B1 (im Folgenden: Klagepatent), vorgelegt als Anlage HL 9, in deutscher Übersetzung als Anlage HL 9a, geltend.
3Die Klägerin war Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz am Klagepatent, dessen eingetragene Inhaberin die A Ltd. war. Die dem Klagepatent zugrundeliegende Anmeldung wurde am 24. Dezember 1997 unter Inanspruchnahme einer japanischen Priorität vom 27. Dezember 1996 eingereicht. Die Offenlegung der Anmeldung erfolgte am 9. Juli 1998. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 3. September 2003 veröffentlicht. Das Klagepatent erlosch am 24. Dezember 2017 durch Zeitablauf.
4Auf die von der Beklagten erhobene Nichtigkeitsklage wurde das Klagepatent mit Urteil des Bundespatentgerichts vom 21. Juli 2020 eingeschränkt aufrechterhalten. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.
5Das Klagepatent betrifft ein Zirconium-Cerium-Verbundoxid sowie ein Verfahren zur Herstellung und einen Cokatalysator zur Reinigung von Abgas. Die in englischer Verfahrenssprache erteilten Ansprüche 1 und 7 des Klagepatents in der eingeschränkt aufrechterhaltenen Fassung lauteten in der deutschen Übersetzung wie folgt:
6Anspruch 1
7„Zirconium-Cer-Verbundoxid enthaltend Zirconium und Cer in einem Gewichtsverhältnis in einem Bereich von 51 bis 95 : 49 bis 5 als Zirconiumoxid und Ceroxid, wobei das Verbundoxid eine spezifische Oberfläche von nicht weniger als 50 m²/g besitzt und wobei das Verbundoxid in der Lage ist, selbst nach dem Erhitzen bei 1100°C über 6 h eine spezifische Oberfläche von 20 bis 30 m²/g aufrechtzuerhalten.“
8Anspruch 7
9„Cokatalysator zum Reinigen von Abgas, der Pulver eines Zirconium-Cer-Ver-bundoxides enthält, das Zirconium und Cer in einem Gewichtsverhältnis von 51 bis 95 : 49 bis 5 als Zirconiumoxid und Ceroxid umfasst, wobei das Verbundoxid eine spezifische Oberfläche von nicht weniger als 50 m²/g besitzt und das Verbundoxid in der Lage ist, selbst nach dem Erhitzen bei 1.100°C über 6 h eine spezifische Oberfläche von 20 bis 30 m²/g aufrechtzuerhalten.“
10Die Klägerin gehört zum A -Konzern, einem Chemiekonzern mit Hauptsitz in Brüssel, der im Bereich Forschung und Entwicklung sowie Vermarktung von Chemieprodukten tätig ist. Sie schloss mit der Inhaberin des Klagepatents, der A Ltd. (vormals: B Ltd., nachfolgend: Anan Kasei) am 2. Juni 2017 eine Lizenzvereinbarung (Anlage B&B 19).
11Die Beklagte, bis zum 1. September 2016 firmierend unter C Ltd., gehört zu der in Kanada ansässigen Neo Performance Materials-Gruppe, die unter anderem Produkte aus Seltenen Erden und Metallen herstellt. Die Beklagte vertreibt diese Produkte in Europa, insbesondere an Chemie-Unternehmen und Automobilzulieferer. Unter anderem bot die Beklagte in der Bundesrepublik Deutschland an und vertrieb Cer-Zirkonium-Mischoxidprodukte unter den Produktbezeichnungen CZO 5045 und CZO 5078, die für die Herstellung von Katalysatoren verwendet werden.
12CZO 5078 ist ein spezielles Mischoxid-Produkt, das die Beklagte an die D AG & Co. KG (nachfolgend: D ) lieferte und liefert.
13D bezieht CZO 5078 von der Beklagten, um einen so genannten „Washcoat“ herzustellen. Ein Washcoat ist eine Zusammensetzung aus porösen Materialien, mit der ein Träger beschichtet wird und in dem die katalytisch aktiven Substanzen eingelagert sind. Als Träger dient ein temperaturstabiler Wabenkörper, zum Beispiel aus Keramik, der eine Vielzahl dünnwandiger Kanäle aufweist. Zur Herstellung des Washcoat wird das Mischoxid mit zahlreichen anderen Komponenten zu einer schlammigen Mischung („Slurry“) vermischt. D liefert die beschichteten Wabenkörper an ihre Kunden, die so genannten „Canners“, die die beschichteten Waben mit einer Metallumhüllung versehen und an die Automobilhersteller oder den Ersatzteilhandel liefern.
14Die kommerzielle Belieferung von D durch die Beklagte erfolgte ab dem Jahr 2013 nach einem sich über vier Jahre – beginnend im Jahr 2009 – erstreckenden, in der Branche üblichen Qualifizierungsprozess, an dessen Ende sich D und die Beklagte auf die Eigenschaften von CZO 5078 einigten. Bei der Qualifizierung handelt es sich typischerweise um einen umfangreichen und intensiven Abstimmungsprozess zwischen dem Washcoater und seinem Lieferanten. Der Qualifizierungsprozess selbst ist Teil des gesamten Entwicklungsprozesses eines Abgaskatalysators, an dem auch die Kunden der Washcoater – die Hersteller der Auspuffanlagen – und der jeweilige Kfz-Hersteller beteiligt sind. Am Ende des Qualifizierungsprozesses wird ein Katalysatormodell ausgewählt, so dass die Entscheidung für ein bestimmtes Mischoxid der Washcoater jedenfalls nicht allein trifft.
15Die Beklagte sandte im Qualifikationsprozess, in dem später CZO 5078 ausgewählt wurde, in mehreren Austauschrunden unterschiedliche Produktproben an D , ohne dass D jemals von der Beklagten forderte, dass das Produkt eine bestimmte spezifische Oberfläche nach einer Kalzinierung erreichen muss. D teilte der Beklagten am Ende des Qualifikationsprozesses mit, welche Produktprobe ausgewählt wurde und welches das spätere Produkt, das Mischoxid-Produkt CZO 5078, sein sollte.
16Nach der Entscheidung für CZO 5078 als betreffende Produktprobe testeten die Beklagte und D verschiedene Parameter wie etwa Gewichtsanteile der einzelnen Komponenten, Radioaktivität und auch spezifische Oberflächen des Produkts unter bestimmten Kalzinierungsbedingungen und legten sich in einem Analysezertifikat („Certificate of Analysis“, nachfolgend: CoA) fest, die jeder Charge des CZO 5078 beigefügt wird. Ein Exemplar eines CoA für CZO 5078 liegt als Anlage B&B 5 vor.
17Am 26. April 2013 nahm die Beklagte die kommerzielle Belieferung von D mit dem Mischoxid CZO 5078 auf.
18In dem Angebot und Vertrieb der Mischoxid-Produkte CZO 5045 und CZO 5078 sah die Klägerin eine Verletzung des Klagepatents und verklagte die Beklagte.
19Daraufhin wurde mit Urteil der Kammer vom 20. Dezember 2018, für dessen Einzelheiten auf die Anlage HL 3 verwiesen wird, unter anderem
20I. die Beklagte verurteilt,
211. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, chronologisch geordneten Verzeichnisses Auskunft zu erteilen und Rechnung darüber zu legen, in welchem Umfang die Beklagte in der Zeit vom 1. Juli 2007 bis zum 24. Dezember 2017 Zirconium-Cer-Verbundoxide in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, in Verkehr gebracht, gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen hat,
22wenn das Zirconium-Cer-Verbundoxid Zirconium und Cer in einem Gewichtsverhältnis in einem Bereich von 51 bis 95 : 49 bis 5 als Zirconiumoxid und Ceroxid enthält
23und das Verbundoxid eine spezifische Oberfläche von nicht weniger als 50 m²/g besitzt,
24und das Verbundoxid in der Lage ist, selbst nach dem Erhitzen bei 1.100°C über 6h eine spezifische Oberfläche von nicht weniger als 20 m2/g aufrechtzuerhalten;
25mit Ausnahme derjenigen Zirconium-Cer-Verbundoxide, die im Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 24. Dezember 2017 an Unternehmen der BASF-Gruppe geliefert wurden;
262. der Klägerin weiter unter Vorlage eines einheitlichen, chronologisch geordneten Verzeichnisses Auskunft zu erteilen und Rechnung darüber zu legen, in welchem Umfang die Beklagte in der Zeit vom 1. Juli 2007 bis zum 24. Dezember 2017, Dritten in der Bundesrepublik Deutschland Zirconium-Cer-Verbundoxide zur Benutzung angeboten oder geliefert hat, die geeignet sind für
27Cokatalysatoren zum Reinigen von Abgas, die Pulver eines Zirconium-Cer-Verbundoxides enthalten, das Zirconium und Cer in einem Gewichtsverhältnis von 51 bis 95 : 49 bis 5 als Zirconiumoxid und Ceroxid umfasst,
28wobei das Verbundoxid eine spezifische Oberfläche von nicht weniger als 50 m²/g besitzt
29und das Verbundoxid in der Lage ist, selbst nach dem Erhitzen bei 1.100°C über 6 h eine spezifische Oberfläche von nicht weniger als 20 m²/g aufrechtzuerhalten;
30mit Ausnahme derjenigen Zirconium-Cer-Verbundoxide, die im Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 24. Dezember 2017 an Unternehmen der BASF-Gruppe geliefert wurden;
31(…)
32II. (…)
33III. festgestellt, dass die Beklagte dazu verpflichtet ist, der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, der
341. der A A , Ltd. (vormals: D., Ltd.) durch die zu I. bezeichneten, in der Zeit vom 1. Juli 2007 bis zum 31. Dezember 2011 begangenen Handlungen und
352. der Klägerin durch die zu I. bezeichneten, seit dem 1. Januar 2012 bis zum 24. Dezember 2017 begangenen Handlungen
36entstanden ist.
37Die Berufung gegen das Urteil der Kammer wurde mit mittlerweile rechtskräftigem Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 23. Januar 2020, vorgelegt als Anlage HL 4, mit der Maßgabe zurückgewiesen,
38dass es im Tenor unter Ziff. I.1. und I.2. jeweils
39statt „das Verbundoxid eine spezifische Oberfläche von nicht weniger als 50 m²/g besitzt" nunmehr heißt „das Verbundoxid eine spezifische Oberfläche von 50 m²/g bis 120 m²/g besitzt"
40und
41statt „das Verbundoxid in der Lage ist, selbst nach dem Erhitzen bei 1.100°C über 6h eine spezifische Oberfläche von nicht weniger als 20 m²/g aufrechtzuerhalten" nunmehr heißt „das Verbundoxid in der Lage ist, selbst nach dem Erhitzen bei 1.100°C über 6h eine spezifische Oberfläche von 20 m²/g bis 30 m²/g aufrechtzuerhalten"
42heißt.
43Mit Schreiben vom 20. Mai 2020 übermittelte die Beklagte der Klägerin Unterlagen zur Rechnungslegung gemäß Ziffer I. des landgerichtlichen Urteils, darunter eine tabellarische Aufstellung der zu beauskunftenden Angaben. Wegen der Einzelheiten dieser Aufstellung wird auf die Anlage HL 7 Bezug genommen. Demnach veräußerte die Beklagte im zu beauskunftenden Zeitraum vier patentgemäße Mischoxidprodukte, nämlich CZO 5045, CZO 5052, CZO 5078 und CZO 5086.
44Die vorliegende Klage, mit der die Klägerin Schadensersatz der Höhe nach geltend macht, stützt die Klägerin allein auf in der Zeit vom 1. Juli 2016 bis zum 24. Dezember 2017 begangenen Verletzungshandlungen. In diesem Zeitraum lieferte die Beklagte ausschließlich das Mischoxidprodukt CZO 5078 an D im Umfang von insgesamt 66.600 kg, davon 6.000 kg in der zweiten Jahreshälfte 2016 und 60.600 kg im Jahr 2017.
45Am X schloss die Klägerin mit D eine Vereinbarung (nachfolgend: D -Vereinbarung), wonach die Klägerin gegen Zahlungen von D mit Wirkung vom X einerseits X und andererseits X
46Die Klägerin ist der Ansicht, Einwendungen gegen ihre durch die exklusive Lizenz begründete Aktivlegitimation, der Grundsatz der Erschöpfung und eine etwaige Zustimmung zur Patentbenutzung könnten aufgrund der Rechtskraft des landgerichtlichen Urteils vom 20. Dezember 2018 nicht mehr geltend gemacht werden. Aber auch in der Sache seien die Einwendungen unbegründet.
47In erster Linie berechnet die Klägerin ihren Schadensersatz nach dem ihr entgangenen Gewinn, wobei sie die genaue Bezifferung des Schadens in das Ermessen des Gerichts stellt. Sie hält einen Betrag von X für angemessen.
48Die Klägerin ist insofern der Ansicht, die Beklagte habe durch ihre Verletzungshandlungen D s Nachfrage der Klägerin entzogen. Dabei wäre die Klägerin nach dem Zuschnitt ihres Geschäftsbetriebs und aufgrund ihres technischen Know How in der Lage gewesen, diese Nachfrage zu bedienen. D hätte als alternativen Anbieter für ein mit CZO 5078 vergleichbares Mischoxid statt der Beklagten die Klägerin angefragt und ausgewählt. Denn für den hypothetischen Kausalverlauf sei in zeitlicher Hinsicht schon auf den Eintritt der Beklagten in den Qualifizierungsprozess abzustellen. Schon die Probenlieferung der Beklagten sei patentverletzend gewesen. Immerhin habe die Beklagte auch zahlreiche Proben, die andere Patente der Klägerin verletzten, in die Bundesrepublik Deutschland geliefert. Jedenfalls erfülle die Teilnahme am Qualifizierungsprozess den Verletzungstatbestand des Anbietens patentverletzender Produkte, erst Recht aber die Lieferung solcher Proben. Die Beklagte habe dann aber schon mit der Teilnahme am Qualifizierungsprozess die Vorteile der Erfindung erzielt. Bereits dadurch sei es der Klägerin unmöglich gewesen, ihr im Rennen befindliches Produkt mit D zu Ende zu entwickeln. X
49Dazu behauptet die Klägerin, X
50Jedenfalls habe sie – die Klägerin – X
51Messungen hätten ergeben, dass die X eine spezifische Oberfläche vor und nach Kalzinierung im Sinne des Klagepatents aufgewiesen habe und insofern mit dem Produkt CZO 5078 vergleichbar gewesen sei. Allerdings sei der X nach Übersendung dieser X nicht fortgesetzt worden. X Produkts Optalys 430 X, das seit X kommerziell an D geliefert werde. Optalys beruhe auf der X und habe x und fast identische spezifische Oberflächen vor und nach Kalzinierung wie die X. Die Messberichte der spezifischen Oberflächen und die CoA von X sowie Optalys 430 liegen als Anlage HL 27, korrigiert durch Anlage HL 27a, vor.
52Die Klägerin ist der Ansicht, D hätte sich allein schon deshalb an sie gewandt, X und die X genau in dem Zeitraum, welchen die Beklagte für die Qualifikation ihres Produkts CZO 5078 angebe, erfolgt seien. Wäre die Beklagte als potentielle Lieferantin weggefallen, hätte sich D zwecks Erschließung einer neuen Lieferquelle höchstwahrscheinlich an die Klägerin gewandt, X. Es wäre der Klägerin ein Leichtes gewesen, die für CZO 5078 erwarteten Eigenschaften anknüpfend an X zu erreichen und das Produkt der Beklagten mit einem eigenen Produkt zu ersetzen. Die Klägerin hätte mit D das substituierende Produkt Optalys 430 oder ein vergleichbares Produkt qualifiziert, welches jedenfalls im hier eingeklagten Schadenszeitraum 2016 und 2017 zur Verfügung gestanden hätte.
53Entscheidend sei, dass D sich bei einem Wegfall des Verletzungsprodukts an die Klägerin als einzig berechtigte Zulieferin X gewandt hätte. Dauer und Ausgang des Qualifikationsprozesses machten deutlich, dass D ein Produkt mit eben solchen patengemäßen Eigenschaften habe erwerben wollen, wie nur die Klägerin es rechtmäßig habe in Verkehr bringen dürfen. Das Anforderungsprofil stehe durch CZO 5078 und die zugehörigen CoAs fest. Demnach sei die Hitzebeständigkeit des Mischoxids, wie es in den spezifischen Oberflächen unter bestimmten Kalzinierungsbedingungen zum Ausdruck komme, das entscheidende Kriterium. Eine andere technische Eigenschaft könne auch die Beklagte nicht benennen.
54Die patentgemäßen Parameter seien nicht willkürlich gewählt, sondern in ihrer Kombination die typische Kenngröße, nach der die Hitzebeständigkeit eines Mischoxids und damit seine Leistungsfähigkeit bestimmt werde. Dass das Klagepatent auf eine Temperatur von 1100°C abstelle, ergebe sich aus dem Umstand, dass zum Zeitpunkt der Patentanmeldung Abgaskatalysatoren bereits näher am Motor verbaut worden seien und höheren Temperaturen ausgesetzt gewesen seien. Der Temperaturwert sei an den Bedürfnissen der Kfz-Hersteller und folglich an der vorgelagerten Kaufentscheidung der Abnehmer orientiert. Für die konkreten Kalzinierungsbedingungen existiere zwar kein normierter Marktstandard; die Kombination „Temperatur/Zeit/aged surface area“ sei indes gängig und aussagekräftig. Auch wenn keine strenge, mathematische Korrelation relativ zur spezifischen Oberfläche bei anderen Kalzinierungsbedingungen bestehe, gebe die spezifische Oberfläche, die ein Mischoxid nach Kalzinierung bei einer bestimmten Temperatur über einen gewissen Zeitraum aufweise, dem Fachmann Aufschluss über die Leistungsfähigkeit des Mischoxids.
55Die spezifische Oberfläche der Mischoxide sei für die Katalysatorleistung durchaus erheblich. Mischoxide könnten dem Abgas nur dann Sauerstoff entziehen oder zur Verfügung stellen, wenn sie mit dem Abgas in Kontakt kämen. Dieser Kontakt finde aber an der Oberfläche der Mischoxide statt und je größer diese sei, umso besser könne das Mischoxid seine Aufgabe, die katalytische Wirkung, erfüllen. Dass die Kalzinierung an der Umgebungsluft erfolge, sei Praktikabilitätsgesichtspunkten geschuldet, weil Tests unter Abgasatmosphäre zu aufwändig seien. Unerheblich sei es schließlich, ob die technischen Eigenschaften des Mischoxids „durch seine Verarbeitung und seine Einbindung in den washcoat verloren" gingen. In rechtlicher Hinsicht komme es allein auf die Eigenschaften des Mischoxids an.
56Das Klagepatent und die von D durchgeführten Qualifizierungsverfahren mit der Auswahl CZO 5078 als ein patentgemäßes Mischoxid seien auch vor dem Hintergrund des regulatorischen Rahmens und der technischen Entwicklung einzuordnen. Die Verordnung 715/2007/EG vom 20. Juni 2007 habe die Einführung der Euro-5- und Euro-6-Abgasnormen für die Jahre 2009 bzw. 2014 in Aussicht gestellt. Diese Standards sollten zu einer erheblichen Minderung insbesondere der Stickstoffoxidemissionen bei Dieselfahrzeugen führen. Damit sei bereits 2007 für die Kfz-Hersteller absehbar gewesen, erhebliche Anstrengungen zu unternehmen, um die künftigen Grenzwerte einzuhalten. Zugleich habe sich der Trend fortgesetzt, den Katalysator immer näher am Motor zu verbauen, weil der Co-Katalysator erst bei hohen Temperaturen seine abgasreinigenden Eigenschaften effektiv entfalte. Hier trete genau der im Klagepatent beschriebene Zielkonflikt auf. Dementsprechend habe das Entwicklungsziel der Anbieter von entsprechenden Mischoxiden darin bestanden, ein Produkt zu entwerfen, welches gerade bei hohen Temperaturen eine hohe spezifische Oberfläche bewahre. Nur dadurch sei eine dauerhafte Einhaltung der Abgasgrenzwerte erreichbar. Dieses gestiegene Anforderungsprofil habe sich bis zu den Mischoxid-Herstellern übertragen, welche die bestmögliche Hitzebeständigkeit der von ihnen gelieferten Mischoxide hätten gewährleisten müssen. Genau diese strengen regulatorischen Anforderungen und die damit verbundenen technischen Herausforderungen hätten auch D umgetrieben.
57Die Klägerin behauptet, in den entsprechenden Qualifikationsprozessen habe daher D der Klägerin stets vor der endgültigen Qualifikation mitgeteilt, welche Zielwerte hinsichtlich der Hitzebeständigkeit des Mischoxids erreicht werden sollten. Allein dieses Vorgehen, so die Auffassung der Klägerin, ergebe auch einen Sinn, da der Qualifikationsprozess zeit- und kostenintensiv sei und gerade nicht „ins Blaue hinein" betrieben werde. Denn D habe die Mischoxidproben weiterverarbeitet und damit ausgestattete Katalysatoren an den Motoren auf einem Prüfstand getestet. Solche Tests seien äußerst zeit- und kostenaufwendig; sie ohne konkrete Vorgaben hinsichtlich der Hitzebeständigkeit des Mischoxids bei einer bestimmten Temperatur durchzuführen, wäre unökonomisch.
58D sei es entscheidend darauf angekommen, ein möglichst hitzebeständiges Mischoxid im relevanten Temperaturfeld zu erwerben, was in den klagepatentgemäßen Merkmalen konkretisiert werde. Der für die Hitzebeständigkeit des Mischoxids maßgebliche Parameter – spezifische Oberfläche – sei stets der zentrale Abstimmungspunkt, wenn die Klägerin für D andere Mischoxide entwickelt habe.
59Ein Produkt, das D s Anforderungsprofil erfülle, aber nicht das Patent verletze, habe weder direkt erworben noch von Dritten rechtmäßig entwickelt werden können. Wenn D am Ende des Qualifikationsprozesses das später als CZO 5078 bezeichnete Produktmuster ausgewählt habe, sei es D offensichtlich auf den Erwerb eines Mischoxids mit den Eigenschaften von CZO 5078 angekommen, mithin auf ein Mischoxid mit den spezifischen Oberflächen nach den festgelegten Kalzinierungsbedingungen. Andere technische Kriterien seien nicht ersichtlich. Ein solches Mischoxid sei am Markt aber weder vor noch nach der Qualifizierung verfügbar gewesen. Es wäre etwaigen anderen Herstellern – angesichts des Anforderungsprofils von D – aber auch nicht möglich gewesen, ein patentfreies Substitut zu entwickeln. Nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge hätte der Qualifizierungsprozess mit jedem anderen Hersteller nämlich zu einem Produkt geführt, welches dieselben Anforderungen wie CZO 5078 erfüllt hätte – namentlich die Hitzebeständigkeit im Sinne der klagepatentgemäßen Merkmale. Offensichtlich sei es selbst der Beklagten nicht möglich gewesen, ein patentfreies Produkt zu entwickeln, welches D s Anforderungen genügt hätte.
60Die Klägerin wäre daher schon aus Rechtsgründen die einzig denkbare Alternativzulieferin für D gewesen. Zur Lieferung eines Mischoxids wie CZO 5078, auf das sich die Beklagte und D nach langer Abstimmung einigten, sei im Zeitpunkt der ersten Verletzungshandlung einzig und allein die Klägerin berechtigt gewesen. Auch DKK sei nicht berechtigt gewesen. Eine rückwirkende einfache Lizenz ändere nichts daran, dass DKK im Zeitpunkt der ersten kommerziellen Lieferung am 26. April 2013 keine Lizenz gehabt habe.
61Die Klägerin ist auch der Ansicht, dass sie in der Lage gewesen wäre, ein entsprechendes Mischoxid für D in den geforderten Mengen zu produzieren. Sie behauptet, sie habe über hinreichende Produktionskapazitäten verfügt, um D s Nachfrage, wie sie aus der Rechnungslegung der Beklagten hervorgehe, zu bedienen. Für Optalys 430 als Substitut für CZO 5078 hätte sich eine Fertigung im klägerischen Werk in La Rochelle angeboten, dem einzigen Werk in Europa, welches Optalys 430 hätte fertigen können. Ausgehend von diesem Produktionsstandort und sogar unter Reduktion der Kapazitäten auf die konkrete Produktionsroute hätte die Klägerin ausreichend freie Kapazitäten von X im Jahr 2016 beziehungsweise von 61,580 t im Jahr 2017 gehabt, um D s Nachfrage für den deutschen Markt zu bedienen. Dies hätten interne Berechnungen der Gesamtkapazität des Werkes abzüglich der tatsächlichen Produktionsmengen ergeben. Sofern sich die Beklagte auf abweichende Feststellungen des High Court in einem englischen Schadensersatzprozess berufe, vertritt die Klägerin die Ansicht, das englische Verfahren habe sich auf ein anderes Streitpatent und einen anderen Sachverhalt bezogen, unterliege einer abweichenden Rechtsordnung und entfalte auch sonst keinerlei Bindungswirkung für die Kammer. Davon abgesehen habe der Klägerin mit dem Werk in F (China) eine weitere Produktionsstätte zur Verfügung gestanden, welche zur Fertigung von Optalys 430 konkret geeignet gewesen sei und im entsprechenden Zeitraum über weitere Kapazitäten verfügt habe. Die Klägerin hätte ferner zur Belieferung D s nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge auch weitere Produktionskapazitäten aufbauen können und auch tatsächlich aufgebaut. Die Klägerin verfüge als Unternehmen mit herausragender Marktpräsenz auf dem Mischoxidmarkt seit langem über einen leistungsfähigen Geschäftsbetrieb. Es entspreche dem üblichen und wirtschaftlich vernünftigen Vorgehen, erforderliche Kapazitäten aufzubauen, wenn eine entsprechende Nachfrage vorhanden sei. Diese wäre für die Klägerin auch vorab erkennbar gewesen, weil D 2013 einen entsprechenden Abstimmungsprozess mit ihr begonnen hätte und X. Nach alledem komme es nicht darauf an, ob D eine weltweite Belieferung verlangt hätte.
62Der entgangene Gewinn berechne sich auf Grundlage X.
63Rechnerisch ergebe sich demnach ein entgangener Gewinn von X. All dies habe sie – die Klägerin – von einer Buchprüferin in einem Gutachten (Anlage HL 26) nachvollziehen lassen, die keine wesentlichen Beanstandungen festgestellt habe. Höhere Anforderungen an die Darlegung und den Nachweis des entgangenen Gewinns seien im Rahmen der Schadensschätzung nicht erforderlich.
64Die Klägerin stützt den Schadensersatzanspruch hilfsweise auf die Herausgabe des Verletzergewinns. In dieser Hinsicht hält sie einen Betrag in Höhe von 300.000,00 EUR für angemessen. Würden nämlich von den mit den im relevanten Zeitraum erfolgten Lieferungen erzielten Einnahmen (Spalte G der HL 7) die von der Beklagten an ihr Schwesterunternehmen entrichteten Preise für den Erwerb der Mischoxidprodukte abgezogen (Spalte H der HL 7), ergebe sich ein Betrag von 287.750,49 USD (vgl. Aufstellung Anlage HL 12). Insofern sei ein Schadensersatzanspruch von 300.000,00 EUR angemessen. Der Kausalanteil sei in wertender Betrachtung danach zu bestimmen, inwieweit die vom Abnehmer getroffene Kaufentscheidung auf der widerrechtlichen Nutzung der Erfindung beruhe. Die Beklagte betrachte jedoch fälschlich nur isolierte Kalzinierungsbedingungen. Ausschlaggebend sei aber die gesamte Erfindung, mithin die vom Klagepatent hervorgehobene Hitzebeständigkeit des Mischoxids bei gerade den Temperaturen, welche in modernen Katalysatoren vorherrschten. Die Vorteile der Erfindung und damit auch von CZO 5078 würden sich gerade in seiner das Klagepatent verletzenden Hitzebeständigkeit niederschlagen. Entscheidend sei also, inwieweit die Verletzungsform durch die patentgemäßen oder durch andere Eigenschaften geprägt sei. In dem Qualifizierungsprozess hätten sich die Beklagte und D gerade auf die patentgemäßen Eigenschaften geeinigt, die in der Hitzebeständigkeit des Mischoxids ihren Ausdruck fänden, so dass es einer werblichen Herausstellung überhaupt nicht bedurft habe. Da es aber gerade auf die Hitzebeständigkeit angekommen sei und die Beklagte ohne die Patentverletzung das Produkt nicht an D hätte veräußern können, spielten auch eigene Vertriebsbemühungen der Beklagten keine Rolle.
65Die Klägerin beantragt,
66die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin Schadensersatz in einer in das Ermessen des Gerichts gestellten Höhe nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz hieraus seit dem 17. August 2022 zu zahlen.
67Die Beklagte beantragt,
68die Klage abzuweisen.
69Die Beklagte ist der Ansicht, sie habe eine Schadensersatzzahlung nicht zu leisten. Der Klägerin sei schon kein Schaden entstanden, weil sie im streitgegenständlichen Zeitraum schon keine exklusive Lizenz am Klagepatent gehabt habe. Eine rückwirkende Lizenzerteilung sei nicht möglich. Jedenfalls sei nach dem Schutzzweck der Norm der Klägerin kein Schaden zu ersetzen. Zudem seien etwaige Rechte der Klägerin aus dem Patent aufgrund der D -Vereinbarung erschöpft, jedenfalls habe die Klägerin mit dieser Vereinbarung eine Zustimmung zur Patentbenutzung erteilt. Zahlungen von D im Rahmen der D -Vereinbarung hätten Erfüllungswirkung, müssten aber jedenfalls im Rahmen des Vorteilsausgleichs berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang beantragt die Beklagte zudem,
70die Vereinbarung mit der D AG & Co. KG betreffend das Klagepatent und die angegriffenen Ausführungsformen sowie vollständige Nachweise für die von D an die Klägerin gemäß dieser Vereinbarung geleisteten Zahlungen vorzulegen.
71Weiterhin ist die Beklagte der Ansicht, dass die Klägerin als Schadensersatz keinen entgangenen Gewinn verlangen könne. Ausgangspunkt für den hypothetischen Kausalverfahren sei der Referenzsachverhalt, also die Sachlage im Zeitpunkt der Verletzungshandlung, die frühestens mit der ersten kommerziellen Lieferung von CZO 5078 durch die Klägerin im April 2013 beginne. Die Übersendung der für CZO 5078 entscheidenden Produktprobe habe keine Patentverletzung dargestellt, weil sie nicht in das Inland geliefert worden sei.
72Im April 2013 habe die Klägerin weder ein Substitut für CZO 5078 zur Verfügung gehabt, noch hätte sie ein solches entwickeln können. Selbst wenn sie ein solches zur Verfügung gehabt hätte, sei es nicht wahrscheinlich gewesen, dass D die Klägerin zwecks Qualifizierung eines Mischoxid-Produkts angesprochen hätte. Und selbst dann sei es nicht wahrscheinlich, dass D eine solche Probe qualifiziert hätte. Denn nach ihrem eigenen Vortrag habe die Klägerin mit der X bei D keinen Erfolg gehabt. Es verbiete sich auch die Annahme, D habe ein patentgemäßes Mischoxid gewünscht.
73Grundsätzlich sei die Darstellung im Klagepatent, ein patentgemäßes Verbundoxid sei hitzebeständiger als Verbundoxide aus dem Stand der Technik, unzutreffend. Das Klagepatent habe für die Praxis keine Bedeutung. Mehrere Druckschriften aus dem Stand der Technik würden Verbundoxide offenbaren, die eine hohe spezifische Oberfläche nach Kalzinierung aufwiesen. Das Bundespatentgericht habe die Lehre des Klagepatents für neu befunden, nicht weil es ein „besseres“ oder hitzebeständigeres Mischoxid zum Gegenstand habe, sondern weil die konkreten Kalzinierungsbedingungen im Stand der Technik nicht offenbart gewesen seien. Der Beitrag des Klagepatents zum Stand der Technik beschränke sich auf die Entdeckung eines neuen Parameters. Die Kalzinierungsbedingungen seien als Parameter für die Qualität und Leistungsfähigkeit eines Mischoxids aber ungeeignet. Es gebe dafür im Stand der Technik keinen Standard. Die Kalzinierung erfolge an Luft, obwohl die Mischoxide im Katalysator einer Abgasatmosphäre ausgesetzt seien. Schließlich gingen die Eigenschaften des Mischoxids durch das Washcoating ohnehin verloren.
74Dementsprechend sei es bei der Qualifizierung von CZO 5078 nicht um die Einhaltung von bestimmten speziellen Parametern gegangen, erst Recht nicht von spezifischen Oberflächen unter bestimmten Kalzinierungsbedingungen. Vielmehr stehe die Leistung der von D beschichteten Wabenkörper im Vordergrund, für die D verschiedene Materialien von unterschiedlichen Lieferanten beziehe. Die Eigenschaften des CZO 5078, wie seine spezifische Oberfläche nach Kalzinierung bei 1100°C für 6 Stunden, seien in dem Washcoat nicht mehr vorhanden.
75Der Qualifizierungsprozess stellte sich für den Mischoxid-Hersteller zudem als „Black Box“ dar. Die genauen Anforderungen an die einzureichenden Produktproben seien dem Lieferanten – so auch der Beklagten im Qualifizierungsprozess mit D – weitgehend unbekannt. D habe nie ein Mischoxid mit den patentgemäßen Eigenschaften verlangt. Zudem handele es sich bei der Qualifikation von CZO 5078 nicht um einen bilateralen Kommunikationsprozess der Beklagten und D , in dem Letzere die Produktanforderungen festlege. Es falle vielmehr eine Entscheidung für einen Katalysator. Es sei nach alledem nicht erkennbar, welche Kriterien für die Auswahl von CZO 5078 ausschlaggebend gewesen seien. Die patentgemäßen Merkmale seien jedenfalls für die Praxis und D s Kaufentscheidung irrelevant.
76Dies zeigten auch die erst nach dem Qualifizierungsverfahren festgelegten CoA. Die darin aufgenommenen Parameter dienten dazu, die Übereinstimmung des kommerziell hergestellten und gelieferten CZO 5078 mit der Probe aus dem Qualifikationsprozess sicherzustellen. Es sei ein Mittel der Qualitätskontrolle. Dementsprechend stelle die Festlegung einer spezifischen Oberfläche nach Kalzinierung kein Indiz für die Leistungsfähigkeit eines Mischoxids wie die Hitzebeständigkeit dar, stattdessen hätten die Beklagte und D auch andere Kalzinierungsbedingungen definieren können.
77Die Klägerin sei zudem nicht lieferfähig gewesen. Aus einem im Vereinigten Königreich vor dem High Court geführten Verfahren sei bekannt, dass schon in den Jahren 2015 bis 2017 die bestehenden Lieferaufträge der Klägerin die Kapazität des klägerischen Werks in La Rochelle und des Werks in Anan (von Anan Kasei) überstiegen. Es könne auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Klägerin ihre Kapazitäten erweitert hätte. Dies habe sie schon damals nicht getan, zudem fehle es an substantiierten Vortrag der Klägerin. Soweit sich die Klägerin auf X berufe, habe D jedenfalls ihr – der Beklagten – gegenüber nie eine verbindliche Vorhersage gemacht. D habe CZO 5078 immer kurzfristig und mit schwankenden Mengen bestellt. Demnach sei die Vorhaltung ausreichender Produktionskapazitäten unabdingbar gewesen, die die Klägerin aber gar nicht habe leisten können. Die Möglichkeit, auf etwaige Vorhersagen hin Kapazitäten aufzubauen, habe schon der High Court im englischen Verfahren verworfen. Schließlich habe die Klägerin auch keine Produktionskapazitäten in LiYiang nutzen können. Das dortige Werk gehöre nicht ihr, sondern einer Schwestergesellschaft. Es sei augenscheinlich marode und nicht produktionsbereit und nicht zuletzt hätten die Mischoxide hinzugekauft werden müssen und somit den entgangenen Gewinn geschmälert. Im Übrigen hätte die Klägerin auch den gesamten globalen Bedarf von D mit ihren Lieferungen abdecken müssen, weil auch die Qualifizierungen immer Plattform-bezogen und damit global erfolgten. Daher halte sie – die Beklagte – X Produktionskapazitäten für CZO 5078 bereit wie die Liefermengen, die an die deutschen Standorte von D gingen.
78Für den hypothetischen Kausalverlauf sei weiterhin zu berücksichtigen, dass die Klägerin und die Beklagte nicht die einzigen Mischoxidhersteller seien. Auch DKK und Luxfer seien leistungsfähige Wettbewerber, die ein alternatives Produkt an D hätten liefern können. DKK unterhalte zudem mit A umfangreiche Lizenzen, darunter eine Kreuz-Lizenzvereinbarung zwischen der Klägerin und DKK vom 02. Oktober 2010 (Anlage B&B 28), weiterhin einen Lizenzvertrag vom 01. Oktober 2009, verlängert mit Vereinbarung vom 31. Dezember 2020 (Anlagen B&B 29 und 30). Es ist daher davon auszugehen, dass DKK sogar zur Lieferung patentgemäßer Produkte berechtigt gewesen sei und D seinen Bedarf auch bei DKK hätte decken können.
79Die Beklagte bestreitet den gesamten klägerischen Vortrag zur Schadenshöhe mit Nichtwissen, insbesondere X sowie die Höhe der variablen Kosten des Ersatzprodukts. Es sei schon nicht nachvollziehbar, warum nicht von vornherein die X herangezogen würden. Zudem sei der klägerische Vortrag bereits in sich unschlüssig und für eine richterliche Schätzung unbrauchbar. Die Anhebung der Gewinnmarge entbehre jeglicher Grundlage und werde bestritten. Zu den variablen Kosten in den Jahren 2016 und 2017 trage die Klägerin nicht vor. Auch der Teilkostenansatz sei unzutreffend gewählt, weil dieser voraussetze, dass die Klägerin genügend Produktionskapazitäten habe. Das sei aber gerade nicht der Fall.
80Zum Verletzergewinn behauptet die Beklagte, sie habe versehentlich in Anlage HL 7 für die Lieferung des Produkts CZO 5078 am 15. Dezember 2016 an D den Einkaufspreis nicht von dem Verkaufspreis abgezogen (vgl. Anlage HL 7, S. 1, Z. 47), so dass der Gewinn aus dieser Lieferung zu hoch angegeben worden sei. Die korrigierten Zahlen ergäben sich aus Anlage B&B 4. Demnach betrage der Gesamtgewinn 277.116,03 USD. Bei einem durchschnittlichen USD-EUR-Wechselkurs im Verletzungszeitraum 0,8941 läge der Verletzergewinn bei 247.769,44 EUR. Warum die Klägerin die Schadenssumme ohne jede Begründung auf 300.000,00 EUR erhöht habe, erschließe sich nicht.
81Zudem sei der Kausalanteil zu vernachlässigen. Es gebe keine Erkenntnis darüber, welche Eigenschaften für die Kaufentscheidung von D für CZO 5078 relevant gewesen seien. Auch sonst gebe es zahlreiche Gründe, die gegen einen Kausalanteil und damit gegen einen Verletzergewinn sprächen: Die Erfindung betreffe keinen neuen Gebrauchsgegenstand, noch nicht einmal eine Detailverbesserung. Die patentgemäßen Eigenschaften seien für die Kaufentscheidung von D auch irrelevant. Weiterhin käme es zu Widersprüchen zu anderen Patenten, von deren Lehren CZO 5078 ebenfalls Gebrauch machte, obwohl sie andere Kalzinierungsbedingungen zum Gegenstand hätten. Zudem würden die erfindungsgemäßen Eigenschaften von CZO 5078 in keiner Weise werblich herausgestellt. Sie würden auch nicht stillschweigend erwartet. Letztlich beruhe die Kaufentscheidung von D auf der langjährigen Kooperation der Beklagten mit D . Die Beklagte sei eine verlässliche Lieferantin, die D seit Jahren beliefere, und sei daher auch für den hier maßgeblichen Qualifizierungsprozess angefragt worden. In jedem Fall müsse der Kausalanteil im Hinblick auf die Vielzahl der verletzten Schutzrechte reduziert werden, auch wenn die Klägerin Schadensersatz nur für einen begrenzten Zeitraum verlange.
82Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen verwiesen.
83Entscheidungsgründe
84Die zulässige Klage ist begründet.
Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG in Höhe von X.
Die Klägerin hat gegen die Beklagte dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz aus § Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG aufgrund der schuldhaft unberechtigten Benutzung des Klagepatents durch die Beklagte. Dies steht aufgrund des Urteils der Kammer vom 20. Dezember 2018 in der Fassung des Urteils des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 23. Januar 2020 rechtskräftig fest.
Der Schadensersatzanspruch steht der Klägerin zu. Es ist der ihr entstandene Schaden zu ersetzen. Etwas anderes ergibt sich nicht daraus, dass die Klägerin ihre Ansprüche auf eine exklusive Lizenz stützte, die in einem Vertrag vom 2. Juni 2017 fixiert wurde, in dessen Ziffer 1.1.4 der 1. Januar 2012 als Wirksamkeitsdatum („effective date“) genannt wird. Es kann dahinstehen, ob aufgrund des Ausschlusses einer rückwirkenden Vereinbarung einer Lizenz (BGH, GRUR 2022, 893 – Aminosäureproduktion) die Lizenz erst ab dem 2. Juni 2017 wirksam erteilt war oder ob der Vertrag nicht dahingehend ausgelegt werden muss, dass lediglich eine bereits seit dem Jahr 2012 im Zuge eines Master Distribution Agreements mündlich oder konkludent erteilte Lizenz verschriftlicht wurde. Denn die Schadensersatzpflicht der Beklagten gegenüber der Klägerin steht durch das Urteil der Kammer vom 20. Dezember 2018, bestätigt durch das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 23. Januar 2022, rechtskräftig fest.
88Die materielle Rechtskraft hindert die Gerichte daran, in einem neuen Verfahren unabhängig von der sachlichen Richtigkeit abweichend vom rechtskräftigen Urteil des Vorprozesses zu entscheiden (Zöller/Vollkommer, ZPO 35. Aufl.: Vorbem. zu § 322 Rn. 14). Unter anderem hat das Gericht, wenn es im Zweitprozess den Streitgegenstand des rechtskräftig entschiedenen Erstprozesses als Vorfrage erneut zu prüfen hat, den Inhalt der rechtskräftigen Entscheidung seinem Urteil zugrunde zu legen (BGH, NJW 1993, 3205; NJW 2008, 1227 f.; NJW 2023, 2281 Tz. 11, 12). Es kommt darauf an, ob das im Zweitprozess anzuwendende sachliche Recht das Bestehen oder Nichtbestehen des im Erstprozess rechtskräftig zu- oder aberkannten subjektiven Rechts oder des im Erstprozess rechtskräftig bejahten oder verneinten Rechtsverhältnisses voraussetzt (Zöller/Vollkommer, ZPO 35. Aufl.: Vorbem. zu § 322 Rn. 24).
89Im Streitfall steht bindend fest, dass die Klägerin gegen die Beklagte dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz hat. Dies ergibt sich aus der Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten in Ziffer III. 2. des Tenors des Urteils der Kammer vom 20. Dezember 2018. Den Schadensersatzanspruch der Klägerin kann die Beklagte nicht mit der Begründung zu Fall bringen, dass die Klägerin mangels einer ausschließlichen Lizenz im Verletzungszeitraum nicht aktivlegitimiert gewesen sei. Denn die im Vorprozess unterlegene Partei – hier die Beklagte – kann sich in einem neuen Rechtsstreit zur Erreichung einer gegenteiligen Entscheidung nicht mehr auf solche Tatsachen berufen, die in den Grenzen des Streitgegenstands zu dem „abgeurteilten“ Lebensvorgang gehören und im maßgeblichen Zeitpunkt im Sinne von § 767 Abs. 2 ZPO bereits vorgelegen haben. Damit sind alle Tatsachen ausgeschlossen, die bei einer natürlichen vom Standpunkt der Parteien ausgehenden Betrachtung zu dem durch ihren Sachvortrag zur Entscheidung gestellten Tatsachenkomplex gehört hätten. Die Präklusion durch Rechtskraft tritt ohne Rücksicht auf die subjektive Kenntnis des Betroffenen von der präkludierten Tatsache während des Prozesses ein; sie ist auch von einem Verschulden (Kennenmüssen) der Partei und einer Erkennbarkeit der Tatsache unabhängig (Zöller/Vollkommer, ZPO 35. Aufl.: Vorbem. zu § 322 Rn. 70). Bei dem Einwand, die Beklagte sei mangels ausschließlicher Lizenz nicht aktivlegitimiert gewesen, handelt es sich aber um materiell-rechtliche Einwände zum Anspruchsgrund, deren zugrundeliegenden Tatsachen bereits im Zeitpunkt des Vorprozesses bestanden und auch dort zur Sprache kamen. Die Kammer hat die Aktivlegitimation mit Verweis auf den bestehenden Lizenzvertrag ausdrücklich bejaht. Dass diese Einschätzung im Lichte der jüngsten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes heute hätte anders getroffen werden können, ist unbeachtlich. Die mangelnde Aktivlegitimation kann nicht mehr mit Erfolg als Einwand gegen das rechtskräftig festgestellte, präjudizielle Rechtsverhältnis vorgebracht werden.
Der Schadensersatz ist für die in den Urteilen des Landgerichts Düsseldorf und des Oberlandesgerichts Düsseldorf genannten Benutzungshandlungen zu zahlen. Insbesondere bestimmen sich die Eigenschaften des angebotenen und in den Verkehr gebrachten Mischoxids nach dieser Verurteilung. Die Fassung der Klagepatentansprüche, wie sie sich aus dem Urteil des Bundespatentgerichts vom 21. Juli 2020 ergibt, ist – auch wenn sie sich von der Fassung im Tenor des oberlandesgerichtlichen Urteils unterscheidet – unbeachtlich, da sie keinen Eingang in die Urteile der Kammer oder des Oberlandesgerichts Düsseldorf gefunden hat.
Der Anspruch auf Schadensersatz entfällt auch nicht aufgrund einer Zustimmung der Klägerin zum Inverkehrbringen der angegriffenen Mischoxide durch die Beklagte. Ebenso wenig kann sich die Beklagte, um ihrer Schadensersatzpflicht zu entgehen, auf den Grundsatz der Erschöpfung berufen.
Zunächst steht die Schadensersatzpflicht der Beklagten dem Grunde nach aufgrund der Verurteilung durch die Kammer, bestätigt durch das Oberlandesgericht Düsseldorf, rechtskräftig fest. Es greifen dieselben Erwägungen wie zum Ausschluss des Einwands der mangelnden Aktivlegitimation.
93Denn die rechtskräftige Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten im landgerichtlichen Urteil vom 20. Dezember 2018 ist präjudiziell für die im vorliegenden Verfahren geltend gemachte Höhe des zu zahlenden Schadensersatzes. Zudem handelt es sich bei dem Einwand, die Beklagte habe mit Zustimmung der Klägerin gehandelt, und bei dem Grundsatz der Erschöpfung, um einen materiell-rechtlichen Einwand, dessen zugrundeliegende Tatsachen bereits im Zeitpunkt des Vorprozesses bestanden und von der Beklagten bei entsprechender Kenntnis im Rahmen einer sorgfältigen Prozessführung zur Begründung ihres Klageabweisungsantrags vorgebracht worden wären. Sie können im Folgeprozess nicht mehr mit Erfolg als Einwand gegen das rechtskräftig festgestellte, präjudizielle Rechtsverhältnis vorgebracht werden.
Selbst wenn die Präklusionswirkungen verneint werden sollten, weil die zur Begründung des Erschöpfungseinwands maßgebliche Vereinbarung zwischen der Klägerin und D erst X abgeschlossen wurde, die letzte mündliche Verhandlung im Vorprozess jedoch bereits am 31. Januar 2020 stattfand, führt dies zu keinem anderen Ergebnis. Denn auch dann kann sich die Beklagte nicht mit Erfolg auf den Einwand der Erschöpfung oder eine Zustimmung der Klägerin zum Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform stützen.
95Die Vereinbarung der Klägerin mit D war erst für den Zeitraum ab dem X wirksam. Einen früheren Zeitpunkt hat auch die Beklagte nicht darlegen können. Streitgegenständlich sind jedoch allein Schäden durch vor diesem Zeitpunkt begangene Verletzungshandlungen, so dass die Vereinbarung mit D schon aus diesem Grund keinen Einfluss auf die Ansprüche der Klägerin gegen die Beklagten haben kann.
Aus den vorgenannten Gründen hat der Antrag der Beklagten, der Klägerin die Vorlage der Vereinbarung mit D aufzugeben, keinen Erfolg.
97Ein solcher Vorlageanspruch ergibt sich nicht aus §§ 421, 422 ZPO i.V.m. § 810 BGB. Denn die Voraussetzungen von § 810 BGB liegen nicht vor. Die D -Vereinbarung wurde weder im Interesse der Beklagten errichtet, noch wird in ihr ein zwischen der Beklagten und einem anderen bestehendes Rechtsverhältnis beurkundet, noch enthält die D -Vereinbarung Verhandlungen über ein Rechtsgeschäft zwischen der Beklagten und einem anderen.
98Ebenso wenig sieht sich die Kammer veranlasst, die Vorlage der D -Vereinbarung nach §§ 142, 144 ZPO anzuordnen. Die Voraussetzungen für eine solche Maßnahme stehen, auch wenn von einer Partei angeregt, im Ermessen des Gerichts. Nach § 142 ZPO darf in einem Patentverletzungsprozess die Vorlage einer Urkunde oder sonstigen Unterlage angeordnet werden, wenn ein gewisser Grad an Wahrscheinlichkeit für die Schutzrechtsverletzung oder den geltend gemachten Einwand spricht und wenn die Vorlage zur Aufklärung des Sachverhalts geeignet und erforderlich sowie auch unter Berücksichtigung der rechtlich geschützten Interessen des zur Vorlage Verpflichteten verhältnismäßig und angemessen ist. § 142 ZPO befreit allerdings die Partei, die sich auf eine Urkunde bezieht, nicht von ihrer Darlegungs- und Substantiierungslast. Dementsprechend darf das Gericht die Urkundenvorlage nicht zum bloßen Zwecke der Informationsgewinnung, sondern nur bei Vorliegen eines schlüssigen, auf Tatsachen bezogenen Vortrags der Partei anordnen (OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2023, 35703 (Rn. 126) m.w.Nw.).
99Die Klägerin hat aber substantiiert zum Inhalt der mit D geschlossenen Vereinbarung vorgetragen und nach diesem Vortrag ist eine Relevanz für die von der Beklagten erhobenen Einwände nicht ersichtlich. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür und dies wird auch von der Beklagten nicht behauptet, dass der klägerische Vortrag wahrheitswidrig erfolgt ist. Nach alledem ist die Anordnung einer Vorlage der Vereinbarung mit D nicht geboten.
Der Schadensersatz umfasst den von der Klägerin vorrangig geltend gemachten entgangenen Gewinn. Auf eine andere Berechnungsmethode – insbesondereauf die hilfsweise geltend gemachte Herausgabe des Verletzergewinns – muss sich die Klägerin nicht einlassen.
Gemäß § 252 BGB umfasst der zu ersetzende Schaden auch den entgangenen Gewinn. Darunter sind alle Vermögensvorteile zu verstehen, die dem Geschädigten im Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses zwar noch nicht zugeflossen sind, bei ihm ohne dieses Ereignis aber eingetreten wären (BGH, NJW-RR 1989, 980 (981)). Dies impliziert die Ermittlung eines hypothetischen Rechtsgüterstands (= Rechtsgüterstand ohne das schädigende Ereignis) (vgl. MüKo-BGB/Oetker, 9. Aufl. 2022: § 249 Rn. 19).
102Um den damit einhergehenden Beweisschwierigkeiten für den grundsätzlich darlegungs- und beweisbelasteten Geschädigten zu begegnen, sieht § 252 S. 2 BGB ergänzend zu der Beweiserleichterung aus § 287 ZPO vor, dass jedenfalls der Gewinn als entgangen gilt, welcher nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte. Diese Voraussetzungen sind zu bejahen, wenn es nach den Umständen des Falls wahrscheinlicher ist, dass der Gewinn ohne das haftungsbegründende Ereignis erzielt worden wäre, als dass er ausgeblieben wäre (BGH, NJW 1988, 200 (204); NJW 2002, 825).
103Diese Regelungen entheben den Verletzer zwar der Notwendigkeit, den entgangenen Gewinn genau zu belegen, ersparen es ihm aber nicht, die für eine Schätzung des entgangenen Gewinns erforderlichen Anknüpfungstatsachen darzulegen und nach § 287 ZPO zu beweisen (BGH, GRUR 1962, 509 (513) – Dia-Rähmchen II; GRUR 1980, 841 (842) – Tolbutamid; GRUR 1993, 757 – Kollektion Holiday; NJW 2002, 825). Der Verletzte hat die Umstände darzulegen und in den Grenzen des § 287 ZPO zu beweisen, aus denen sich nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge oder den besonderen Umständen des Falls die Wahrscheinlichkeit des Gewinneintritts ergibt; da die Beweiserleichterungen der § 252 BGB, § 287 ZPO ebenso die Darlegungslast derjenigen Partei, die Ersatz des entgangenen Gewinns verlangt, mindern, dürfen auch an das Vorbringen des Klägers keine zu hohen Anforderungen gestellt werden (BGH, NJW 2002, 825; NJW 2002, 2553; NJW 2017, 1600 Rn. 19; GRUR 2008, 933 – Schmiermittel; OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2023, 29941 Rn. 111 – Glatirameracetat). Insbesondere ist zu berücksichtigen, was ihm in Anbetracht des durch den Schädiger verursachten Geschehens billigerweise zugemutet werden kann (BGH, NJW 2002, 825).
104Über bestrittene Ausgangs- bzw. Anknüpfungstatsachen hat das Gericht allerdings nach § 287 ZPO, § 252 BGB Beweis zu erheben. § 287 Abs. 1 S. 1 ZPO dehnt das richterliche Ermessen für die Feststellung der Schadenshöhe über die Schranken des § 286 ZPO hinaus aus (BGH, GRUR 1997, 741 (743) – Chinaherde) und räumt dem Gericht die Möglichkeit ein, den entgangenen Gewinn unter Berücksichtigung aller Umstände nach billigem Ermessen zu schätzen. § 287 Abs. 1 Satz 2 ZPO sieht zudem eine Einschränkung des Gebots der Erschöpfung der Beweisanträge für den Tatrichter vor, indem dieser Beweisanträgen lediglich im Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens nachgehen muss (BGH, GRUR 1997, 741 (743) – Chinaherde).
105Liegt die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts im Sinne von § 252 S. 2 BGB jedoch vor, wird widerleglich vermutet, dass der Gewinn gemacht worden wäre (BGH, NJW 2017, 1600 Rn. 19). Dem Ersatzpflichtigen obliegt dann der Beweis, dass er nach dem späteren Verlauf oder aus anderen Gründen dennoch nicht erzielt worden wäre (BGH, NJW-RR 2001, 1542; NJW 2017, 1600 Rn. 19).
Zur Ermittlung des hypothetischen Güterstandes der Klägerin, der sich nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen mit Wahrscheinlichkeit eingestellt hätte, sind nicht nur die kommerziellen Lieferungen des Mischoxids CZO 5078 durch die Beklagte an D ab dem 26. April 2013 hinwegzudenken und erst Recht nicht nur die patentverletzenden Lieferungen ab dem im Streitfall geltend gemachten Schadensersatzzeitraum ab dem 1. Juli 2016. Vielmehr ist auf einen Zeitpunkt deutlich vor dem 26. April 2013 abzustellen, wenn nicht gar auf den Zeitpunkt der Lieferung der ersten Probe, die die Beklagte im Nachgang mit D als CZO 5078 qualifizierte. Ausgangspunkt der hypothetischen Betrachtung ist der Wunsch D s nach der Qualifizierung eines Mischoxidprodukts (zu den geforderten spezifischen Eigenschaften dieses Produkts siehe unten), ohne dass bereits eine Entscheidung für eine bestimmte Probe, insbesondere nicht für die Probe zu CZO 5078, gefallen war.
107Der relevante Zeitpunkt für die hypothetische Weiterentwicklung des Sachverhalts, wenn das schädigende Ereignis hinweggedacht wird, kann nicht losgelöst von den tatsächlichen Verhältnissen nach Gutdünken der Parteien in Abhängigkeit der von ihnen erteilten Auskunft über die patentverletzenden Handlungen oder den im Höheprozess geltend gemachten Schadensersatzzeitraum festgelegt werden, wenn sich feststellen lässt, dass die schädigenden Handlungen tatsächlich zu einem anderen Zeitpunkt aufgenommen wurden. Andernfalls ergäbe sich unter Umständen ein anderer hypothetischer Verlauf und infolgedessen ein Schadensersatzbetrag, der nicht gemäß § 249 Abs. 1 BGB geeignet ist, den Zustand herzustellen, der sich ergeben würde, wenn das schädigende Ereignis nicht eingetreten wäre.
108Im vorliegenden Fall wurde das Klagepatent durch die Beklagte bereits vor der ersten kommerziellen Lieferung des Mischoxidprodukt CZO 5078 am 26. April 2013 verletzt. Denn die Aufnahme der kommerziellen Belieferung von D ist das Ergebnis eines mehrjährigen Qualifizierungsprozesses, an dessen Ende D eine von der Beklagten gelieferte Probe eines Mischoxids bestimmte, mit dem die Beklagte D zukünftig beliefern sollte. Bei diesem Mischoxid handelte es sich um das patentverletzende CZO 5078. Selbst wenn die dem Mischoxid CZO 5078 entsprechende Probe nicht in patentverletzender Weise an D geliefert wurde, weil sich die Lieferung ausschließlich im patentfreien Ausland abspielte, war mit der Lieferung zugleich ein patentverletzendes Angebot an D verbunden, das der Probe entsprechende Mischoxid zukünftig zu liefern. Spätestens aber nach der Auswahl dieser Probe durch D ist von einem solchen patentverletzenden Angebot auszugehen. Denn ab diesem Zeitpunkt legten D und die Beklagte die für das zu liefernde Produkt maßgeblichen Eigenschaften, wie sie in den CoA zu CZO 5078 wiedergegeben sind, vertraglich fest. Zudem wurde eine Liefervereinbarung geschlossen. Bereits vor der ersten kommerziellen Lieferung von CZO 5078 fanden also Vertragsverhandlungen, wenn nicht auch über sämtliche Bedingungen einer Belieferung mit CZO 5078, dann jedenfalls über die technischen Einzelheiten des Produkts statt – immer mit dem Ziel, D mit dem Mischoxidprodukt zu beliefern. Bereits dieses Aushandeln eines Liefervertrages oder auch nur der Belieferung von D als solche stellt ein Angebot im patentrechtlichen Sinne dar. Dass dieses Angebot deutlich vor dem 26. April 2013 erfolgte, steht außer Frage, weil die Beklagte D sicherlich nicht ohne Anlass ab diesem Zeitpunkt kommerziell mit CZO 5078 belieferte.
109Vor diesem Hintergrund sind zur Bestimmung des entgangenen Gewinns nicht nur die Lieferungen von CZO 5078 durch die Beklagte an D ab dem 26. April 2013 hinwegzudenken, sondern jegliche auf den Abschluss einer Liefervereinbarung über dieses Mischoxidprodukt gerichteten Verhandlungen der Beklagten mit D . Denn die Beklagte war aus patentrechtlichen Gründen bereits gehindert, das patentverletzende Mischoxidprodukt CZO 5078 anzubieten und D in diesem Sinne eine Belieferung in irgendeiner Weise auch nur in Aussicht zu stellen. Ohne das Angebot der Beklagten über die Lieferung von CZO 5078 an D war im Qualifizierungsverfahren mit der Beklagten auch noch keine Entscheidung über die Belieferung von CZO 5078 gefallen. In dem für die hypothetische Weiterentwicklung des Sachverhalts relevanten Zeitpunkt befand sich D allenfalls mit der Beklagten in einem Qualifizierungsprozess, in dem noch keine Entscheidung über die Auswahl einer Produktprobe oder über die Belieferung mit einem Mischoxid gefallen war und in dem die Auswahl der Probe für CZO 5078 unmöglich war, weil sie nicht angeboten werden konnte.
Zu dem relevanten Zeitpunkt war die Klägerin in der Lage, D ein zu CZO 5078 alternatives Produkt mit den patentgemäßen Eigenschaften anzubieten und eine entsprechende Probe zu liefern.
111X
112Darüber hinaus wies die X auch die erfindungsgemäßen spezifischen Oberflächen auf, nämlich eine frische Oberfläche von X und eine Oberfläche von X nach sechs Stunden Kalzinierung bei 1100°C. Dies steht für die Kammer unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der mündlichen Verhandlung aufgrund des vorgelegten CoA zu der X und dem ergänzenden Messbericht (Anlagen HL 27) mit beigefügter Korrektur (Anlage HL 27a) nach ihrer freien Überzeugung fest. Auf das Bestreiten der Beklagten war weder dem von der Klägerin angebotenen Zeugenbeweis nachzugehen noch die Einholung eines Sachverständigengutachtens vonnöten.
113Das als Anhang zum Messbericht vorgelegte CoA bezieht sich auf das Produkt X und weist als Datum den X auf. X. Aus dem CoA lässt sich nicht nur die chemische Zusammensetzung entnehmen, X. Das CoA beziffert auch die spezifischen Oberflächen (SA = Surface Area) mit X für die frische Oberfläche und mit X für die Oberfläche nach vier Stunden Kalzinierung bei 1100°C. Dass die Oberfläche nur für vier Stunden kalziniert wurde, ist unschädlich. Denn aufgrund des Messberichts steht zur Überzeugung der Kammer fest, dass die Oberfläche nach sechs Stunden Kalzinierung bei derselben Temperatur X aufwies. Dass dieser Wert nur geringfügig niedriger ist als der sich nach vier Stunden Kalzinierung ergebende Wert ist nicht verwunderlich, weil sich die Oberfläche eines Mischoxids nach dem unwidersprochenen Vortrag der Klägerin bereits in den ersten Stunden der Kalzinierung stark verringert, bei weiterer Kalzinierungsdauer aber kaum noch verändert.
114Die Einwände der Beklagten gegen den als Anlage HL 27 vorgelegten Messbericht greifen letztlich nicht durch. Der die Messung durchführende Mitarbeiter Faure hat in dem Messbericht erklärt, die Messung gemäß dem Protokoll für die BET-Messung, basierend auf der N2-Absorption, wie im Standard ASTM D3663-78, veröffentlicht im Journal of the American Chemical Society, 60, 309 (1938) (von der Beklagten vorgelegt als Anlage B&B 40) durchgeführt zu haben. Es handelt sich bei dieser Methode um einen etablierten Standard, den auch das Klagepatent für die Messung der spezifischen Oberflächen definiert. Die Kammer hat keine Zweifel, dass die Messung entsprechend diesem Standard korrekt durchgeführt wurde und belastbare Messergebnisse lieferte. Soweit die Beklagte in der mündlichen Verhandlung darauf hinwies, dass die Probe nur für 35 Minuten statt mehr als drei Stunden entgast worden sei, hat die Klägerin auf Ziffer 7.13 des Standards verwiesen: Die Entgasung sei auf einem externen Gerät vorgenommen worden, so dass auch weniger als eine Stunde auf dem eigentlichen Messgerät entgast werden konnte. Ungeachtet dessen ist nicht vorgetragen, inwiefern eine verkürzte Entgasung zu abweichenden Messergebnissen führt. Dass die Messung im Ergebnis durchaus korrekte Ergebnisse liefert, belegt der Umstand, dass sich andernfalls – wie ausgeführt – ein deutlich anderer Messwert für die Oberfläche nach Kalzinierung ergeben hätte als im CoA angegeben. Soweit die Beklagte in der mündlichen Verhandlung beanstandet hat, es sei unklar, wie im Einzelnen die Messung vorgenommen worden sei, hat die Klägerin ergänzt, dass die Messungen auf Grundlage von vier Messpunkten im linearen Bereich erfolgt sei. Dies entspricht genau den Vorgaben in Ziffer 9.13 des Standards. Dass Herr Faure die Messwerte durch einen ergänzenden Kommentar noch einmal berichtigte (Anlage HL 27a), belegt sogar die Zuverlässigkeit seiner Messungen. Er führt in der Korrektur aus, dass er die Messungen auf zwei verschiedenen Geräten parallel durchgeführt habe, nämlich auf dem MACSORB MH1230 und auf dem TriStar II 3020. Die Messungen auf dem erstgenannten Gerät sollten lediglich der Kontrolle und Bestätigung der Messungen auf dem zweitgenannten Gerät dienen. Allerdings wurden im ersten Messbericht die Werte aus der Messung mit dem erstgenannten Gerät angegeben. Da der Wert für die Oberfläche von X nach Kalzinierung mit X nur marginal von den Messergebnissen des zweiten Geräts mit X abweicht, ist dies ein weiterer Beleg für die Zuverlässigkeit der Messung und die Belastbarkeit der angegebenen Messwerte.
115Die Beklagte kann sich hinsichtlich der von der Klägerin vorgelegten Messberichte mit den CoA (Anlagen HL 27 und 27a) nicht mit Erfolg auf die Verspätung des Vortrags berufen. Der Vortrag war zuzulassen, weil seine Zulassung nach der freien Überzeugung des Gerichts die Erledigung des Rechtsstreits nicht verzögert, § 296 ZPO. Das gilt insbesondere auch für das CoA der Anlage HL 27, in dem erstmals nicht die frische Oberfläche der X geschwärzt ist. Unabhängig davon, ob diese Anlage in prozessual zulässiger Weise in das Verfahren eingeführt wurde, hat sich die Klägerin sie zu eigen gemacht, als sie in der mündlichen Verhandlung für alle an dem Verfahren Beteiligten eingeblendet und erörtert wurde. Die Beklagte hatte Gelegenheit, sich zu den Messungen zu äußern, so dass auch ein Schriftsatznachlass nicht zu gewähren war.
116Nach alledem hatte die Klägerin im relevanten Zeitpunkt mit der X ein Mischoxid in der Hand, das sämtliche Merkmale des Klagepatentanspruchs 1 aufwies X und in seiner Oberfläche nach sechs Stunden Kalzinierung bei 1100°C mit dem Verletzungsprodukt CZO 5078 (29,34 m²/g nach zehn Stunden Kalzinierung bei 1100°C ausweislich Anlage B&B 5) vergleichbar war.
Hätte die Beklagte D nicht das Produkt CZO 5078 angeboten und ab April 2013 geliefert, wäre es nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge wahrscheinlich gewesen, dass die X der Klägerin oder eine vergleichbare Probe mit patentgemäßen Eigenschaften erfolgreich von D qualifiziert worden wäre, zumal sich Alternativprodukte nicht feststellen lassen und auch keine Drittanbieter erkennbar sind.
Nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge ist es – wenn man das Angebot und die Lieferung von CZO 5078 hinwegdenkt – wahrscheinlich, dass D stattdessen die X der Klägerin ausgewählt hätte.
X. Entscheidend ist aber, dass die Beklagte ihr Qualifizierungsverfahren mit D nicht mit CZO 5078 erfolgreich hätte zu Ende bringen können, X, wäre es jedenfalls wahrscheinlich gewesen, dass D die Klägerin aufgefordert hätte, Mischoxid-Proben – gegebenenfalls sogar die X – einzureichen. Denn bei der Klägerin handelt es sich um ein Unternehmen mit hoher Marktpräsenz und Zugang zu leistungsfähigen Mischoxiden, was nicht zuletzt die X unterstreicht. Zwischen ihr und D bestand bereits zum damaligen Zeitpunkt eine langjährige Geschäftsbeziehung. Ebenso, wie D an die Klägerin in dem X herangetreten war, in dem die X geliefert worden war, hätte D auch in dem die Beklagte betreffenden Qualifizierungsprozess die Übersendung von Produktproben durch die Klägerin erfragen können und hätte dies aller Wahrscheinlichkeit nach auch getan (zum Fehlen von Alternativprodukten und Alternativanbietern siehe unten).
120Dann aber wäre es äußerst wahrscheinlich gewesen, dass D die X oder eine vergleichbare patentgemäße Probe ausgewählt hätte. Denn ebenso wie sich in dem mehr als vierjährigen Qualifizierungsprozess der Beklagten letztlich die Probe für das Produkt CZO 5078 gegenüber anderen Proben durchsetzte, wäre zu erwarten gewesen, dass sich stattdessen die X durchgesetzt hätte. Denn beide Proben sind in den für die Auswahl eines Mischoxids entscheidenden Eigenschaften – soweit bekannt – vergleichbar oder gar identisch. X hätte sich – dementsprechend vergleichbar mit der Probe für CZO 5078 – letztlich als das für die am Qualifizierungsprozess Beteiligten leistungsfähigste Mischoxid präsentiert und wäre dementsprechend qualifiziert worden.
Die Leistungsfähigkeit eines Mischoxids, das in einem Cokatalysator verwendet werden soll, wird außer durch seine chemische Zusammensetzung auch durch die Hitzebeständigkeit seiner Oberfläche bestimmt. Letztere wird durch die Fläche der Oberfläche nach Erhitzung oder Kalzinierung des Mischoxids an Luft bei einer bestimmten Temperatur für eine bestimmte Zeit charakterisiert.
122Die Beklagte behauptet zu Recht nicht, dass die spezifische chemische Zusammensetzung eines Mischoxids für seine Leistungsfähigkeit in einem Cokatalysator ohne Bedeutung sei. Die Kammer vermag aber auch nicht der Auffassung der Beklagten zu folgen, wonach die spezifische Oberfläche nach Kalzinierung kein Maß für eine solche Leistungsfähigkeit ist und für die Entscheidung der Washcoater – hier D – für oder gegen die Auswahl eines Mischoxids gänzlich unbeachtlich ist. Ebenso wenig vermag die Kammer der Auffassung beizutreten, bei dem jeweiligen konkreten Wert für die spezifische Oberfläche unter bestimmten Kalzinierungsbedingungen, wie er auch im Klagepatentanspruch angegeben ist, handele es sich um einen für die Charakterisierung der Leistungsfähigkeit und die Qualität eines Mischoxids untauglichen Parameter, insbesondere habe das Klagepatent keine Bedeutung für die Praxis, sondern erschöpfe sich in der Entdeckung eines neuen Parameters oder Eigenschaftsindexes.
Das Klagepatent verlangt in seinem Anspruch 1 für ein patentgemäßes Zirconium-Cer-Verbundoxid eine bestimmte chemische Zusammensetzung und spezifische Oberflächen vor und nach Kalzinierung, die letztlich seine Leistungsfähigkeit ausdrücken sollen.
124Das Klagepatent führt in dieser Hinsicht aus, dass Katalysatoren zum Reinigen des Abgases von Fahrzeugen aus einem katalytischen Metall wie Platin, Palladium oder Rhodium, und einem Cokatalysator zum Verbessern der katalytischen Wirkung des Metalls bestehen, welche beide auf einer Katalysatormatrix, die beispielsweise aus Aluminiumoxid oder Cordierit besteht, gelagert seien. Als derartiger Cokatalysator fänden Ceroxid-enthaltende Materialien Verwendung, die eine Sauerstoffabsorptions- und Sauerstoffdesorptionsfähigkeit besäßen, welche vom Ceroxid stamme, d. h. die Fähigkeit, Sauerstoff unter einer oxidierenden Atmosphäre zu absorbieren und unter einer reduzierenden Atmosphäre zu desorbieren. Mit dieser Sauerstoffabsorptions- und Sauerstoffdesorptionsfähigkeit reinigten die Ceroxid enthaltenden Materialien Abgase von Schadstoffen, wie Kohlenwasserstoffen, Kohlenmonoxid und Stickoxide, mit einem ausgezeichneten Wirkungsgrad. Die Ceroxid enthaltenden Materialien fänden daher in großem Umfang als Cokatalysator Verwendung. Die Eigenschaften von Ceroxid würden durch Zirconiumoxid weiter verbessert. Daher stelle Zirconium-Cer-Verbundoxid heutzutage einen weit verbreiteten Cokatalysator dar, dessen Verbrauch zugenommen habe (Abs. [0002]; Absatzangabe ohne Bezugsangabe sind solche des Klagepatents).
125Zur Aktivierung der Funktion eines aus dem Verbundoxid bestehenden Cokatalysators sei es jedoch kritisch, den Cokatalysator auf einer hohen Temperatur zu halten (Abs. [0003]). Eine niedrige Temperatur des Abgases, beispielsweise beim Start eines Motors, führe zu einem geringen Reinigungsgrad. Die Fahrzeughersteller versuchten gegenwärtig dieses Problem zu lösen, indem sie das Katalysatorsystem nahe am Motor anordneten, um das heiße Abgas unmittelbar nach seiner Abgabe vom Motor in das Katalysatorsystem einzuführen (Abs. [0004]).
126In diesem Fall betreffe ein anderes Problem die Hitzefestigkeit des Katalysators. Generell sei die Wirksamkeit der Abgasbehandlung proportional zum Kontaktbereich zwischen der aktiven Phase des Katalysators und dem Abgas, so dass der Cokatalysator eine ausreichend große spezifische Oberfläche besitzen müsse. Partikel aus herkömmlichem Zirconium-Cer-Verbundoxid wüchsen jedoch, wenn sie über einen langen Zeitraum der Hochtemperatur-Betriebsumgebung ausgesetzt seien, was zu einer reduzierten spezifischen Oberfläche führe. Das herkömmliche Verbundoxid sei somit in Bezug auf die Hitzefestigkeit nicht zufriedenstellend, so dass man Cokatalysatoren benötige, die in der Lage seien, eine große spezifische Oberfläche auf stabile Weise aufrechtzuerhalten (Abs. [0005]).
127Das Klagepatent nennt sodann verschiedene Druckschriften, die Mischoxide und Verfahren zu ihrer Herstellung zum Gegenstand haben (Abs. [0006] bis [0009]). Außer zu Einzelheiten zu den Verfahren führt das Klagepatent auch zur Hitzebeständigkeit der offenbarten Mischoxide aus, die regelmäßig durch eine spezifische Oberfläche, angegeben in m²/g, nach Kalzinierung bei einer bestimmten Temperatur angegeben wird.
128Das Klagepatent formuliert daher als Ziel der vorliegenden Erfindung, ein Zirconium-Cer-Verbundoxid zu schaffen, das eine ausgezeichnete Hitzefestigkeit besitzt, das eine Eignung als Cokatalysator für die Abgasreinigung ermöglicht und das in Lage ist, selbst bei seinem Einsatz in einer Umgebung mit hoher Temperatur eine große spezifische Oberfläche aufrechtzuerhalten.
129Dies soll durch ein Zirconium-Cer-Verbundoxid geschehen mit den Merkmalen des Anspruchs 1 des Klagepatents (in der hier maßgeblichen Fassung des Tenors des Urteils des OLG Düsseldorf vom 23. Januar 2020)
1301. Zirconium-Cer-Verbundoxid
1311.1 enthaltend Zirconium und Cer in einem Gewichtsverhältnis in einem Bereich von 51 bis 95:49 bis 5 als Zirconiumoxid und Ceroxid,
1321.2 wobei das Verbundoxid eine spezifische Oberfläche von als 50 m²/g bis 120 m²/g besitzt
1331.3 und wobei das Verbundoxid in der Lage ist, selbst nach dem Erhitzen bei 1.100°C über 6 h eine spezifische Oberfläche von 20 m²/g bis 30 m²/g aufrechtzuerhalten.
134Das Klagepatent geht demnach davon aus, dass sich die Leistungsfähigkeit von Mischoxiden in ihrer Hitzebeständigkeit in einer Hochtemperatur-Betriebsumgebung ausdrückt. Ein Maß für die Hitzebeständigkeit ist die spezifische Oberfläche des Mischoxids nach Kalzinierung bei einer bestimmten Temperatur für eine bestimmte Dauer, wie sie auch im Klagepatentanspruch zum Ausdruck kommt. Idealerweise spiegeln die Kalzinierungsbedingungen die Bedingungen in der Betriebsumgebung wider. Im Klagepatentanspruch trägt die Temperatur von 1100°C dem Umstand Rechnung, dass die Abgaskatalysatoren näher am Motor verbaut wurden und daher höhere Temperaturen standhalten mussten. Die Kalzinierungsdauer entspricht einer Nutzungsdauer, wie sie auf einer längeren Autofahrt vorkommt.
135Dies schließt nicht aus, abweichende Kalzinierungsbedingungen zu definieren, denen ein erfindungsgemäßes Mischoxid ebenfalls genügen kann. Deshalb können allerdings die im Klagepatentanspruch genannten Werte für die spezifische Oberfläche eines Mischoxids unter bestimmten Kalzinierungsbedingungen nicht einfach als Erfindung neuer Parameter ohne Bedeutung für die Hitzebeständigkeit der Mischoxide abgetan werden. Es mag sein, dass konkrete Kalzinierungsbedingungen in einem Patentanspruch geeignet sind, die Neuheit der Erfindung zu begründen. Darauf kommt es hier aber nicht an. Entscheidend ist, dass sich die Leistungsfähigkeit eines Mischoxids im Sinne einer hohen Hitzebeständigkeit in dem Verhalten seiner Oberfläche im Fall der Kalzinierung zeigt. Das Maß der Hitzebeständigkeit bringt der Patentanspruch mit der Forderung nach bestimmten Werten für die spezifische Oberfläche zum Ausdruck. Dass es andere Schutzrechte mit der Forderung nach spezifischen Oberflächen unter abweichenden Kalzinierungsbedingungen gibt, deren Gegenstand sich aber mit dem des Klagepatents unter Umständen überschneidet, ist nicht ausgeschlossen, schmälert aber nicht die Eignung des Anspruchs, durch die angegebenen Oberflächenwerte und Kalzinierungsbedingungen hitzebeständige Mischoxide zu beschreiben, und schränkt daher auch nicht den Schutzumfang des Klagepatents ein.
Dass die Hitzebeständigkeit eine wesentliche technische Eigenschaft eines in Katalysatoren zu verwendenden Mischoxids und die Werte für die spezifische Oberfläche nach Kalzinierung ein geeignetes Maß für ihre Beschreibung ist, ergibt sich auch aus der fachlichen Praxis.
137Auch wenn es keine Industrienorm und auch sonst keinen Standard für die Leistungsfähigkeit oder Hitzebeständigkeit von Mischoxiden für Katalysatoren gibt, ist die Angabe spezifischer Oberflächen nach einer bestimmten Kalzinierungsdauer in den beteiligten Fachkreisen ein etablierter Parameter zur Kennzeichnung der Hitzebeständigkeit von Mischoxiden mit einer entsprechenden Aussagekraft. Nicht nur in den Patenten der Klägerin wird dieser Parameter verwendet, sondern unstreitig auch in den Patentanmeldungen und Patenten der Beklagten selbst und ihrer Wettbewerber. Ebenso stellte der Kfz-Zulieferer Delphi in einem Aufsatz auf die spezifische Oberfläche unter bestimmten Kalzinierungsbedingungen ab (Anlage HL 21). Und nicht zuletzt in den CoA, die die Mischoxid-Hersteller mit ihren Abnehmern, den Washcoatern, vereinbaren, werden die spezifischen Oberflächen unter konkreten Kalzinierungsbedingungen (Temperatur, Zeit und Umgebungsluft) angegeben. Diese Angaben hätten überhaupt keinen Sinn, wenn sie nicht auch einen Bezug zur Leistungsfähigkeit des Mischoxids in Form seiner Hitzebeständigkeit in einem Cokatalysator hätten.
138Soweit die Beklagte meint, es gehe nur darum, in den CoA die Übereinstimmung des Produkts mit der finalen Produktprobe sicherzustellen, kann dem nicht gefolgt werden. Wenn dem so wäre und die für bestimmte Kalzinierungsbedingungen angegebenen spezifischen Oberflächen neben der konkreten chemischen Zusammensetzung des Mischoxids nicht einmal im Ansatz die Leistungsfähigkeit und Qualität des Mischoxids im Cokatalysator bedingen würden, böte auch die Lieferung verschiedener Chargen von Mischoxiden, die hinsichtlich chemischer Zusammensetzung und spezifischer Oberflächen identisch sind, keine Gewähr für die gleichbleibende Qualität der mit ihnen hergestellten Katalysatoren. Darauf würden sich aber auch die Kfz-Hersteller nicht einlassen.
139Gegen diese Auffassung sprechen auch die technischen Zusammenhänge. Unstreitig müssen die Mischoxide für ihre katalytische Leistung mit dem Abgas in Kontakt treten, um ihm Sauerstoff entziehen beziehungsweise zur Verfügung stellen zu können. Je größer aber die spezifische Oberfläche der Mischoxide – insbesondere bei hohen Temperaturen über eine längere Dauer – ist, desto mehr Abgas kann mit dem Mischoxid in Kontakt treten und reduziert beziehungsweise oxidiert werden, desto höher ist mithin die katalytische Leistung. Dass für die Bestimmung der spezifischen Oberflächen die Kalzinierung an Umgebungsluft stattfindet, hat die Klägerin unwidersprochen damit erklärt, dass sich dies als Standard-Procedere aus Praktikabilitätsgründen etabliert hat, weil eine Kalzinierung unter einer Abgasatmosphäre zu aufwändig ist. Da es in erster Linie darum geht herauszufinden, ob die Oberfläche der Mischoxide temperaturbeständig ist, kommt es weniger auf die Atmosphäre als auf die Temperatur an, unter der kalziniert wird.
140Schließlich kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Mischoxide durch das Washcoating und die weitere Verarbeitung zu einem Cokatalysator sämtliche technischen Eigenschaften und Charakteristika, wie sie in der Angabe der spezifischen Oberfläche unter bestimmten Kalzinierungsbedingungen zum Ausdruck kommen, wieder verlieren. Auch wenn die Bedingungen, unter denen das Washcoating erfolgt, nicht bekannt sind und unklar ist, wie die Mischoxide weiterverarbeitet werden, kann nicht davon ausgegangen werden, dass sämtliche technischen Eigenschaften der Mischoxide, insbesondere ihre Hitzebeständigkeit, verloren gehen oder komplett verändert werden. Die Mischoxide sind im Cokatalysator nach wie vor vorhanden und entfalten dort auch genau die von ihnen geforderte katalytische Wirkung, und das selbst bei höheren Temperaturen über längere Zeiträume, weil es sich andernfalls nicht um leistungsfähige Katalysatoren handelte. Dass dem so sein muss, ergibt sich auch aus dem Vortrag der Parteien in der mündlichen Verhandlung. Demnach hat der Hersteller der Mischoxide trotz identischer chemischer Zusammensetzung der Mischoxide die Möglichkeit, durch Veränderungen am Herstellungsverfahren die Morphologie der Mischoxide zu ändern und so bestimmte technische Eigenschaften der Mischoxide im fertigen Katalysator einzustellen. Als Beispiel nannte die Beklagte die Rückmeldung eines Washcoaters, dass die Starttemperatur des getesteten Katalysators noch zu hoch sei. Es hänge dann von der Erfahrung des Herstellers der Mischoxide ab, wenn er nicht die chemische Zusammensetzung ändern wolle, Veränderungen im übrigen Herstellungsverfahren und damit an der Morphologie der Mischoxide vorzunehmen, um solche technischen Werte wie die Starttemperatur eines Katalysators zu beeinflussen. Vor diesem Hintergrund stellt die spezifische Oberfläche eines Mischoxids unter bestimmten Kalzinierungsbedingungen einen Parameter dar, um die Morphologie des Mischoxids und damit im weitesten Sinne seine Leistungsfähigkeit im fertigen Katalysator zu beschreiben. Auch wenn es noch eine Vielzahl anderer Parameter zur Beschreibung der Morphologie eines Mischoxids geben mag und eine Vielzahl weiterer technischer Eigenschaften im gesamten Prozess zur Herstellung eines Katalysators eingestellt werden kann (die aber von der Beklagten nicht einmal konkret benannt werden), kann nicht jegliche Bedeutung der spezifischen Oberfläche eines Mischoxids nach Kalzinierung für die Leistungsfähigkeit eines Katalysators in Abrede gestellt werden.
Die Leistungsfähigkeit des geforderten Mischoxids in Form seiner Hitzebeständigkeit, wie sie in den Werten für die spezifische Oberfläche nach Kalzinierung zum Ausdruck kommt, war auch in dem Qualifizierungsprozess mit der Beklagten von Bedeutung. Dies folgt zum einen allgemein aus dem gestiegenen Bedürfnis nach leistungsfähigen Mischoxiden für eine verbesserte Abgasreinigung und zum anderen aus dem von D mit der Beklagten vereinbarten CoA.
Es ist unstreitig, dass der regulatorische Rahmen für Kraftfahrzeuge ab dem Jahr 2007 sukzessive Verschärfungen bei den Emissionsgrenzwerten in Aussicht stellte. Für die Jahre 2009 und 2014 war die Einführung der Euro-5- und Euro-6-Abgasnormen vorgesehen, die unter anderem zu einer erheblichen Minderung insbesondere der Stickstoffoxidemissionen bei Dieselfahrzeugen führen sollten. Es war also bereits im Jahr 2007 absehbar, dass die Automobilindustrie Anstrengungen unternehmen musste, um bis zum Inkrafttreten dieser Abgasnormen die geforderten Grenzwerte dauerhaft einhalten zu können.
143Es kam hinzu, dass sich – wie auch im Klagepatent angedeutet – in der Automobilindustrie der Trend fortsetzte, den Katalysator immer näher am Motor zu verbauen. Der Grund für diese Entwicklung war der Umstand, dass der Cokatalysator erst bei hohen Temperaturen seine abgasreinigenden Eigenschaften effektiv entfaltet. Wird der Katalysator näher am Motor platziert, erwärmt sich der Katalysator schneller und erreicht dabei rascher die Temperaturen, bei denen die Abgasreinigung beginnt. Allerdings verringert sich – wie ebenfalls im Klagepatent ausgeführt – mit steigenden Temperaturen die spezifische Oberfläche des Cokatalysators, was wiederum dessen Leistung beeinträchtigt.
144Vor diesem Hintergrund ist verständlich, dass das Entwicklungsziel der Kfz-Hersteller und infolgedessen auch der Washcoater und der Hersteller der Mischoxide als deren jeweilige Zulieferer darin bestand, ein Produkt zu entwerfen, welches gerade bei hohen Temperaturen eine hohe spezifische Oberfläche bewahrt, um dadurch den zukünftigen Abgasnormen gerecht zu werden. Es war mithin Aufgabe insbesondere der Mischoxid-Hersteller, ein hitzebeständiges Mischoxid zu entwickeln und zu liefern.
Genau diesen regulatorischen und technischen Vorgaben war auch D als in der EU ansässiges Unternehmen, das zu den wenigen weltweiten Washcoatern gehört, unterworfen. Ein Indiz dafür, dass auch D sich dieser Entwicklung anschloss, ist die im Jahr 2006 veröffentlichte Patentanmeldung US 2006/052243 A1, in der genau die geschilderten Zusammenhänge wiedergegeben werden (Anlage HL 19, dort Abs. [0007]).
146Das Qualifizierungsverfahren mit der Beklagten, das sich von 2009 bis 2013 erstreckte, fällt genau in den Zeitraum, in dem die Fortentwicklung der Katalysatoren zwingend erforderlich war. Die Qualifizierung von CZO 5078 ist exakt das Ergebnis dieser Entwicklung, die in dem zugehörigen CoA ihren Ausdruck findet. Nicht nur wird ein im Verhältnis zu Ceroxid leistungsfähigeres Mischoxid verlangt, sondern auch eine spezifische Oberfläche von mindestens 45 m²/g nach einer Kalzinierung von zehn Stunden bei 1000°C und von mindestens 20 m²/g nach einer Kalzinierung von zehn Stunden bei 1100°C (vgl. Anlage B&B 5). Damit übertrifft die Kundenspezifikation sogar noch geringfügig die Anforderungen des Klagepatentanspruchs (zehn statt sechs Stunden Kalzinierung), auch wenn die höhere Kalzinierungsdauer keinen nennenswerten Unterschied in der spezifischen Oberfläche ausmachen wird, weil sich diese vor allem zu Beginn des Kalzinierungsprozesses verringert. Tatsache ist, dass das qualifizierte Produkt CZO 5078 zugleich die patentgemäßen Eigenschaften aufweist und insofern als leistungsfähiges, da hitzebeständiges Mischoxid qualifiziert werden kann.
147Gegen die Einschätzung, dass es D gerade auch auf die Auswahl eines hitzebeständigen Mischoxids ankam, lassen sich nicht mit Erfolg die Besonderheiten des Qualifizierungsprozesses ins Feld führen. Es mag sein, dass der Qualifizierungsprozess aus Sicht der Hersteller der Mischoxide weitgehend wie eine „black box“ geführt wird und den Herstellern seitens der Washcoater allenfalls rudimentäre Anforderungen an die zu liefernden Proben mitgeteilt werden. Auch ist zuzugeben, dass die Entscheidung über die Auswahl eines Mischoxids nicht allein beim Washcoater, sondern letztlich durch die Auswahl eines Katalysators durch den Kfz-Hersteller bedingt ist. All dies führt aber nicht dazu, dass die spezifische Oberfläche nach Kalzinierung für die Auswahl des Mischoxids gar keine Rolle spielt.
148Ausgangspunkt ist nach wie vor die Feststellung, dass die spezifische Oberfläche eines Mischoxids nach Kalzinierung seine Leistungsfähigkeit, insbesondere seine Hitzebeständigkeit, widerspiegelt. Dass am Ende eines Qualifizierungsprozesses für die Auswahl eines bestimmten Katalysator-Prototypen, für dessen Herstellung eine bestimmte Probe eines Mischoxids verwendet wurde, eine Vielzahl weiterer technischer und auch wirtschaftlicher Bedingungen mitbestimmend ist, macht den Faktor Hitzebeständigkeit nicht bedeutungslos. Der bloße Umstand, dass die Mischoxid-Hersteller nicht wissen, welche Faktoren mitbestimmend sind und im Vorfeld keine spezifischen Oberflächen und Kalzinierungsbedingungen – vor allem nicht die im Patentanspruch verlangten – kommuniziert werden, bedeutet nicht, dass die Qualität des Mischoxids unbeachtlich ist. Vielmehr ist es doch so, dass – worauf auch die Klägerin in der mündlichen Verhandlung hingewiesen hat – der Mischoxid-Hersteller, wenn er vom Washcoater die Aufforderung erhält, Proben zu liefern, nicht irgendwelche, sondern durchaus die Proben der leistungsfähigeren Mischoxide bereitstellt, wenn er nicht sogar konkrete Vorgaben vom Washcoater erhält. Denn natürlich muss der Katalysator die Abgasnormen einhalten und möchte der Mischoxid-Hersteller mit seiner Probe den Qualifizierungsprozess erfolgreich abschließen. All dies wird aber gerade auch durch die Hitzebeständigkeit des gewählten Mischoxids bedingt. Insofern ist es schlüssig, dass sich am Ende des Qualifizierungsprozesses mit der Beklagten das Produkt CZO 5078 durchsetzte, das aufgrund seiner patentgemäßen Eigenschaften als besonders leistungsfähig einzustufen ist. Die Beklagte hat nicht vorgetragen, welche weiteren Proben sie geliefert haben will, die weniger leistungsfähig sind, deren spezifische Oberflächen also unterhalb der erfindungsgemäßen Oberflächen rangieren und die auch kein anderes Patent der Klägerin verletzen (zu Alternativprodukten im Einzelnen siehe unten), aber gleichwohl einen leistungsfähigen Katalysator ergeben hätten.
149Es kommt hinzu, dass auch der Washcoater ein Interesse daran haben wird, leistungsfähige Gerüste für Cokatalysatoren an die Canner zu liefern und daher nicht blind die gelieferten Mischoxide ihrer Lieferanten unter Aufgabe aller Leistungsmerkmale dem Washcoating-Prozess unterzieht. Selbst wenn also letztlich der Kfz-Hersteller sich für einen bestimmten Katalysator entscheidet, ist seine Leistungsfähigkeit immer auch durch die Auswahl einer Mischoxid-Probe und die Bedingungen eines Washcoating-Prozesses bestimmt, für die der Washcoater maßgeblich Verantwortung trägt. Es kann eben nicht gesagt werden, dass mit der Abgabe der Probe jede Kausalkette von der Lieferung des Mischoxids bis hin zur Herstellung eines leistungsfähigen Katalysators unterbrochen ist und die Bedingungen seiner Auswahl völlig unbestimmt sind.
150Genau zu diesem Zweck, um nämlich die Eigenschaften der Hitzebeständigkeit für zukünftige Lieferungen sicherzustellen, werden diese nach Abschluss des Qualifizierungsverfahrens in einem CoA auch durch die vom Hersteller der Mischoxide einzuhaltenden Werte für die spezifischen Oberflächen nach Kalzinierung festgelegt. Es wäre – wie bereits ausgeführt – technisch sinnfrei, diese Werte festzulegen, wenn sie nicht auch irgendeine Bedeutung für die die Auswahl eines Katalysators am Ende eines Qualifizierungsverfahrens bestimmenden technischen Eigenschaften hätten, mithin für seine Hitzebeständigkeit. Insofern ist es auch unbeachtlich, dass die Eigenschaften erst am Ende des Qualifizierungsverfahrens festgelegt werden und nicht unbedingt vorher vom Washcoater formuliert werden. Denn der Mischoxid-Hersteller wird von sich aus bestrebt sein, hitzebeständige Mischoxide zu präsentieren, die im Qualifizierungsverfahren bestehen und zur Leistungsfähigkeit des Katalysators beitragen. Die Beklagte hat – noch einmal – nicht vorgetragen, welche weiteren durch die Mischoxide bedingten technischen Eigenschaften für einen Katalysator überhaupt von einer solchen Relevanz wie die Hitzebeständigkeit sein können und dass sie in rechtlich zulässiger Weise weniger hitzebeständige Mischoxide in den Qualifizierungsprozess gab, die überhaupt eine Aussicht auf eine Auswahl gehabt hätten.
Wenn nach alledem die Leistungsfähigkeit eines Mischoxids in Form seiner Hitzebeständigkeit ein mitbestimmender Faktor für die Auswahl eines Mischoxids am Ende des Qualifizierungsprozesses ist und sich in dem Qualifizierungsprozess der Beklagten mit der Probe für CZO 5078 ein Produkt durchsetzte, das genau diese Hitzebeständigkeit aufweist, wie sie im Klagepatent beschrieben und in der Fahrzeugindustrie zu der Zeit gefordert wurde, spricht mehr dafür als dagegen, dass sich – wenn das Angebot und die Lieferung von CZO 5078 hinweggedacht werden – stattdessen die Klägerin mit ihrer X oder einer vergleichbaren Probe (nachfolgend durchweg als X bezeichnet) durchgesetzt hätte und dann ein dem heutigen Produkt Optalys 430 vergleichbares Produkt (nachfolgend kurz als Optalys 430 bezeichnet) geliefert hätte. Dass die X ebenfalls patentgemäß und mit den im CoA für CZO 5078 aufgestellten Kundenanforderungen vergleichbar war, ist bereits festgestellt worden.
152Gegen diese Hypothese, dass sich alternativ die X durchgesetzt hätte, kann nicht mit Erfolg eingewandt werden, X. Es ist sogar wahrscheinlich, jedenfalls aber nicht ausgeschlossen, dass X sich D für die Probe der Beklagten entschied. Daraus kann aber nichts hergeleitet werden, weil das Angebot von CZO 5078 und die kommerzielle Lieferung dieses Produkts gerade hinweggedacht werden müssen. Dann wäre aber die X der Klägerin erfolgreich gewesen. X, war es nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge wahrscheinlich, dass die Klägerin durch weitere Anpassungen diesen Bedingungen hätte Genüge tun können. Dies entspricht auch dem Vortrag der Parteien in der mündlichen Verhandlung, wonach es gelegentlich zu Rückmeldungen der Washcoater über die Gründe für den bisherigen Misserfolg einer Probe kommt und der Mischoxid-Hersteller dann in seinen Erfahrungsschatz greift und Anpassungen an dem Herstellungsverfahren vornimmt, um das Mischoxid-Produkt etwas anders einzustellen – von den Parteien auch als „schwarze Magie“ bezeichnet. Von einem Unternehmen mit der technischen Erfahrung, wie sie die Klägerin hat, konnte nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge erwartet werden, dass sie diese Anpassungen vornehmen kann.
153Dafür spricht auch, dass es der Klägerin gelang, X. Die Gründe dafür, dass die X erst so viele Jahre nach der Qualifizierung von CZO 5078 erfolgte, sind nicht bekannt, müssen aber nicht damit zusammenhängen, dass es der Klägerin nicht gelang, die technischen Eigenschaften ihres Produkts einzustellen. Es ist stattdessen wahrscheinlicher, dass nach dem Erfolg von CZO 5078 keine weiteren Qualifizierungsverfahren für dieses Segment durchgeführt wurden. Die Beklagte hatte die Klägerin in diesem Bereich erfolgreich aus dem Markt gedrängt.
154Dass die Klägerin in der Lage war, erfindungsgemäße Mischoxide herzustellen, belegen das Klagepatent und der Umstand, dass ihr im Jahr 2013 die patentgemäße X zur Verfügung stand. Die Kammer ist auch überzeugt davon, dass das Produkt Optalys 430 auf diese X – gegebenenfalls nach einigen Anpassungen – zurückgeht. Denn Optalys 430 hat dieselbe chemische Zusammensetzung wie X und vergleichbare spezifische Oberflächen nach Kalzinierung. Dies ergibt sich aus den von der Klägerin vorgelegten Messberichten und den CoA zu X und Optalys 430 (Anlagen HL 27 und 27a). Nach den CoA hat die X eine Oberfläche von X (frisch) und nach vier Stunden Kalzinierung bei 1100°C von X, während das Produkt Optalys 430 die Werte X und X aufweist. Die aktuellen Messungen der X ergaben für die spezifische Oberfläche nach vierstündiger Kalzinierung bei 1100°C Werte von X für X und von X für Optalys. Die Unterschiede in den Werten der beiden Mischoxide lassen sich unproblematisch damit erklären, dass sich die Mischoxide mit gleicher Zusammensetzung nie so exakt gleichförmig herstellen lassen, dass ihre spezifischen Oberflächen identische Werte aufweisen; daher geben auch die Kundenspezifikationen regelmäßig nur Mindestwerte oder Wertebereiche an. Die hier bestehenden Abweichungen liegen im Bereich des üblichen und sind durch Produktionsschwankungen und Messungenauigkeiten zwanglos erklärbar. Die weiteren von der Beklagten vorgebrachten Einwände gegen diese Untersuchungen und die Rügen gegen die Vorlage und Zulassung dieser Anlagen greifen nicht durch. Insoweit wird auf die Ausführungen zum Bestehen eines Substituts in Form von X und seinen technischen Eigenschaften, die ebenfalls mit diesen Messungen und CoA nachgewiesen worden sind, verwiesen. Im Übrigen bestehen keine Zweifel, dass die Klägerin D mit Optalys 430 beliefert. Dies belegt schon das CoA für eine Lieferung X von Optalys 430 aus dem Jahr X aufgrund einer Bestellung vom X (Anlage HL 27).
Dass die Klägerin mit ihrer X statt der Beklagten mit CZO 5078 im Qualifizierungsprozess erfolgreich gewesen wäre und im Anschluss ein mit Optalys 430 vergleichbares Produkt geliefert hätte, ist auch deshalb wahrscheinlich, weil sich nicht feststellen lässt, dass es Alternativprodukte gab, auf die D hätte zurückgreifen können. Ebenso wenig gab es Drittanbieter, die statt der Klägerin D hätten beliefern können.
156Zwar muss derjenige, der von einem Patentverletzer Ersatz des Gewinns verlangt, der ihm infolge einer durch die patentverletzenden Handlungen verursachten Verminderung seines Umsatzes entgangen ist, dem Gericht die Tatsachen vortragen, die es diesem ermöglichen zu beurteilen, dass er den als Schadenersatz verlangten Betrag tatsächlich als Gewinn erzielt hätte, wenn der Patentverletzer die patentverletzenden Handlungen nicht vorgenommen hätte (BGH, GRUR 1980, 841 (842) – Tolbutamid; GRUR 1993, 757 – „Kollektion Holiday“). Soll dieser Ursachenzusammenhang in Zweifel gezogen werden, so ist es aber Sache des Verletzers darzulegen, dass die vom Schadensersatzkläger behauptete Einbuße ganz oder teilweise durch andere Gründe als die Verletzung verursacht ist (BGH, GRUR 1993, 757 – Kollektion Holiday).
157Es ist allerdings seitens der Beklagten nicht vorgetragen und auch sonst nicht ersichtlich, dass es irgendwelche patentfreien Alternativprodukte gab, die statt der X hätten qualifiziert werden können.
158Zwar befand sich die Beklagte selbst in einem Qualifizierungsprozess mit D , von dem anzunehmen ist, dass die Beklagte in dessen Rahmen nicht nur die Probe für das Produkt CZO 5078 vorgelegt hatte. Es bleibt aber gänzlich unklar, welche weiteren Proben dies waren und welche technischen Eigenschaften sie hatten.
159Sollten diese Proben ebenfalls die patentgemäßen Merkmale verwirklicht haben, wäre die Beklagte schon aus Rechtsgründen gehindert gewesen, sie anzubieten und zu liefern, so dass sie nicht als Alternative zu der X in Betracht kommen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob in den CoA dieser Proben genau die im Klagepatentanspruch genannten Kalzinierungsbedingungen angegeben sind. Maßgeblich ist, dass es sich um Mischoxide handelt, deren Oberflächen unter den Kalzinierungsbedingungen des Klagepatents die beanspruchten Werte aufweisen.
160Sollte es sich um Proben gehandelt haben, deren spezifische Oberflächen Werte unterhalb der vom Klagepatent geforderten Mindestwerte aufwiesen, ist es nicht wahrscheinlich, dass eine dieser Proben in dem Qualifizierungsverfahren mit D Erfolg gehabt hätte. Zunächst ist zu berücksichtigen, dass nicht jede dieser Proben seitens der Beklagten hätte angeboten und geliefert werden können. Die Klägerin ist Inhaberin weiterer Patente und aus den Auskünften zur Verletzung dieser weiteren Patente ergibt sich, dass die Beklagte wiederholt Proben, die die Merkmale dieser weiteren Patente verwirklichten, im relevanten Zeitraum an D sandte (Anlagen HL 14 bis 16). Unabhängig von der technischen Eignung wäre keine dieser Proben als Ersatz für CZO 5078 in Betracht gekommen, weil die Beklagte diese Proben aufgrund der damit verbundenen Patentverletzung gar nicht hätte anbieten und liefern können. Ist für die Bestimmung des entgangenen Gewinns das schädigende Ereignis hinwegzudenken, sind nicht nur die das Klagepatent verletzenden Handlungen, sondern auch solche Handlungen hinwegzudenken, die zur Verletzung anderer Patente des Verletzten führten oder geführt hätten. Allein der Umstand, dass der Verletzte den Schadensersatz auf nur ein Schutzrecht stützt, rechtfertigt es nicht, dem Verletzer die Vorteile aus der Verletzung anderer Schutzrechte zu belassen, vor allem dann, wenn sie sich darin widerspiegeln, dass der entgangene Gewinn des einzig geltend gemachten Schutzrechts geringer oder ganz ausfällt.
161Ungeachtet dessen ist es, selbst wenn die Beklagte gänzlich patentfreie Mischoxide im Qualifizierungsverfahren anbot oder hätte anbieten können, weniger wahrscheinlich, dass eine dieser Proben statt der X Erfolg gehabt hätte. Denn der Umstand, dass sich D gerade für das leistungsstarke, hitzebeständige CZO 5078 entschied, belegt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die vergleichbare X statt der weniger leistungsfähigen Proben durchgesetzt hätte, weil letztere nicht einmal gegen CZO 5078 zum Zuge kamen. Andere technische Eigenschaften, die eine Auswahl patentfreier Proben aufgrund verbesserter Eigenschaften des Katalysators wahrscheinlich machten, sind weder vorgetragen noch ersichtlich. Dass die Beklagte patentfreie Mischoxide, die sogar leistungsfähiger als CZO 5078 waren, im Rennen hatte, behauptet schließlich auch die Beklagte nicht. Zu Recht hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass die Herstellung und Lieferung von Mischoxiden, deren spezifische Oberfläche nach sechs Stunden Kalzinierung bei 1100°C dauerhaft verlässlich oberhalb von 30 m²/g und damit außerhalb des Merkmals 1.3 liegt, zu der Zeit nur eine theoretische Möglichkeit darstellten.
162Soweit die Beklagte darauf verweist, die Kaufentscheidung von D habe auf der langjährigen Kooperation mit der Beklagten als verlässliche Lieferanten beruht, während die technischen Eigenschaften nicht entscheidend gewesen seien, steht dies im Widerspruch zu dem von der Beklagten selbst behaupteten geringen Einfluss der Washcoater bei der Auswahl des Mischoxids im Qualifizierungsprozess. Der Einwand geht aber auch deshalb ins Leere, weil die Kaufentscheidung für CZO 5078 aufgrund der patentverletzenden Eigenschaften gerade hinweggedacht werden muss und die Verfügbarkeit patentfreier Mischoxide, die sich im Qualifizierungsprozess insgesamt – nicht nur bei D – durchgesetzt hätten, gerade nicht ersichtlich ist.
163Die vorstehenden Erwägungen zum Fehlen von Alternativprodukten der Beklagten gelten in gleicher Weise für mögliche Alternativprodukte von Drittanbietern. Solche Alternativen sind weder vorgetragen noch ersichtlich. Daran ändert auch der Verweis auf verschiedene vom Bundespatentgericht im Nichtigkeitsverfahren gewürdigte Druckschriften aus dem Stand der Technik nichts, die bestimmte spezifische Oberflächen nach Kalzinierung bei einer hohen Temperatur über eine längere Zeit aufweisen, wie in der folgenden Tabelle von der Beklagten zusammengestellt:
164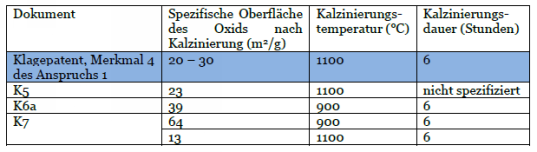
Es kann dahingestellt bleiben, ob diese Druckschriften tatsächlich Mischoxide offenbaren, die eine vergleichbare Hitzebeständigkeit wie das klagepatentgemäße Mischoxid offenbaren. Immerhin ist in einem Fall die Kalzinierungsdauer nicht angegeben, in zwei Fällen liegt die Kalzinierungstemperatur mit 900°C deutlich unter der klagepatentgemäßen Kalzinierungstemperatur und im letzten Fall ist die spezifische Oberfläche nach klagepatentgemäßer Kalzinierung mit 13 m²/g deutlicher geringer als vom Klagepatentanspruch 1 gefordert. Ungeachtet dessen ist jedoch weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass es zu diesem druckschriftlichen Stand der Technik korrespondiere Mischoxide – und sei es als Proben – am Markt gab, die in einem Qualifizierungsverfahren hätten angeboten werden können. Weiterhin bleibt unklar, ob diese Mischoxide – wenn sie wie von der Beklagten behauptet ebenso leistungsfähig sind wie die klagepatentgemäßen Mischoxide – nicht auch das Klagepatent verletzt hätten und insofern gar nicht hätten angeboten und geliefert werden dürfen. Allerdings hat es aufgrund der eingangs dieses Absatzes genannten Unterschiede zur patentgemäßen Lehre den Anschein, dass die druckschriftlich offenbarten Mischoxide weniger hitzebeständig sind als das klagepatentgemäße Produkt. Dann ist es aber auch nicht wahrscheinlich, dass sich eines von ihnen in einem Qualifizierungsverfahren gegen die leistungsfähigere Probe der Klägerin durchgesetzt hätte.
Die Kaufentscheidung von D für ein mit der X korrespondierendes Mischoxid wie Optalys 430 wäre auch deshalb wahrscheinlich gewesen, weil es keine Drittanbieter gab, die ein vergleichbares Produkt anboten oder hätten anbieten können.
167Es ist nichts dafür ersichtlich, dass in den Qualifizierungsverfahren, X, weitere Anbieter Produktproben einreichten. Als weitere Anbieter, die Mischoxide hätten herstellen und liefern können, nennt die Beklagte DKK und Luxfer. Dass diese beiden Unternehmen aber ein patentfreies Mischoxid im Programm hatten oder gar hätten entwickeln können, dem D statt der X den Vorzug gegeben hätte, ist nicht ersichtlich. Anhaltspunkte, wie ein solches Mischoxid hätte beschaffen sein können, sind nicht vorgetragen. Insofern ist auch der Verweis der Beklagten auf das Produktportfolio von DKK und Luxfer (Anlagen B&B 27 und 31) ohne jegliche Substanz. Vielmehr zeigen – wie ausgeführt – die Entwicklung der Abgasreinigung in der Automobilindustrie im Allgemeinen und das mit der Beklagten abgehaltene Qualifizierungsverfahren im Besonderen, dass es D auf den Erhalt eines hitzebeständigen Mischoxids, wie es durch die klagepatentgemäßen Eigenschaften zum Ausdruck kommt, ankam. Ein solches Mischoxid konnten aber DKK und Luxfer schon aus Rechtsgründen nicht liefern.
168Für Luxfer ist unstreitig, dass das Unternehmen zur Benutzung der Lehre des Klagepatents nicht berechtigt war. Aber auch DKK hatte im relevanten Zeitraum keine Lizenz am Klagepatent und war nicht zur Benutzung berechtigt. Zwar bestanden zwischen der Klägerin bzw. der A -Gruppe und DKK verschiedene Lizenzvereinbarungen. Es ist aber nicht ersichtlich, dass mit diesen Vereinbarungen bis zum hier relevanten Zeitpunkt 2012/2013, als die Qualifizierung von D abgeschlossen und die Lieferung aufgenommen wurde, das Klagepatent lizenziert war.
169Der von der Klägerin und DKK im April und Mai 2010 unterzeichnete Lizenzvertrag, wirksam vom 1. Oktober 2009 bis 30. September 2016, geändert im Januar 2014 zwecks Einbeziehung eines chinesischen Joint Ventures und verlängert mit im März 2015 unterzeichneter Vereinbarung (Anlagen B&B 29 und 30), nennt in dem die lizenzierten Patente aufführenden Anhang weder das Klagepatent noch die Patentfamilie, der das Klagepatent entstammt. Insofern unterscheidet sich der Sachverhalt von dem dem Urteil der Kammer vom 14. März 2024 (Az. 4b O 7/23) zugrundeliegenden Sachverhalt, in dem jedenfalls die Patentfamilie des betroffenen Patents im Anhang genannt war. Daher kann der Lizenzvertrag nicht dahingehend ausgelegt werden, dass jedenfalls solche Patente lizenziert sein sollten, in deren Gegenstand die Produkte von DKK fallen. Es ist weder vorgetragen, dass DKK überhaupt ein klagepatentgemäßes Mischoxidprodukt herstellte und anbot, noch gibt es einen Anhaltspunkt dafür, dass die Parteien eine so weitreichende Vereinbarung treffen wollten. Dass weder das Klagepatent noch dessen Patentfamilie im Lizenzvertrag genannt sind, lässt nur den Schluss zu, dass es auch nicht lizenziert werden sollte.
170Auch der zwischen der Klägerin und DKK im Februar und März 2011 unterzeichnete Kreuzlizenzvertrag (Anlage B&B 28) lässt, soweit er nicht geschwärzt ist, nicht erkennen, dass das Klagepatent lizenziert sein sollte. Vielmehr hat die Klägerin in ihrem Vortrag erkennen lassen, dass DKK erst lange nach 2013 und auch nach 2016 eine einfache Lizenz am Klagepatent rückwirkend erteilt wurde. An der Wahrscheinlichkeit des hier skizzierten hypothetischen Kausalverlaufs ändert das jedoch nichts. Denn tatsächlich war DKK im maßgeblichen Zeitraum 2012 und danach nicht zur Benutzung des Klagepatents berechtigt. DKK hätte weder ein patentgemäßes Produkt anbieten noch liefern können. Dass eine etwaige Patentverletzung später durch eine rückwirkende Lizenz rechtlich legitimiert worden wäre, ändert nichts daran, dass für die hier maßgebliche hypothetische Betrachtung DKK im maßgeblichen Zeitraum nicht patentfrei hätte anbieten und liefern können.
Die Kammer kommt unter Würdigung aller Umstände nach freier Überzeugung auch zu dem Schluss, dass die Klägerin in der Lage gewesen wäre, D mit einem auf X basierenden Produkt zu beliefern, so wie es später auch mit Optalys 430 der Fall war.
Für die Frage, ob die Klägerin die Lieferkapazitäten und -fähigkeiten hatte oder hätte aufbauen können, um den Bedarf von D an einem Mischoxid des Typs CZO 5078 zu ersetzen, gelten ebenfalls die bereits eingangs genannten Beweiserleichterungen des § 252 S. 2 BGB und § 287 Abs. 1 ZPO. Vor allem, soweit die Klägerin die erforderlichen Lieferkapazitäten (noch) nicht hatte, handelt es sich um eine hypothetischen Geschehensablauf, von dem bereits dann auszugehen ist, wenn er nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte. Statt der sonst für die Überzeugungsbildung des Gerichts erforderlichen Gewissheit vom Vorhandensein bestimmter Tatumstände zur Begründung des Ursachenzusammenhangs zwischen schädigender Handlung und Schadenseintritt genügt die bloße Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Geschehensablaufs (BGH, GRUR 1993, 757 – Kollektion Holiday). Zwar muss der Geschädigte – wie bereits ausgeführt – konkrete Anknüpfungstatsachen darlegen und gegebenenfalls nachweisen (BGH, GRUR 2008, 933 – Schmiermittel; GRUR 2016, 860 – Deltamethrin). Allerdings gilt § 287 ZPO nicht nur für die Schadenshöhe, sondern auch für die Ermittlung des ursächlichen Zusammenhangs zwischen konkretem Haftungsgrund und Schadenseintritt (BGH, NJW 1964, 661 (663)). Zu berücksichtigen ist auch, dass es für den Nachweis eines wettbewerblichen Schadens – für einen Schaden aus einer Patentverletzung gilt nichts anderes – in der Natur der Sache liegende Beweisschwierigkeiten gibt, vor allem was die künftige Entwicklung des Geschäftsverlaufs betrifft. Im Hinblick darauf sind an die Darlegung der Mindestvoraussetzungen für den Schadenseintritt und die Schätzung eines solchen Schadens keine zu hohen Anforderungen zu stellen (vgl. BGH, GRUR 1997, 741 – Chinaherde; GRUR 2008, 933 – Schmiermittel; GRUR 2016, 860 – Deltamethrin). Insbesondere ist zu berücksichtigen, was dem Geschädigten in Anbetracht des durch den Schädiger verursachten Geschehens billigerweise zugemutet werden kann (BGH, NJW 2002, 825).
Werden die patentverletzenden Angebote und Lieferungen von CZO 5078 durch die Beklagten an D hinweggedacht und wird es – wie bereits eingehend begründet – als wahrscheinlich angesehen, dass stattdessen die Klägerin mit ihrer X die Qualifizierung erfolgreich abgeschlossen hätte, ist Ausgangspunkt der weiteren Betrachtung, ob die Klägerin lieferfähig gewesen wäre, die Zeit ab April 2013, als auch die Beklagte die kommerzielle Lieferung von CZO 5078 aufnahm, unter Umständen auch etwas später, wenn unterstellt wird, X.
174Die Klägerin hat zu ihren Produktionskapazitäten für das Produkt Optalys zu dieser Zeit nicht konkret vorgetragen. Dies ist jedoch unschädlich. Denn nachdem die Klägerin in ihrem Qualifizierungsverfahren nicht zum Zuge gekommen war, bestand auch kein Anlass, Produktionskapazitäten freizuhalten oder alsbald zur Verfügung zu haben. Hinzu kommt, dass es sich bei dem auf der X basierenden Produkt um ein neues Produkt handelte, mit dessen erstmaliger Produktion die Klägerin überhaupt erst hätte beginnen müssen. Mit anderen Worten handelt es sich bei der Überlegung, ob die Klägerin hinsichtlich ihrer – gegebenenfalls noch zu schaffenden Produktionskapazitäten – auch lieferfähig gewesen wäre, um eine rein hypothetische Betrachtung, für die die eingangs geschilderten Beweiserleichterungen gelten. Insofern spricht mehr für als gegen die Annahme, dass die Klägerin D auch hätte beliefern können.
175Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass ein Unternehmen, welches an einem Qualifizierungsprozess teilnimmt, auch lieferwillig und lieferfähig sein wird – so auch die Klägerin. Es erscheint ausgeschlossen, dass ein Unternehmen wie die Klägerin am Ende eines kostenintensiven, zeitaufwändigen, aber erfolgreichen Qualifizierungsverfahrens dem Washcoater mitteilt, es könne oder wolle gar nicht liefern. Davon ausgehend stellt sich allenfalls die Frage, ob der Mischoxid-Hersteller im Anschluss an das Qualifizierungsverfahren die Menge an Mischoxid liefern kann, die sich der Washcoater bestenfalls wünscht, oder ob in der Hinsicht in zeitlicher oder mengenmäßiger Hinsicht Abstriche zu machen sind.
176Regelmäßig treffen der Mischoxid-Hersteller und der Washcoater im Fall einer erfolgreichen Qualifizierung eines Mischoxids eine Liefervereinbarung über die künftige Lieferung des nun qualifizierten Mischoxids. Unstreitig besteht auch zwischen der Beklagten und D eine solche Liefervereinbarung, mit der jedenfalls die Rahmenbedingungen für die Belieferung von D mit CZO 5078 festgehalten wurden. X Unabhängig von der Frage, ob D sich in solchen Vereinbarungen verpflichtet, Vorhersagen über zukünftige Liefermengen zu machen („forecasts“) und ob solche Vorhersagen verbindlich sind, ist unstreitig, dass die Liefervereinbarungen die Modalitäten über die Bestellung und den Abruf der Ware sowie die Bedingungen für die Lieferung der bestellten Mengen, gegebenenfalls auch für die Bereithaltung noch nicht bestellter Mengen und in dem Zusammenhang auch die Folgen einer Verletzung der insofern auferlegten Pflichten, regeln. Die Beklagte trägt selbst vor, dass der Mischoxid-Hersteller in aller Regel eine Pflicht zur Vorhaltung bestimmter Produktionskapazitäten (sic!) und eine Pflicht zur Lieferung auf Abruf habe, während der Käufer wiederum in der Regel keine Pflicht zur Abnahme bestimmter Mengen habe. Wäre also statt CZO 5078 das Mischoxid X qualifiziert worden, hätten die Klägerin und D sicher eine entsprechende Liefervereinbarung über die Belieferung mit dem darauf basierenden Produkt geschlossen. Im Rahmen der Verhandlung über die Vereinbarung hätten sich die Vertragspartner aber auch über die zukünftigen zu erwartenden Liefermengen – wenn auch unverbindlich – ausgetauscht. Anders ist es nicht denkbar, dass die Vertragspartner eine gemeinsame Regelung über die vorzuhaltenden Produktionskapazitäten treffen. Im Übrigen ist weder dem Washcoater daran gelegen, dass seine Bestellungen nicht oder verspätet geliefert werden, noch möchte der Mischoxid-Hersteller dauerhaft gegen seine Pflichten aus der Liefervereinbarung verstoßen und regresspflichtig werden. Aus kaufmännischer Sicht ist es daher sehr wahrscheinlich, dass sich D und die Klägerin im Rahmen der Verhandlung über die Liefervereinbarung über zu erwartende Bestellmengen und -zeiten, Produktionskapazitäten und mögliche Liefermengen jedenfalls ansatzweise ausgetauscht hätten, so dass die Klägerin eine begründete Entscheidung darüber hätte treffen können, ob neue Kapazitäten aufgebaut werden mussten oder die vorhandenen Kapazitäten genügten.
177Die Kammer hat auch keine Zweifel, dass es der Klägerin möglich gewesen wäre, neue Produktionskapazitäten aufzubauen, und sie dies auch getan hätte, wenn es notwendig gewesen wäre. Bei der Klägerin handelt es sich um ein marktstarkes, leistungsfähiges Unternehmen der global tätigen A -Gruppe. Sie betreibt bereits in La Rochelle eine Anlage zur Herstellung von Mischoxiden, mit der das Produkt Optalys 430 hätte hergestellt werden können. In F besteht eine weitere Produktionsstätte einer Schwestergesellschaft. Es hätte vernünftigem kaufmännischem Vorgehen entsprochen, die Anlage in La Rochelle zu erweitern, wenn aufgrund der von D absehbar geforderten Mischoxidmengen eine weitere Produktionslinie erforderlich gewesen wäre. Der Aufbau einer neuen Linie dauert nach dem Vortrag der Parteien zwischen einem und anderthalb Jahren.
178Dagegen kann die Beklagte nicht mit Erfolg einwenden, die Klägerin widerspreche sich selbst, wenn sie anderweitig vortrage, das Vorhalten leerer Produktionskapazitäten sei unwirtschaftlich und daher zu vermeiden. Der Vortrag der Klägerin lässt einen Widerspruch nicht erkennen. Vielmehr ist zu unterscheiden zwischen dem tatsächlichen und dem hypothetischen Geschehensablauf. Da nicht die Klägerin, sondern die Beklagte mit der Lieferung patentverletzender Mischoxide bei D tatsächlich zum Zuge kam, wäre es unwirtschaftlich gewesen, Kapazitäten aufzubauen, weil sie nicht genutzt worden wären. Hätte D aber bei hypothetischer Betrachtung die Probe der Klägerin qualifiziert, stellt sich die Lage anders dar. Dann hätte bei der Prognose entsprechender Bedarfsmengen hinreichender Anlass für den Aufbau neuer Kapazitäten bestanden.
179Damit hätten spätestens anderthalb Jahre nach erfolgreicher Qualifizierung ausreichende Produktionskapazitäten bereitgestanden, wenn diese nicht ohnehin von Beginn an ausgereicht hätten. Insofern ist zu berücksichtigen, dass die Klägerin verschiedene Möglichkeiten hatte, auch im Rahmen bestehender Kapazitäten auf Bestellungen ihrer Abnehmer zu reagieren. Zunächst wird sie bestrebt gewesen sein, freie Kapazitäten zu nutzen und auszulasten. Darüber hinaus hätte sie über Priorisierungen den Produktionsablauf bis zu einem gewissen Grad so steuern können, dass sie allen Abnehmern im Rahmen ihrer Lieferverpflichtungen weitgehend gerecht worden wäre. Insofern erscheint es auch nicht ausgeschlossen, dass die Klägerin mit D eine Regelung über die Vorhersagen über die im nächsten Quartal oder in einem weiteren Zeitraum voraussichtlich zu liefernden Mischoxid-Mengen getroffen hätte. Es kommt nicht darauf an, ob die Klägerin oder die Beklagte mit D eine solche Regelung tatsächlich in ihre Liefervereinbarungen aufgenommen hatte und ob solche Vorhersagen verbindlich waren. Maßgeblich ist ein hypothetischer Geschehensablauf, der nicht 1:1 der geschäftlichen Entwicklung zwischen der Beklagten und D entsprechen muss. Entscheidend ist insofern aber, dass es in der Kfz-Zuliefererbranche nicht unüblich gewesen zu sein scheint, Vorhersagen über die voraussichtlichen Liefer- oder Abrufmengen zu treffen oder gar Lieferpläne weiterzugeben. Die Beklagte selbst hat entsprechende Liefer- und Einkaufsbedingungen von BMW, Volvo und Daimler und deren Zulieferer ZF genannt, die zwar einhellig die Verbindlichkeit solcher Vorhersagen ausschließen. In jedem Fall sind solche Vorhersagen aber geeignet, Lieferanten eine gewisse Planungssicherheit zu geben und abschätzen zu lassen, ob die Produktionskapazitäten ausreichen oder neue Kapazitäten aufgebaut werden müssen. Es ist jedenfalls nicht unwahrscheinlich, dass die Beklagte im Zuge des Abschlusses einer Liefervereinbarung und auch danach von D jedenfalls so weit über die Bedarfsmengen informiert gewesen wäre, dass sie ihre Lieferpflichten weitgehend hätte erfüllen können – sei es mit den vorhandenen oder mit zugebauten Produktionskapazitäten.
Jedenfalls für den hier geltend gemachten Schadenszeitraum in den Jahren 2016 und 2017 hätte die Klägerin ausreichende Produktions- und Lieferkapazitäten gehabt, um dem Bedarf von D gerecht zu werden. Unstreitig lieferte die Beklagte CZO 5078 im Umfang von 6.000 kg vom 1. Juli 2016 bis zum Ende des Jahres und 60.600 kg im Jahr 2017. Die Kammer hält es für sehr wahrscheinlich, dass die Klägerin in der Lage gewesen wäre, diese Mengen mit ihrem auf X basierenden Ersatzprodukt Optalys 430 ebenfalls zu liefern. Wenn die Klägerin nicht anlässlich der Qualifizierung dieses Produkts und der absehbaren Lieferverpflichtungen nicht ohnehin ihre Produktionskapazitäten ausgebaut hätte, waren jedenfalls im Jahr 2016 und 2017 ausreichend Produktionskapazitäten in der Anlage La Rochelle vorhanden. Nach dem Vortrag der Klägerin waren basierend auf ihrer internen Berechnung der Gesamtkapazität (im Normalbetrieb) und den aus dem Betriebswirtschaftsprogramm SAP stammenden tatsächlichen Produktionsmengen im Jahr 2016 auf der für Optalys A vorgesehenen Produktionslinie noch freie Kapazitäten im Umfang von X und im Jahr 2017 von X vorhanden. Damit hätten sich unschwer die von D abgerufenen Mengen decken können.
181Soweit die Klägerin in der mündlichen Verhandlung unter Bezugnahme auf die Anlage HL 28 diese Zahlen korrigierte, weil der auf der Anlage produzierte Ausschuss nicht berücksichtigt worden sei, macht dies keinen Unterschied. Demnach hätten freie Kapazitäten im Umfang von (gerundet) X (2016) bzw. X (2017) vorgelegen. Diese liegen in der Größenordnung der mit der Triplik vorgetragenen Kapazitäten und hätten ebenfalls den Bedarf von D an CZO 5078 gedeckt, vor allem wenn berücksichtigt wird, dass im Jahr 2016 ein Überschuss hätte produziert werden können, der im Jahr 2017 hätte abverkauft werden können.
182Die dagegen gerichteten Einwendungen der Beklagten greifen nicht durch. Die Kammer macht insofern von ihrem Ermessen Gebrauch, auf das Bestreiten der Beklagten nicht den von der Klägerin angebotenen Beweisen nachzugehen. Schon aus den eingangs genannten Gründen ist grundsätzlich von einer hinreichenden Lieferbereitschaft und -fähigkeit der Klägerin auszugehen. Die von der Klägerin vorgetragenen Kapazitäten für das Jahr 2016 und 2017 und ihre Erörterung an dieser Stelle dienen nur einer weiter vertieften Begründung und Plausibilisierung. Der Klägervortrag ist insofern hinreichend substantiiert und für die Schadensschätzung ausreichend. Die Beklagte zeigt keine grundsätzlichen methodischen Fehler in der Herangehensweise der Klägerin auf. Ebenso wenig trägt sie Anhaltspunkte dafür vor, die den klägerischen Vortrag so unstimmig erscheinen lassen, dass er letztlich für eine Schadensschätzung nicht mehr genügt. Vielmehr zeigen die vorgenommenen Korrekturen und die „engen“ Berechnungsergebnisse (z.B. X Kapazität gegenüber X Liefermenge im Jahr 2017) das Bemühen der Klägerin um eine wahrheitsgemäße Wiedergabe der tatsächlichen Produktionsverhältnisse in den Jahren 2016 und 2017. Aus den vorgenannten Gründen führt der Vortrag der Klägerin auch nicht zur Verzögerung des Rechtsstreits und ist daher nicht verspätet.
183Im Übrigen gilt, dass die Klägerin nach ihrem Vortrag die Gesamtkapazität auf der Grundlage von Erfahrungswerten, wie insbesondere der täglich bei SAP eingegebenen Produktionsmengen und der im Normalbetrieb verfügbaren Arbeitstage sowie dem im Normalbetrieb verfügbaren Personal, kalkuliert, wobei bereits großzügige Zeitpuffer für Faktoren eingebaut sind, die sich negativ auf die Gesamtproduktion auswirken können. Es handele sich um eine realistische Angabe, die in der Praxis im Werk regelmäßig erreicht werde, und die auch gegenüber den Abnehmern einhaltbar sein müsse und sei. Gegen eine solche Berechnung auf empirischer Grundlage wendet sich auch die Beklagte nicht im Einzelnen. Eines Beweises der konkreten Berechnung bedurfte es nach dem Maßstab des § 287 Abs. 1 S. 2 ZPO nicht. Gleiches gilt für die aus dem Betriebswirtschaftssystem SAP extrahierten Produktionsmengen. Gestützt wird dieser Vortrag durch die Ausführungen im KSB-Gutachten (Anlage HL 26). Dieses von einem von der Klägerin beauftragten Wirtschaftsprüfungsbüro erstellte Gutachten ist lediglich als weiterer Parteivortrag zu qualifizieren und nicht als gerichtliches Gutachten, so dass es nicht der Offenlegung der entsprechenden SAP-Daten bedurfte, die auch dem Wirtschaftsprüfungsbüro vorlagen (so aber für ein gerichtliches Gutachten BGH, NJW 1988, 3016). Letztlich kommt es auf dieses Gutachten aber im Zusammenhang mit den Lieferkapazitäten aufgrund des sonstigen Klägervortrags nicht an.
184Nach dem schriftsätzlichen Vortrag der Klägerin und ihren Ergänzungen in der mündlichen Verhandlung ist weiterhin davon auszugehen, dass auf der für Optalys A vorgesehenen Produktionslinie auch das Substitut für CZO 5078 hätte hergestellt werden können. Das pauschale Bestreiten der Beklagten angesichts des substantiierten Vortrags der Klägerin geht ins Leere. Bei Optalys handelt es sich um eine Produktpalette neben Actalis. Zu unterscheiden sind Optalys A und B, die unterschiedliche chemische Zusammensetzungen haben. Optalys 430 gehört zu Optalys A und wird auf der entsprechenden Produktionslinie in der Anlage La Rochelle jedenfalls seit X hergestellt. Weiterhin steht – wie ausgeführt – fest, dass Optalys 430 dieselbe chemische Zusammensetzung und vergleichbare spezifische Oberflächen wie X aufweist. Vor dem Hintergrund dieser substantiierten Ausführungen bedarf es keiner weiteren Ausführungen, dass ein auf X basierendes Produkt, vergleichbar oder identisch mit dem späteren Optalys 430, bereits im Jahr 2016 und 2017 in La Rochelle auf der Produktionslinie Optalys A hätte produziert werden können. Insofern mag es sein, dass je nach Mischoxid bestimmte Verfahrensparameter verändert werden müssen. Eine gewisse Umstellung der Produktionslinie ist bei veränderten Eigenschaften eines Mischoxids nicht ausgeschlossen Grundsätzlich ist aber davon auszugehen, dass Mischoxide mit gleicher Zusammensetzung auch auf derselben Produktionslinie hergestellt werden können und die Umstellung der Linie im Rahmen des Produktionsplans kurzfristig bewerkstelligt werden kann. In keinem Fall dauert sie 18 Monate. Das wäre nur dann der Fall, wenn eine neue Anlage erbaut werden müsste, was – wie ausgeführt – bei zu geringen Kapazitäten auch nicht ausgeschlossen war.
185Ebenso wenig kann aus einem Urteil des High Court des Vereinigten Königreichs vom 29. März 2022 (Anlage B&B 24) in einem das Patent EP 1 435 338 betreffenden Verfahren, in dem die Klägerin ebenfalls entgangenen Gewinn wegen der Lieferung des Ceroxid-Produkts „C100N“ durch die Neo-Gruppe von Großbritannien ins Ausland an G geltend machte, etwas für ein Fehlen von Lieferkapazitäten der Klägerin hergeleitet werden. Die Begründung des High Courts für die Verneinung des entgangenen Gewinns, wonach die Klägerin und H zwischen 2015 und 2017 keine Kapazität gehabt hätten, um Ceroxid-Produkte herzustellen und diese statt Neo an G zu liefern, lässt sich auf den Streitfall nicht übertragen. Aus den Feststellungen des Urteils ergibt sich, dass Maßstab für die erfolgreiche Geltendmachung von entgangenem Gewinn keine Wahrscheinlichkeitsbetrachtung im Sinne von § 252 BGB ist. Zudem betraf das Verfahren Ceroxid-Produkte, die nach dem Vortrag der Klägerin nicht auf der Produktionslinie für Optalys A hergestellt werden können – jedenfalls nicht ohne umfangreichere Umbauten –, so dass aus Lieferengpässen bezüglich der Ceroxid-Produkte nichts für etwaige Kapazitäten zur Herstellung von Optalys A hergeleitet werden kann. Der gesamte aus dem Urteil des High Court abgeleitete Sachvortrag lässt jedenfalls nicht erkennen, dass es nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge nicht wahrscheinlich war, dass die Klägerin im Jahr 2016 und 2017 ausreichend Kapazitäten zur Herstellung und Lieferung eines Ersatzprodukts für CZO 5078 hatte oder diese zuvor hätte aufbauen können.
186Insbesondere kann nicht angenommen werden, dass die Klägerin nicht willens war, Kapazitäten auszuschöpfen oder aufzubauen, um die Nachfrage bedienen zu können. Selbst wenn es ausweislich des englischen Urteils mit dem potentiellen Abnehmer G Lieferschwierigkeiten – die Beklagte hat insofern nur zu Produktionsrückständen vorgetragen – gab, bedeutet das nicht, dass die Klägerin letztlich nicht ihre Lieferverpflichtungen erfüllte, und erst Recht nicht, dass sie ihre Lieferverpflichtungen nicht erfüllen wollte. Noch weniger lässt dies den Schluss zu, dass die Klägerin trotz erfolgreicher Qualifizierung ihrer Probe gar keine Liefervereinbarung mit D abgeschlossen hätte. Dann ist aber der gewöhnliche Lauf der Dinge, dass die Klägerin diese Lieferverpflichtungen auch einhält, sofern nicht greifbare Anhaltspunkte diesen Ablauf unwahrscheinlich machen. Von Letzterem kann aus den vorgenannten Gründen nicht ausgegangen werden.
187Weiterhin kommt es auch nicht entscheidend darauf an, ob D die Liefervereinbarung für seinen nationalen, europäischen oder globalen Bedarf geschlossen hätte. Es ist anzunehmen, dass das Qualifizierungsverfahren und die Liefervereinbarung jeweils Plattform-bezogen erfolgen. Selbst wenn D nun verlangt hätte, dass die Klägerin mir ihren Lieferungen den globalen Bedarf der betreffenden Plattform deckt, wie dies die Beklagte für ihre Lieferungen von CZO 5078 vorträgt, schließt dies nicht aus, dass die Klägerin lieferwillig und -fähig gewesen wäre. Nicht nur ist es – wie ausgeführt – wahrscheinlich, dass die Klägerin dann ihre Lieferkapazitäten im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Überlegungen ausgebaut hätte, sondern die Klägerin hat auch vorgetragen, dass in F (China) eine Tochtergesellschaft der A -Gruppe eine weitere Produktionsstätte betrieb, welche zur Fertigung von Optalys 430 geeignet war. Der Klägerin wäre es also auch möglich gewesen, weitere Mengen des qualifizierten Mischoxids aus einer anderen bestehenden Anlage zu erhalten. Selbst wenn die Klägerin die Anlage nicht als eigene hätte nutzen dürfen, sondern die Mischoxide nach konzerninternen Verrechnungspreisen hätte erwerben müssen, hätte sie ihren Lieferverpflichtungen nachkommen können. Insofern ist zu berücksichtigen, dass die Beklagte nicht vorgetragen hat, welche Mengen D insgesamt im Zeitraum vom 1. Juli 2016 bis Ende 2017 abrief. Daher obliegt auch der Klägerin kein näherer Vortrag dazu, welche weiteren Produktionskapazitäten vorhanden waren oder hätten geschaffen werden können. Deshalb ist es auch unerheblich, wenn die Beklagte die vorhandenen Kapazitäten im Werk F bestreitet. Die Behauptung der Beklagten, das Werk sei marode und nicht in der Lage zu liefern, lässt sich nach dem substantiierten Vortrag der Klägerin, wonach die Bilder, auf die die Beklagte ihre Vermutung stützt, aus einem Testbericht zur Überwachung von Boden und Grundwasser im Jahr 2020 stammten, nicht aufrechterhalten. Insofern kommt es auf weitere mögliche Details, wie beispielsweise die Abwasser- oder Baugenehmigung für eine Erweiterung des Werkes oder die mögliche Verzögerung einzelner Lieferungen aufgrund von Kapazitätsengpässen, nicht an. Dies würde an die Darlegung der Anknüpfungstatsachen und die Überlegungen zum hypothetischen Geschehensablauf zu hohe Anforderungen zu stellen.
188Letztlich spricht mehr dafür als dagegen, dass die Klägerin im Jahr 2016 und 2017 lieferwillig und -fähig gewesen wäre und sogar den weltweiten Bedarf von D an dem Ersatzprodukt für CZO 5078 mittels vorhandener Kapazitäten gedeckt hätte, jedenfalls aber weitere Kapazitäten aufgebaut hätte, wenn dies notwendig gewesen wäre. Dabei hätte der Bedarf für die Lieferungen in die Bundesrepublik Deutschland in Höhe von 6.000 kg beziehungsweise 60.600 kg in den Jahren 2016 und 2017 allein mit dem Werk in La Rochelle gedeckt werden können.
Den Gewinn, der der Klägerin aufgrund der unberechtigten Benutzung des Klagepatents durch die Beklagte im Zeitraum vom 1. Juli 2016 bis zum 24. Dezember 2017 entgangen ist, schätzt die Kammer auf Grundlage von § 252 BGB und § 287 Abs. 1 ZPO auf X.
190Auch hinsichtlich der konkreten Schadenshöhe kommt der Klägerin die Beweiserleichterung des § 287 Abs. 1 ZPO zugute, im Fall des hier geltend gemachten entgangenen Gewinns zudem nach Maßgabe von § 252 BGB. Nach Maßgabe dieser bereits dargestellten Grundsätze hat die Klägerin hinreichende Anhaltspunkte für eine Schadensschätzung vorgetragen.
191Die Klägerin hat den Ansatz gewählt, den Gewinn, den sie im Jahr 2023 mit dem Produkt Optalys 430 pro Kilogramm erwirtschaftete, zu ermitteln und dann auf die hier streitgegenständlichen Jahre 2016 und 2017 überzuleiten. Nach Auffassung der Kammer handelt es sich dabei um eine sachgerechte Herangehensweise, um den entstandenen Schaden im Sinne des entgangenen Gewinns zu ermitteln. Sie basiert auf der Struktur der Preisgestaltung des Jahres 2023 und den Umsätzen und variablen Kosten, die mit der Herstellung und dem Vertrieb des patentgemäßen Produkts, das der X am nächsten kommt, erwirtschaftet wurden. Durch die Überleitung auf die Jahre 2016 und 2017 werden weiterhin die Umstände des eigentlichen Schadenszeitraums hinreichend berücksichtigt. Eine andere mögliche Herangehensweise wäre es gewesen, unmittelbar den Gewinn auf der Grundlage von Umsätzen und variablen Kosten zu ermitteln, die mit Mischoxid-Produkten in den Jahren 2016 und 2017 erwirtschaftet wurden. Nach dem Vortrag der Klägerin bestanden immerhin zwischen ihr und D Liefervereinbarungen aus den Jahren 2013 und 2017. Dem Vorteil der unmittelbaren Ableitung von variablen Kosten und Umsätzen aus damals gültigen Verträgen steht jedoch der Nachteil gegenüber, dass es zu dem Zeitpunkt kein mit X oder Optalys 430 vergleichbares Produkt der Klägerin gab. Optalys 430 wurde erst seit X kommerziell geliefert. Auch nach dieser Herangehensweise hätte eine Überleitung – hier von Umsätzen und variablen Kosten auf ein anderes Produkt – stattfinden müssen. Beide Herangehensweisen erscheinen gleichermaßen möglich, wobei jeweils die Überleitung eine Schätzung des Schadens erfordert. Dass sich die Klägerin für die erste Herangehensweise entschied, ist nicht zu beanstanden. Schließlich kommt in der klägerischen Schadensberechnung auch die zweite Herangehensweise zum Zuge, wenn letztlich die Gewinnmarge der Jahre 2016 und 2017 herangezogen wird.
192Die Klägerin hat dargelegt, dass der für die Umsätze maßgebliche Verkaufspreis für Optalys 430 X.
193Die Überleitung der so kalkulierten Umsätze hat die Klägerin dadurch vollzogen, X. Dass diese nicht vorgetragen ist, führt aber nicht dazu, dass der Schadensersatz gänzlich zu verneinen ist (vgl. BGH, VersR 2022, 1608). Vielmehr ist die X an dieser Stelle zu schätzen. Einen Anhaltspunkt liefert dafür das von der Klägerin zur Stützung ihrer Gewinnermittlung vorgelegt KSB-Gutachten (Anlagen HL 26), in dem mitgeteilt wird, X (vgl. S. 15 der Anlage HL 26). X Damit ergibt sich ein Umsatz von X (2016) beziehungsweise X (2017).
194Weiterhin hat die Klägerin anhand der mit der Herstellung und dem Vertrieb von Optalys 430 verbundenen Umsätze (X) und variablen Kosten (X) im Jahr X eine Gewinnmarge in Höhe von 44% ermittelt. Allerdings hat sie diese Marge nicht einfach auf die Jahre 2016 und 2017 übergeleitet. X. Stattdessen hat sie die zu dieser Zeit übliche Marge ermittelt, die bei X im Jahr 2016 und X im Jahr 2017 lag. Auch dies ist im Ergebnis und im Rahmen der mit einer Schätzung verbundenen Ungenauigkeit nicht zu beanstanden. Ebenso wie die X den Gegebenheiten der Jahre 2016 und 2017 im Wege der Schätzung anzupassen ist, gilt dies für die Gewinnmarge. Die Klägerin hat dazu erläutert, dass sie die Marge anhand X, ermittelt und X. Aus dem KSB-Gutachten ergibt sich, dass der Privatgutachterin die Herleitung der Marge für die Jahre 2016 und 2017 mit den entsprechenden Daten (Verkaufspreise und Ist-Kosten) nachgewiesen wurde (S. 16 u. 17 der Anlage HL 26). Die Kammer hat keine Bedenken, die genannten Margen von X und X in Ansatz zu bringen, zumal sie nicht außer Verhältnis zu der für das Jahr 2023 unter konkreter Benennung einzelner Kostenpositionen ermittelten Marge stehen und auch die Beklagte nicht behauptet hat, dass solche Margen nicht glaubhaft seien.
195Davon ausgehend lässt sich der entgangene Gewinn für das Jahr 2016 mit X und für das Jahr 2017 mit X berechnen. Daraus ergibt sich ein Schadensersatzbetrag für die Lieferungen des Verletzungsprodukts von rechnerisch X im Jahr 2016 und von X im Jahr 2017. In Summe schätzt die Kammer den entgangenen Gewinn auf X.
196Soweit die Beklagten die Einzelheiten der von der Klägerin vorgetragenen und hier im Wesentlichen nachvollzogenen Gewinnberechnung bestreitet, greift dies nicht durch. Die Kammer macht insofern von dem ihr zustehenden Ermessen gemäß § 287 Abs. 1 ZPO Gebrauch und sieht von einer weiteren Beweisaufnahme – insbesondere unter dem Eindruck des von der Klägerin vorgelegten KSB-Gutachtens (Anlage HL 26) – ab. Rechtlich ist ein solches Privatgutachten auch dann, wenn die Partei lediglich darauf Bezug nimmt, als besonders substantiierter, urkundlich belegter Parteivortrag einzuordnen (BGH, VersR 2022, 1608). Die Darstellung der Prüfung der Gewinnberechnung durch die Privatgutachterin verobjektiviert den schriftsätzlichen Klägervortrag weiter und erläutert die Hintergründe der Gewinnermittlung. Die dagegen erhobenen Einwände der Beklagten sind letztlich ohne Substanz beziehungsweise stellen die Schätzungsgrundlagen und die Schadensschätzung nicht in Frage. Eines Schriftsatznachlasses bedurfte es nicht, weil die Beklagte ausreichend Gelegenheit hatte, sich zum Vortrag der Klägerin und dem KSB-Gutachten einzulassen, und sogar mit einem eigenen Gegengutachten replizieren konnte.
197Soweit die Beklagte die Höhe X, Existenz und Inhalt des X, die Höhe der Kosten des Ersatzprodukts und dergleichen bestreitet, ist dies mangels Substanz unerheblich und stellt die Schätzung als solche nicht in Frage. Die Klägerin hat mit dem KSB-Gutachten belegt, dass sämtliche Daten aus den mit D geschlossenen Verträgen und dem Betriebswirtschaftssystem SAP stammen. Diese Quellen hat die Privatgutachterin stichprobenartig geprüft und keine nennenswerten Auffälligkeiten feststellen können. Sie hat die BOM-Listen einsehen können, anhand derer die variablen Kosten ermittelt wurden. Es ist nicht einzusehen, warum diese noch weiter aufgeschlüsselt werden sollten als bereits in den von der Klägerin mitgeteilten Kategorien geschehen. Mit der Überleitung der Gewinnmarge auf die Jahre 2016 und 2017 hat sich die Kammer bereits auseinandergesetzt (s.o.). Auch diese wurden der Privatgutachterin anhand von Verkaufspreisen und Ist-Kosten nachgewiesen und von ihr nicht beanstandet. Die Kammer hat keinen Anlass, an der Richtigkeit der Feststellungen der Privatgutachterin zu zweifeln. Auch die Beklagte trägt nicht vor, welche der vorgetragenen Umsatz- und Kostenbestandteile nicht glaubhaft sein sollten. Nach der Privatgutachterin nunmehr noch einen vom Gericht beauftragten Buchprüfer die Daten prüfen zu lassen, würde nach hiesigem Ermessen zu keinem anderen Ergebnis führen. Allenfalls die grundsätzliche Herangehensweise an die Schadensschätzung ließe sich in Frage stellen, die die Kammer aber – wie eingangs ausgeführt – für sachgerecht hält.
198Auch die Anwendung des Teilkostenansatzes statt des Vollkostenansatzes begegnet keinen Bedenken. Nach den grundsätzlichen Erwägungen der Privatgutachterin im KSB-Bericht, gegen die sich auch die Beklagte nicht wehrt, kommt die Anwendung der Teilkostenrechnung insbesondere dann zum Tragen, wenn Produktionskapazitäten zur Verfügung stehen (Leerkapazitäten) und über eine zusätzliche Auftragsannahme entschieden werden soll; durch eine Erhöhung der Produktionsmenge würden nur zusätzliche variable Kosten ausgelöst (S. 6 der Anlage HL 26). Wie bereits festgestellt, ist davon auszugehen, dass in den Jahren 2016 und 2017 genügend Kapazitäten zur Herstellung und Lieferung von Optalys 430 in La Rochelle bereitgestanden hätten. Daher kommt es für die Schadensschätzung auch nicht auf Einkaufskosten für etwaige Lieferungen von Mischoxid an, das in F hergestellt und zugekauft worden wäre. Die Kapazitäten in La Rochelle genügten jedenfalls, den in der Bundesrepublik Deutschland bestehenden Bedarf von D zu decken.
199Aber selbst wenn die Klägerin neue Kapazitäten in La Rochelle hätte aufbauen müssen, hätte dies auch schon im Jahr 2013 der Fall sein können mit der Folge, dass in den Jahren 2016 und 2017 ausreichend Kapazitäten zur Verfügung gestanden hätten. Auch die Privatgutachterin im KSB-Gutachten weist darauf hin, dass der Aufbau zusätzlicher Kapazitäten nicht zwangsläufig zur Folge habe, dass die hieraus resultierenden Investitionskosten (z.B. über die Abschreibung) die Höhe des entgangenen Gewinns gemindert hätten. Es sei stets zu beachten, dass insbesondere kundenspezifisch aufzubauende Produktionskapazitäten auch Auswirkungen auf die Preisgestaltung hätten; schließlich müsse der Aufbau von zusätzlichen Kapazitäten wirtschaftlich lohnend sein. Insbesondere bei langfristigen Lieferbeziehungen und bei Spezialprodukten sei die Amortisation der (zusätzlichen) Investitionskosten über die Vereinbarung höherer Verkaufspreise, die die zusätzlichen Kosten berücksichtigten, üblich (S. 9 der Anlage HL 26). Selbst wenn also der Aufbau neuer Kapazitäten erforderlich gewesen wäre, stellt dies die Schadensschätzung nicht grundsätzlich in Frage. Mit eben dieser Begründung waren auch Kosten für Abnutzung ihrer Anlagen nicht von der Klägerin zu berücksichtigen, weil es sich nicht um in eine Teilkostenrechnung einzustellende variable Kosten handelt.
Der Schadensersatzanspruch ist nicht aus anderen Gründen zu verneinen, erloschen, nicht durchsetzbar oder in der Höhe beschränkt.
Der von der Beklagten zu leistende Schadensersatz wird vom Schutzzweck der verletzten Norm – § 9 PatG – erfasst.
202Der Schutzzweck einer ein bestimmtes Verhalten vorschreibenden Norm beschränkt den Umfang des zu ersetzenden Schadens. Es sollen nicht alle Schäden zu ersetzen sein, die adäquat kausal auf einem bestimmten Verhalten beruhen, sondern nur solche, deren Eintritt die verletzte Norm gerade verhindern sollte. Daher lassen sich aus dem Schutzzweck der Norm aber dann keine haftungsbeschränkenden Aussagen gewinnen, wenn die Ersatzpflicht an einen Verletzungserfolg anknüpft (MüKo/Oetker, BGB, 9. Aufl. 2022: § 249 Rn. 120, 126).
203So liegt der Fall auch hier. Der den Schaden begründende Verletzungserfolg ist mit der entgegen § 9 PatG erfolgten Benutzung des Klagepatents durch die Beklagte eingetreten. Bereits dadurch ist der Schutzzweck des § 9 PatG erfüllt, weil das Patent verletzt ist. Hingegen kann die Aktivlegitimation als anspruchsbegründende Voraussetzung nicht auch als Ausprägung des Schutzzwecks der Norm gesehen werden mit der Begründung, dass die Norm nur den Schutz bestimmter Berechtigter bezwecke und der Schadensersatz dem Dritten nicht gebührt. Daher kann sich die Beklagte im Streitfall auch nicht mit Erfolg darauf berufen, der vermeintlich nicht aktivlegitimierte Dritte habe auch aufgrund des fehlenden Schutzzwecks der Norm keinen Schadensanspruch. Denn dass der Schadensersatzanspruch den Schutz des Geschädigten bezweckt, ist ein Allgemeinplatz. Ob aber eine Person durch ein schädigendes Ereignis verletzt wurde und dem Grunde nach anspruchsberechtigt ist, ist im Rahmen der Anspruchsberechtigung beziehungsweise Aktivlegitimation zu klären. Steht diese anspruchsbegründende Voraussetzung wie im Streitfall rechtskräftig fest, kann der Schadensersatzanspruch nicht mehr gestützt auf die anspruchsbegründenden Tatsachen unter dem Gesichtspunkt des Schutzzwecks der Norm zu Fall gebracht werden.
Die Verpflichtung der Beklagten zum Schadensersatz wurde nicht durch die von D an die Klägerin im Rahmen der D -Vereinbarung geleisteten Zahlungen erfüllt, § 362 BGB. Die Zahlungen von D erfolgten nicht zur Tilgung der Schuld der Beklagten. Ebenso wenig besteht zwischen D und den Beklagten eine Gesamtschuld, auf die D leistete.
205Nach dem substantiierten Vortrag der Klägerin enthielt die D -Vereinbarung zwei Regelungen zugunsten von D : zum einen X und zum anderen X.
206Zahlungen von D als Gegenleistung für die Einräumung des X können nicht auch als Abgeltung von Schadensersatzansprüchen aus Verletzungshandlungen der Beklagten verstanden werden. Die scheitert bereits an der Verschiedenheit der Verpflichtungen (vertraglich vereinbarter X vs. deliktischer Anspruch) und der fehlenden Tilgungsbestimmung. Der X kann zudem nur für von D begangene Verletzungshandlungen gelten, weil eine Inanspruchnahme wegen Verletzungshandlungen der Beklagten ohnehin ausgeschlossen war. D befindet sich an einer in der Lieferkette gegenüber der Beklagten nachgelagerten Position und haftet nicht für Verletzungshandlungen der Beklagten. Insbesondere begründen die Verletzungshandlungen der einzelnen Verletzer einer Verletzerkette keine gesamtschuldnerische Haftung (BGH, GRUR 2009, 856 – Tripp-Trapp-Stuhl). Eine Erfüllungswirkung der Zahlungen von D ist ausgeschlossen.
207Aber auch soweit die Zahlungen eine Gegenleistung für X, haben sie keine Erfüllungswirkung für den hier streitgegenständlichen Schadensersatzanspruch. Denn bei der X handelt es sich ebenfalls um eine andere Gegenleistung als der zu erfüllende deliktische Anspruch. Eine Tilgungswirkung zugunsten der Beklagten ist nicht vorgetragen und auch sonst nicht ersichtlich. Dies erscheint – jedenfalls in Bezug auf den Verletzungszeitraum der hier geltend gemachten Jahre 2016 und 2017 – auch fernliegend. Denn die Vereinbarung mit D trat erst ab dem X in Kraft. X. Es ergibt daher keinen Sinn, Zahlungen von D X.
208Da eine wie auch immer geartete Erfüllungswirkung in keiner Weise ersichtlich ist, war dem Vorlagebegehren der Beklagten hinsichtlich der D -Vereinbarung auch in diesem Zusammenhang nicht nachzukommen. Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Zusammenhang mit dem Zustimmungs- und Erschöpfungseinwand Bezug genommen.
Aus den Gründen für die Ablehnung einer Erfüllungswirkung von Zahlungen im Rahmen der D -Vereinbarung ist auch ein Vorteilsausgleich zugunsten der Beklagten aufgrund dieser Zahlungen abzulehnen. Es fehlt schon an der dafür erforderlichen Kausalität. Ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen dem schädigenden Ereignis – hier der von der Beklagten begangenen Patentverletzung – und dem von der Klägerin erlangten Vorteil in Form von Zahlungen von D ist aufgrund der anderen Zielrichtung der Zahlungen nicht erkennbar.
Der Schadensersatzanspruch wird auch nicht dadurch reduziert, dass die Beklagte weitere Patentverletzungshandlungen beging, aus denen sie gegenüber der Klägerin schadensersatzpflichtig ist. Ob, in welchem Umfang und zu welchem Zeitpunkt etwaige Ansprüche oder Zahlungen wegen der Verletzung verschiedener Patente anzurechnen sind, kann dahinstehen. Die Klägerin hat mit den hier streitgegenständlichen Verletzungshandlungen aus der Zeit vom 1. Juli 2016 bis zum 24. Dezember 2017 Schäden aus einer Zeit geltend gemacht, in der dieBeklagte kein anderes Patent verletzte.
Der Zinsanspruch ergibt sich aus §§ 288 Abs. 1 S. 2, 291 BGB. Die Klage wurde der Beklagten am 16. August 2022 zugestellt.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.
213Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 S. 1 und 2 ZPO.
214Streitwert: X
215Dr. Voß |
Hammans |
Dr. Bongartz |
||
Vorsitzender Richter am Landgericht |
Richterin am Landgericht |
Richterin |
||