 Seite drucken
Seite drucken
 Entscheidung als PDF runterladen
Entscheidung als PDF runterladen
 Seite drucken
Seite drucken
 Entscheidung als PDF runterladen
Entscheidung als PDF runterladen

I. Die Klage wird abgewiesen.
II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin
III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.
Tatbestand
2Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen der Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents A(Klagepatent) auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch.
3Das Klagepatent wurde am 21.08.2007 von B unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 21.08.2006 angemeldet. Die Patentanmeldung wurde am 01.07.2009 veröffentlicht, der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents am 03.08.2016. Das Klagepatent steht in Kraft. Gegen die Erteilung des Klagepatents wurde seitens der Beklagten Einspruch eingelegt, über den bislang noch nicht entschieden ist.
4Das Klagepatent, dessen Verfahrenssprache Englisch ist, betrifft ein Verfahren zur Herstellung von thrombozytenreichem Plasma zur unbearbeiteten Verwendung und Kombination daraus mit Haut- und Knochenzellen. Patentanspruch 1 des Klagepatents lautet in der deutschen Übersetzung wie folgt:
5„Verfahren zur Herstellung einer Zellzusammensetzung, umfassend die Schritte:
6(a) Zentrifugieren von Vollblut in einem Trennröhrchen ausgewählt aus
7- einem Glastrennröhrchen, das ein thixotropes Gel auf Polyesterbasis und eine gepufferte Natriumcitratlösung in 0,10 M enthält; und
8- einem Polyethylenterephthalattrennröhrchen, das ein hoch thixotropes Gel enthält, das durch eine Polymermischung und ein wasserfreies Natriumcitrat in 3,5 mg/mL gebildet wird;
9(b) Trennen von angereichertem thrombozytenreichem Plasma von Vollplasma, indem etwa die Hälfte des Überstands entfernt wird, der thrombozytenarmes Plasma enthält;
10(c) erneutes Suspendieren des angereicherten Plasmas; wobei der Zentrifugierschritt a) mit einer Kraft von oder etwa 1500 g bis zu etwa 2000 g für eine ausreichende Zeitdauer durchgeführt wird, um eine Barriere zwischen Plasma, das Thrombozyten, Lymphozyten und Monozyten enthält, und einem Pellet, das Erythrozyten enthält, zu bilden; wobei der Trennschritt b) durchgeführt wird, indem der Überstand von oberhalb der Barriere aufgefangen wird und wobei das angereicherte Plasma im Vergleich zu nativem Vollblut an Leukozyten, Thrombozyten und Adhäsionsproteinen angereichert ist.“
11Der ausschließliche und allein verfügungsberechtigte Inhaber des Klagepatents ist der Geschäftsführer der Beklagten, B Dieser unterzeichnete für sich und die Klägerin ein „Exclusive Patent License Agreement“ (EPLA), in dessen Ziffer 1 im Ergebnis die Gewährung einer ausschließlichen Lizenz am Klagepatent für die Beklagte und die Übertragung aller Rechte aus dem Patent, einschließlich im eigenen Namen zu klagen und Schadensersatz geltend zu machen, geregelt ist. Tag der Unterzeichnung des EPLA war der 19.09.2016, wirksam werden sollte die Vereinbarung mit dem frühesten Anmeldetag der lizenzierten Patente und Patentanmeldungen. Wegen der Einzelheiten des Lizenzvertrages wird auf die Anlage K 7 Bezug genommen.
12Die Beklagte tritt im Rechts- und Wirtschaftsverkehr auch als C auf. Sie stellt her und vertreibt weltweit Medizinprodukte im Bereich der autologen regenerativen Medizin, insbesondere Vorrichtungen zur Herstellung von thrombozytenreichem Blutplasma, so genannte „PRP Systeme“, bei denen ein Trennröhrchen mit einem Trenngel und einem Gerinnungshemmer zum Einsatz kommt. Diese Trennröhrchen (angegriffene Ausführungsform) werden in identischer Form unter verschiedenen Bezeichnungen vertrieben.
13In ihrem englischsprachigen Internetauftritt www.estar-medical.com warb die Beklagte damit, dass sie das „D“ und das „E“ unter diesen selbst gehaltenen Markennamen ebenso wie unter dem Markennamen „F“ in mehr als 50 Ländern vertreibt, einschließlich der USA unter dem Markennamen „G“. Mittlerweile wird das Produkt F auf der Internetseite nicht mehr genannt.
14Das „D“ gibt es in den Ausstattungsvarianten „H“ und „I“ mit der als „J“ angegriffenen Ausführungsform. Professionelle Anwender können das K per Email an die auf der Website der Beklagten angegebene Email-Adresse L von der Beklagten erwerben. Bereits im November 2015 nahm die Beklagte an der MEDICA teil und präsentierte sich in diesem Zusammenhang als Anbieter von „D“. Zudem bot sie die angegriffene Ausführungsform unter der Bezeichnung „D auf der MEDICA an. Auch vom 14. bis zum 17.11.2016 trat die Beklagte als Ausstellerin auf der MEDICA in Düsseldorf auf. In dem im Internet auffindbaren Ausstellerverzeichnis wurde die Beklagte mit Produkten des „M und dem E angekündigt. Auf der Messe bewarb die Beklagte diese Produkte durch Plakate, Muster und Broschüren, wobei sie auf ihre Emailadresse L verwies. Die Beklagte belieferte in der Bundesrepublik Deutschland die N mit der angegriffenen Ausführungsform unter der Bezeichnung „D“, allerdings nicht nach der Erteilung des Klagepatents.
15Unter der Bezeichnung „E“ vertreibt die Beklagte medizinische Anwendungskits mit einer als „O“ bezeichneten angegriffenen Ausführungsform. Auch dieses Kit können Interessenten über die Email-Adresse L der Beklagten erwerben. Bislang wurde das Produkt jedoch weder vor, noch nach der Erteilung des Klagepatents in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben.
16Unter der Bezeichnung „F“ wird weiterhin ein „P“ mit der als „Q“ bezeichneten angegriffenen Ausführungsform vertrieben, wobei zwischen den Parteien die Beteiligung der Beklagten an Angebot und Vertrieb dieses Produkts streitig ist. Professionelle Anwender können das „F“ über das Kontaktformular auf der Website R erwerben. Auf der Internetseite S und einer dort zum download bereitstehenden Broschüre zum Produkt „F“ wird eine T als Verantwortliche genannt.
17Die Klägerin ist der Auffassung, die Beklagte verletze die Lehre des Klagepatents mittelbar. Sie – die Klägerin – sei zur Geltendmachung der Ansprüche aus dem Klagepatent aktivlegitimiert. Dazu trägt sie vor, dass Herr B Alleingesellschafter und einziger Verwaltungsrat der Klägerin sei, der zudem allein zeichnungsberechtigt sei.
18Weiter behauptet die Klägerin, die Beklagte vertreibe die angegriffene Ausführungsform des Typs D in der Bundesrepublik Deutschland. Nach wie vor habe sie Abnehmer dieses Produkts in der Bundesrepublik Deutschland, wie etwa die auf der Internetseite des Unternehmens U abrufbare Broschüre für D I belege. Ebenso vertreibe die Beklagte das Produkt F in der Bundesrepublik Deutschland an Kliniken und Arztpraxen.
19Die angegriffene Ausführungsform sei auch zur Anwendung des patentgemäßen Verfahrens geeignet. Dass die angegriffene Ausführungsform ein Glasröhrchen mit einer beschichteten Innenseite aufweise, führe nicht aus der Lehre des Klagepatents heraus, da allein das Material, aus dem das Trennröhrchen bestehe, maßgeblich sei. Eine Beschichtung schließe das Klagepatent nicht aus. Die Beklagte behauptet, die angegriffene Ausführungsform verwende auch ein thixotropes Gel auf Polyesterbasis. Untersuchungen, deren Durchführung und Ergebnisse die Beklagte bestreitet, hätten gezeigt, dass das Infrarot-Spektrum des Gels in einem F-Produkt und einem D-Produkt mit dem Spektrum des Gels identisch sei, das die Beklagte in ihren Produkten verwende. Die Klägerin behauptet, das in ihren Produkten verwendete Gel sei polyesterbasiert. Die Klägerin ist weiterhin der Ansicht, für sämtliche angegriffenen Produkte sei von der Verwendung von Acid-Citrat-Dextrose als Gerinnungshemmer auszugehen. Es handele sich dabei um eine gepufferte Natriumcitratlösung. Bei der Dextrose handele es sich um einen zusätzlichen Nährstoff, der nach der Lehre des Klagepatents nicht ausgeschlossen sei. Die Konzentration von 0,109 M der Lösung sei vom Wortsinn des Klagepatentanspruchs erfasst. Die Angabe von 0,10 M im Anspruch mache deutlich, dass es nur auf die zweite, nicht aber auf die weiteren Nachkommastellen ankomme. Die Klägerin behauptet dazu, bei einer Abweichung von +/- 0,009 M handele es sich um eine Messfehlertoleranz. Zudem, so der Vortrag der Klägerin, sei die gerinnungshemmende Wirkung identisch. Letztlich spiele die Abweichung keine Rolle, weil auch die Menge des abgenommenen Blutes im Röhrchen Schwankungen unterliege. Jedenfalls aber sei das Merkmal mit äquivalenten Mitteln verwirklicht. Schließlich ist die Klägerin der Ansicht, dass sich bei Anwendung des Verfahrens nach dem Klagepatentanspruch zwangsläufig auch eine Anreicherung der Adhäsionsproteine im Plasma gegenüber dem nativen Vollblut ergebe. Zu diesen Proteinen zählten Fibronektin und P-Selektin.
20Es sei weiterhin offensichtlich, dass die angegriffene Ausführungsform zur Anwendung des Verfahrens nach dem Klagepatentanspruch bestimmt sei. Entsprechende Werbevideos und Broschüren zu den jeweils angegriffenen Produkten wiesen auf die patentgemäße Anwendung hin. Die Aufforderung, 40 bis 60 % des Überstands zu entfernen, entspreche dem Idealbild der Aufforderung, ungefähr die Hälfte des Überstands zu entfernen. Ähnliches ergebe sich aus einer auf der Medica 2016 verteilten Broschüre und einer über die Website Sabrufbaren Präsentation.
21Die Klägerin beantragt,
22I. die Beklagte zu verurteilen,
231.a) es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, – wobei die Ordnungshaft an ihren gesetzlichen Vertretern zu vollstrecken ist – zu unterlassen,
24Glastrennröhrchen, die ein thixotropes Gel auf Polyesterbasis und eine gepufferte Natriumchloridlösung in 0,10 M enthalten,
25welche dazu geeignet sind, ein Verfahren zur Herstellung einer Zellzusammensetzung zur Wund- oder Gewebeheilung oder Regenerationsbehandlung durchzuführen, umfassend die Schritte des Zentrifugierens von Vollblut in den Trennröhrchen, wobei der Zentrifugierschritt mit einer Kraft von oder etwa 1500 g bis zu etwa 2000 g und für eine ausreichende Zeitdauer durchgeführt wird, um eine Barriere zwischen Plasma, das Thrombozyten, Lymphozyten und Monozyten enthält, und einem Pellet, das Erythrozyten enthält, zu bilden, des Trennens von angereichertem thrombozytenreichem Plasma von Vollplasma, indem etwa die Hälfte des Überstands entfernt wird, der thrombozytenarmes Plasma enthält, indem der Überstand von oberhalb der Barriere aufgefangen wird und wobei das angereicherte Plasma im Vergleich zu nativem Vollblut an Leukozyten, Thrombozyten und Adhäsionsproteinen angereichert ist und des erneuten Suspendierens des angereicherten Plasmas,
26Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder an solche zu liefern;
271.b) hilfsweise für den Fall der Abweisung des Antrags zu 1. a)
28es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, – wobei die Ordnungshaft an ihren gesetzlichen Vertretern zu vollstrecken ist – zu unterlassen,
29Glastrennröhrchen, die ein thixotropes Gel auf Polyesterbasis und eine gepufferte Natriumchloridlösung in 0,109 M enthalten,
30welche dazu geeignet sind, ein Verfahren zur Herstellung einer Zellzusammensetzung zur Wund- oder Gewebeheilung oder Regenerationsbehandlung durchzuführen, umfassend die Schritte des Zentrifugierens von Vollblut in den Trennröhrchen, wobei der Zentrifugierschritt mit einer Kraft von oder etwa 1500 g bis zu etwa 2000 g und für eine ausreichende Zeitdauer durchgeführt wird, um eine Barriere zwischen Plasma, das Thrombozyten, Lymphozyten und Monozyten enthält, und einem Pellet, das Erythrozyten enthält, zu bilden, des Trennens von angereichertem thrombozytenreichem Plasma von Vollplasma, indem etwa die Hälfte des Überstands entfernt wird, der thrombozytenarmes Plasma enthält, indem der Überstand von oberhalb der Barriere aufgefangen wird und wobei das angereicherte Plasma im Vergleich zu nativem Vollblut an Leukozyten, Thrombozyten und Adhäsionsproteinen angereichert ist und des erneuten Suspendierens des angereicherten Plasmas,
31Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder an solche zu liefern;
322. ihr Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte seit dem 03.08.2016 die unter Ziffer I. 1. a) – hilfsweise unter Ziffer I. 1. b) – bezeichneten Handlungen begangen hat, und zwar unter Angabe
33a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
34b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse gemäß Ziffer I. 1. a) – hilfsweise unter Ziffer I. 1. b) – bestimmt waren, und
35c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse gemäß Ziffer I. 1. a) – hilfsweise unter Ziffer I. 1. b) – sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,
36wobei
37- zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege, nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine, weiter hilfsweise Auftragsbestätigungen und noch weiter hilfsweise Zollscheine in Kopien vorzulegen sind,
38- auf den Kaufbelegen geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
393. ihr unter Vorlage eines geordneten Verzeichnisses darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer I. 1. a) – hilfsweise unter Ziffer I. 1. b) – bezeichneten Handlungen seit dem 05.09.2016 begangen hat, und zwar unter Angabe
40a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie – im Falle von mehreren Teilbestellungen – durch Kennzeichnung der jeweils zusammengehörenden Teile der Bestellungen,
41b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie der Namen und der Anschriften der Abnehmer und der Verkaufsstellen,
42c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
43d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebieten,
44e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
45wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden und der Klägerin gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch seine Einschaltung entstehenden Kosten trägt und ihn zugleich ermächtigt, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob bestimmte Abnehmer, Angebotsempfänger und/oder Lieferungen in der erteilten Rechnung enthalten sind;
46II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der durch unter Ziffer I. 1. bezeichneten, in der Zeit vom 05.09.2016 bis zum 19.09.2016 begangenen Handlungen Herrn V und in der Zeit seit dem 20.092016 begangenen Handlungen der Klägerin entstanden ist oder noch entstehen wird;
47hilfsweise ihr für den Fall des Unterliegens nachzulassen, die Zwangsvollstreckung wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung (in Form einer Bürgschaft einer Deutschland ansässigen, als Zoll- und Steuerbürge zugelassenen Bank oder Sparkasse) abzuwenden.
48Die Beklagte beantragt,
49die Klage abzuweisen
50hilfsweise das Verfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des bezüglich des Klagepatents anhängigen Einspruchsverfahren beim Europäischen Patentamt auszusetzen.
51Die Beklagte ist der Ansicht, die Klägerin sei nicht aktivlegitimiert. Sie bestreitet die Vertretungsbefugnis von Herrn B, die Lizenzvereinbarung für die Klägerin schließen zu können, mit Nichtwissen.
52Die Beklagte ist weiter der Ansicht, die Klägerin habe nicht dargelegt, dass sie die angegriffene Ausführungsform des Typs D nach der Erteilung des Klagepatents in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben habe. Zunächst werde das D-Produkt nicht weltweit über ihre Internetseite zum Verkauf angeboten. Die Email-Adresse diene nur der allgemeinen Kontaktaufnahme. Sie finde sich dementsprechend unter der nicht produktbezogenen Rubrik „W“. Bei der Website X handele es sich zudem um eine englischsprachige Website ohne Bezug zum deutschen Markt, was auch für die Produktvideos gelte. Was die Broschüre D I der U betreffe, sei diese nur im Bereich „Downloads“ zu finden, nicht unter der Rubrik „Produkte“. Eine Verfügbarkeit des Produkts sei nicht erkennbar. Zum Produkt F behauptet die Beklagte, sie habe bis zum Jahr 2016 mit dem Unternehmen T kooperiert, das daher in den Besitz von F-Produkten gelangt sei. Bereits im Frühjahr 2016 habe sie ihrem Kooperationspartner untersagt, von ihr bezogene Komponenten nach Deutschland zu liefern. An Lieferungen von F-Produkten nach Deutschland sei sie nicht beteiligt und habe davon auch nicht gewusst. Sie bestreitet mit Nichtwissen, dass den in Anlagen K 16 bis K 18 genannten Praxen die angegriffene Ausführungsform mit der Bezeichnung F nach Erteilung des Klagepatents geliefert worden sei oder die T nach der Erteilung des Klagepatents in Deutschland angeboten oder vertrieben habe. Auch die zuletzt von der Beklagten angeführten Hinweise auf der Website Y zum Produkt F enthielten als Datum den 17.04.2012, aber keinen Bezug auf die Zeit nach Erteilung des Klagepatents.
53Die Klägerin vertritt zudem die Ansicht, die angegriffene Ausführungsform sei zur Anwendung des patengeschützten Verfahrens nicht geeignet. Bei den Röhrchen, die in der angegriffenen Ausführungsform zum Einsatz kämen, handele es sich nicht um Glastrennröhrchen, weil das Glas an der Innenseite eine Silikonbeschichtung trage. Nach der Lehre des Klagepatents komme es aber maßgeblich darauf an, dass die Innenseite aus Glas bestehe, weil das Material Auswirkungen auf die Gerinnungskaskade, die Adhäsion von Blut und Gel sowie auf die Sterilisierung des Röhrchens habe. Für das thixotrope Gel sei zwischen dem in der vorliegend geltend gemachten Alternative des Klagepatentanspruchs geforderten thixotropen Gel und einem hoch thixotropen Gel der zweiten Alternative des Anspruchs zu unterscheiden. Zudem handele es sich bei dem in der angegriffenen Ausführungsform verwendeten Gel nicht um ein Gel auf Polyesterbasis. Insofern sei zwischen Polymeren im Allgemeinen und Polyestern im Besonderen zu unterscheiden. Die Beklagte behauptet dazu, die angegriffene Ausführungsform verwende eine Zusammensetzung aus einem Polyolefin Hydrocarbon Oligomer mit einem Anteil von 40 bis 60 % und Tris(2-ethylhexyl)trimellitat. Jedenfalls der zweite Bestandteil sei durch entsprechende Untersuchungen von Z, die dieser als Gutachten im parallelen englischen Verletzungsverfahren vorgelegt habe (im vorliegenden Verfahren Anlage AR 9, in deutscher Übersetzung als Anlage AR 9a), nachgewiesen worden. Die Beklagte ist weiterhin der Ansicht, die in der angegriffenen Ausführungsform verwendete Acid-Citrat-Dextrose (ACD) stelle keine gepufferte Natriumcitratlösung dar. Zudem sei die Konzentration von 0,109 M nicht mehr vom Wortsinn des Klagepatentanspruchs umfasst. Aber auch eine Verwirklichung dieses Merkmals nach den Grundsätzen der Äquivalenz scheide aus, weil es an der Gleichwirkung, jedenfalls aber an der Gleichwertigkeit fehle. Soweit schließlich der Klagepatentanspruch verlange, dass das Plasma im Vergleich zu nativem Vollblut an Leukozyten, Thrombozyten und Adhäsionsproteinen angereichert sein solle, habe die Klägerin die Verwirklichung dieses Merkmals im Hinblick auf die Adhäsionsproteine nicht dargelegt. Welche Adhäsionsproteine erhöht sein könnten, lasse sich weder dem Vortrag der Klägerin, noch der Klagepatentschrift entnehmen.
54Die Beklagte ist weiterhin der Auffassung, dass es an den subjektiven Voraussetzungen der mittelbaren Verletzung fehle. Es sei gerade nicht offensichtlich, dass die angegriffene Ausführungsform für die Anwendung des patentgemäßen Verfahrens geeignet und bestimmt sei. In den auf der Medica 2016 verteilten Werbeunterlagen werde nicht zur Abnahme des hälftigen Überstands angeleitet. Andere Hinweise hätten die Besucher der Medica nicht erhalten. Sie hätten auch nicht auf die im Internet verfügbaren Unterlagen und Werbevideos zurückgegriffen, die sich ohnehin nicht an deutsche Kunden wendeten. Im Übrigen werde darin teilweise darauf hingewiesen, dass die Entfernung des hälftigen Überstands nur optional sei. Teilweise werde auch ein Zentrifugierschritt von nur 1200 g vorgegeben. Für Unterlagen zum F-Produkt sei sie – die Beklagte – ohnehin nicht verantwortlich. Selbst wenn man aber von einer mittelbaren Verletzung des Klagepatents ausginge, sei jedenfalls ein Schlechthinverbot nicht gerechtfertigt.
55Im Übrigen werde sich das Klagepatent im Einspruchsverfahren als nicht rechtsbeständig erweisen. Insbesondere seien vor dem Prioritätszeitpunkt im Wege der offenkundigen Vorbenutzung durch die Klägerin bzw. Herrn B selbst Röhrchen verwendet worden, die den heute von der Klägerin verwendeten Röhrchen entsprächen, insbesondere ein thixotropes Gel auf Polyesterbasis enthielten.
56Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und das Sitzungsprotokoll der mündlichen Verhandlung vom 10.04.2018 Bezug genommen.
57Entscheidungsgründe
58Die Klage ist zulässig, aber unbegründet.
59A
60Die Klage ist zulässig, insbesondere ist sie hinreichend bestimmt im Sinne von § 253 Abs. 2 Nr. 1 1. Alt. ZPO. Die Klage richtet sich gegen die AA. Dass die Beklagte in der Klageschrift noch als C bezeichnet worden ist, ist unschädlich. Die Parteibezeichnung in der Klageschrift ist auslegungsfähig. Ungenaue oder unrichtige Parteibezeichnungen sind unschädlich und können jederzeit von Amts wegen berichtigt werden, wenn die Identität der Partei trotz Berichtigung gewahrt bleibt. Bei unrichtiger (mehrdeutiger) äußerer Parteibezeichnung ist grundsätzlich die Person als Partei anzusehen, die erkennbar durch die Parteibezeichnung betroffen sein soll (Zöller/Althammer, ZPO 32. Aufl.: vor § 50 Rn 7 m.w.N.). Im Streitfall wurde durch die Bezeichnung C erkennbar die Beklagte bezeichnet. Eine Gesellschaft des Namens C existiert nicht, stattdessen ist an dem von der Klägerin angegebenen Sitz der C die Beklagte ansässig, die im Rechts- und Wirtschaftsverkehr unstreitig auch unter der Bezeichnung C auftritt.
61B
62Die Klage ist unbegründet.
63Die Klägerin hat gegen die Beklagte keine Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung sowie Schadensersatz aus Art. 64 EPÜ i. V. m. §§ 139 Abs. 1 und 2, 140b PatG, §§ 242, 259 BGB aus eigenem bzw. gemäß § 398 BGB abgetretenem Recht. Es lässt sich nicht feststellen, dass die angegriffene Ausführungsform zur Anwendung des patentgeschützten Verfahrens geeignet ist.
64I.
65Das Klagepatent betrifft mit seinem Anspruch 1 ein Verfahren zur Herstellung einer Zellzusammensetzung.
66In der Beschreibung des Klagepatents wird einleitend zum Stand der Technik ausgeführt, dass die Bedeutung der biologischen autologen Materialien für den Heilungsprozess bereits gut dokumentiert sei. Am bedeutendsten sei, dass sich bei zwei autologen Materialien herausgestellt habe, dass sie direkt an der Bildung der Struktur von Blutgerinnseln beteiligt seien, die eine hämostatische Barriere böten, deren Aufgabe die Hämostase zur Schließung der Wunde sei: (1) Fibrin, das aus der Abscheidung von Plasma-Fibrinogen in zwei Stränge über die Aktivität des Thrombins abgeleitet werde und (2) die aktivierten Membranen der Thrombozyten.
67Der Wundheilungsprozess stelle sich – so die Klagepatentschrift – in der Regel als eine Abfolge aus einer Gerinnungsphase, einem Entzündungs- und einem Regenerationsprozess dar. Es wird weiter erläutert, dass Wachstumsfaktoren und eine Vielzahl von Plasma-Proteinen, auch signalgebende Moleküle genannt, die die Zellmigration und -teilung innerhalb der Blutgerinnsel förderten, eine bedeutende Rolle im Wundheilungsprozess spielten. Theoretisch sei es möglich, die Wirkungen dieser ersten Phasen der Wundheilungskaskade zu erweitern, indem die roten Blutkörperchen ausgeschlossen und die Konzentration der Wachstumsfaktoren erhöht werde. Die Erweiterung der Blutgerinnung könne als die Bildung eines „angereicherten Blutgerinnsels“ (enriched clot = EC) bezeichnet werden. ECs würden durch die Verwendung von Thrombozyten-Konzentraten gewonnen und seien in „Platelets and Megacaryocytes“ 2004, Bd. 1 & 2 (Ed. Gibbins and Mahaut-Smith, Humana Press, New Jersey) als „Struktur und Signale“ beschrieben. Thrombozytenreiches Plasma (platelet-rich plasma = PRP) könne als ein autologes Konzentrat von Thrombozyten in einem kleinen Plasmavolumen definiert werden. Es sei als ein autologes Biomaterial entwickelt worden und habe sich für die Heilung und Regeneration von Gewebe als nützlich erwiesen (Marx et al., 2004, J. Oral Maxillofac. Surg., 62, 489-496). PRP bestehe nicht nur aus einem Thrombozyten-Konzentrat, sondern enthalte auch Wachstumsfaktoren wie PDGF, VEGF, TGF oder EGF, die aktiv von Thrombozyten ausgeschieden würden und die bekanntlich im Initiationsprozess für die Wundheilung eine grundlegende Rolle spielten.
68Zur Herstellung von PRP seien bereits verschiedene Techniken mit dem Zentrifugationsverfahren entwickelt worden. Die US-Schrift BB beschreibe etwa ein Verfahren zur Herstellung einer Thrombozytenkonzentrat-Zusammensetzung, das aus den Schritten der Zentrifugierung von Vollblut und der Resuspendierung von angereichertem Pasma bestehe.
69Aufgrund der Empfindlichkeit der Thrombozytenzellen und der Variabilität der Wirksamkeit der Verfahren zur Trennung der Thrombozyten von den roten Blutkörperchen gebe es jedoch eine große Variabilität unter den Methoden für die Herstellung der Thrombozytenkonzentrate, (Marx a.a.O.; Roukis et al., Adv. Ther. 2006, 23 (2): 218-37). Beispielsweise führe das Labormaterial für In-vitro-Diagnostik, das für die Thrombozytenherstellung verwendet werde, zu schlechten Ergebnissen der Thrombozyten und anderer Plasmakomponenten (Marx a.a.O.: Anitua 35 %, Landsberg 30 %, Clinaseal 39 %, ACE chirurgisch 33 %, Curasan 29 %). Die automatisierten Einstellungen aus dem Biomet pCCS & GPS (Marx a.a.O.), die nicht nur den Nachteil eines komplexen Prozesses mit untragbaren Kosten für die Bearbeitung einer Blutprobe haben, führten zu einem Ergebnis von nur 61 % und SmatPrP von Harvest Technologyliege bei 62 %. In diesen Systemen – so die Klagepatentschrift – gebe es offensichtlich einen bedeutenden Verlust von wertvollem biologischen Gewebe der Patienten. Daher bestehe ein Bedarf für die Entwicklung eines zuverlässigen Verfahrens zur Sammlung von Plasmazellen mit hohen Ergebnissen, das in der Anwendung einfach und kosteneffektiv sei.
70Die Klagepatentschrift sieht am Stand der Technik weiterhin als nachteilig an, dass bei der Erlangung der Thrombozytenkonzentrate noch immer relativ komplexe Kits und kostenintensive, spezielle Geräte und eine ebenso kostenintensive Beteiligung spezialisierter Techniker erforderlich seien. Dieser Nachteil mache die aktuell bekannten Verfahren der Herstellung von PRP ungeeignet für den Einsatz in Einrichtungen für die medizinische Versorgung.
71Darüber hinaus bestehe bei der Herstellung von Zellen hinsichtlich der Zell- oder Geweberegeneration das Problem der langfristigen Konservierung von Zellen oder Gewebe. Für die langfristige Aufbewahrung von Gewebe oder Zellen werde in der Regel die Kryokonservierung verwendet, besonders bei Thrombozyten. Diese Technik habe jedoch Nachteile und Probleme hinsichtlich der Bildung von Kristallen, Osmose-Problemen, Aggregation, Hemmung der Fähigkeit zur Protein-Synthese, Stressprotein-Expression in Reaktion auf Wärmebelastung usw. Einige Nebenwirkungen der Kryokonservierung könnten durch die Verwendung von Frostschutzmitteln wie DMSO oder Glyzerin oder anderer Kryo-Konservierungsmittel eingegrenzt werden, aber die Konzentration dieser Wirkstoffe müsse hinsichtlich ihrer Toxizität und Nebenwirkungen angepasst und eingegrenzt werden.
72Davon ausgehend besteht laut Klagepatent ein Bedarf für ein neues oder alternative Verfahren für die Herstellung von Zellen und Gewebe, das für den unvorbereiteten Einsatz geeignet ist, während die Integrität erhalten bleibt, besonders in Bezug auf die Ausscheidungsfähigkeit und Brauchbarkeit der Wachstumsfaktoren.
73Zur Lösung schlägt das Klagepatent im Anspruch 1 ein Verfahren mit den folgenden Merkmalen vor, wobei die Merkmale der in diesem Rechtsstreit nicht geltend gemachten Alternative des Klagepatentanspruchs kursiv gesetzt sind:
741. Verfahren zur Herstellung einer Zellzusammensetzung, umfassend die Schritte:
752. Zentrifugieren von Vollblut in einem Trennröhrchen;
762.1 das Trennröhrchen ist ein Glastrennröhrchen, das enthält:
772.1.1 ein thixotropes Gel auf Polyesterbasis und
782.1.2 eine gepufferte Natriumcitratlösung in 0,10 M enthält;
79oder
802.2 das Trennröhrchen ist ein Polyethylenterephthalattrennröhrchen, das enthält:
812.2.1 ein hoch thixotropes Gel,
822.2.2 das durch eine Polymermischung und ein wasserfreies Natriumcitrat in 3,5 mg/mL gebildet wird;
832.3 der Zentrifugierschritt wird mit einer Kraft von oder etwa 1500 g bis zu etwa 2000 g für eine ausreichende Zeitdauer durchgeführt, um eine Barriere zwischen Plasma, das Thrombozyten, Lymphozyten und Monozyten enthält, und einem Pellet, das Erythrozyten enthält, zu bilden;
843. Trennen von angereichertem thrombozytenreichem Plasma von Vollplasma,
853.1 indem etwa die Hälfte des Überstands entfernt wird, der thrombozytenarmes Plasma enthält,
863.2 indem der Überstand von oberhalb der Barriere aufgefangen wird und wobei das angereicherte Plasma im Vergleich zu nativem Vollblut an Leukozyten, Thrombozyten und Adhäsionsproteinen angereichert ist;
874. erneutes Suspendieren des angereicherten Plasmas.
88Das Verfahren nach dem Klagepatentanspruch 1 ist darauf gerichtet, aus dem Vollblut eine Zellzusammensetzung in Form von angereichertem Plasma zu gewinnen. Das Verfahren macht sich dazu den Umstand zunutze, dass die einzelnen Bestandteile des Vollbluts unterschiedliche Massen haben, so dass sie sich bei dem im ersten Verfahrensschritt vorgesehenen Zentrifugieren (Merkmalsgruppe 2) unter Einwirkung der Zentrifugalkraft im Trennröhrchen entsprechend ihrer Masse anordnen. Gleiches gilt für das nach der Lehre des Klagepatents im Trennröhrchen vorhandene thixotrope Gel. Bei einem thixotropen Gel handelt es sich um eine nicht-newtonsche Flüssigkeit, deren Viskosität abhängig ist von den einwirkenden mechanischen Kräften. Das heißt, beim Zentrifugieren wird das Gel flüssiger und wird mit den Bestandteilen des Vollblutes entsprechend seiner Masse im Trennröhrchen angeordnet. Nach dem Zentrifugieren wird das Gel wieder zähflüssig und wirkt als Barriere zwischen den roten Blutkörperchen und dem Blutplasma (vgl. Merkmal 2.3). Dadurch wird das Plasma isoliert und ist weiteren Bearbeitungsschritten zugänglich. Nach der Lehre des Klagepatents soll aus dem Überstand – das ist das Plasma – wiederum das thrombozytenarme Plasma entfernt werden, wodurch angereichertes Plasma zurückbehalten wird (Merkmalsgruppe 3), das erneut suspendiert werden kann (Merkmal 4).
89II.
90Die angegriffene Ausführungsform ist zur Anwendung des Verfahrens gemäß der Lehre des Klagepatenanspruchs nicht im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG geeignet. Auf Grundlage des klägerischen Vortrags lässt sich jedenfalls nicht feststellen, dass die angegriffene Ausführungsform ein thixotropes Gel auf Polyesterbasis im Sinne des Klagepatentanspruchs enthält (Merkmal 2.1.1). Ebenso wenig enthält die angegriffene Ausführungsform eine erfindungsgemäß gepufferte Natriumcitratlösung in 0,10 M (Merkmal 2.1.2). Die Verwirklichung der übrigen Merkmale kann dahinstehen.
911.
92Der Klagepatentanspruch bedarf hinsichtlich der Merkmale 2.1.1 und 2.1.2 der Auslegung. Einer darüber hinaus gehenden Auslegung bedarf es nicht, weil die Verwirklichung der übrigen Merkmale durch die angegriffene Ausführungsform dahinsteht.
93a)
94Der Klagepatentanspruch verlangt mit dem Merkmal 2.1.1, dass das Glastrennröhrchen unter anderem ein thixotropes Gel auf Polyesterbasis enthält.
95aa)
96Der Begriff „thixotrop“ wird von der Klagepatentschrift definiert. Demnach ist mit dem Ausdruck „thixotrop“ ein Gel gemeint, das durch Schütteln oder Ausübung von Druck flüssiger wird, dessen Viskosität als Reaktion auf Schütteln oder Druck also abnimmt (Abs. [0049] der Klagepatentschrift). Funktional kommt der Thixotropie des Gels damit die Aufgabe zu, dass das Gel auf der einen Seite durch das Zentrifugieren entsprechend den Parametern von Merkmal 2.3 dünnflüssig wird und dadurch Bestandteile des Blutes wie die Blutplättchen passieren lässt und auf der anderen Seite nach dem Zentrifugieren wieder so zähflüssig wird, dass es als Barriere zwischen dem Plasma und dem die Blutplättchen enthaltenden Pellet wirkt (Merkmal 2.3). Weder der Klagepatentanspruch noch die Beschreibung des Klagepatents stellen weitergehende Anforderungen an die Viskosität des Gels in Abhängigkeit von den jeweils einwirkenden Kräften. Auch aus dem Umstand, dass in der zweiten Verfahrensvariante ein hoch thixotropes Gel verlangt wird, lassen sich keine besonderen Anforderungen an die Thixotropie des Gels in der ersten Verfahrensvariante herleiten. Es genügt jedes Gel, dass funktional geeignet ist, die durch die einzelnen Verfahrensschritte aufgestellten Anforderungen zu erfüllen. Abgesehen von der im Patentanspruch verlangten Thixotropie ist danach lauf Klagepatentschrift lediglich erforderlich, dass das Gel nicht wasserlöslich ist und hinsichtlich der Blutbestandteile chemisch inert, damit es in Übereinstimmung mit der Erfindung verwendet werden kann (Abs. [0049] der Klagepatentschrift).
97bb)
98Unter einem thixotropen Gel auf Polyesterbasis versteht der Fachmann ein Gel, dessen wesentlicher Bestandteil ein als Polyester zu klassifizierender Stoff ist. Bei dem Begriff Polyester handelt es sich um einen Fachbegriff, der allgemein ein Polymer bezeichnet, dessen sich wiederholende Einheiten untereinander durch Estergruppen verbunden sind. Dies ist zwischen den Parteien unstreitig. Die Beklagte hat bereits schriftsätzlich vorgetragen, für ein Polyester sei erforderlich, dass das Polymer eine sich wiederholende Monomer-Einheit aufweise und diese (mehreren) einzelnen Einheiten durch eine Estergruppe verbunden seien. Dem ist die Klägerin nicht entgegengetreten und hat in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, dass man unter einem Polyester eine längere Kette verstehe, deren Einzelabschnitte über Esterbrücken miteinander verbunden sind. Substanziell bestehen zwischen diesen Definitionen für „Polyester“ keine Unterschiede. In chemischen Formeln ausgedrückt gibt Römpp, Chemie-Lexikon, 9. Aufl. 1992, unter dem Stichwort Polyester als allgemeine Definition die „Bezeichnung für Polymere der allgemeinen Formel I bzw. II:
99 
– O – R – C –
101II
102O n
103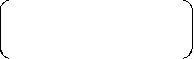 – O – R1 – O – C – R² – C –
– O – R1 – O – C – R² – C –
II II
105O O n”
106b)
107Mit dem Merkmal 2.1.2 verlangt der Klagepatentanspruch weiterhin, dass das Trennröhrchen eine gepufferte Natriumcitratlösung in 0,10 M enthält. Es ist unstreitig, dass Natriumcitrat im Rahmen der Lehre des Klagepatents als Gerinnungshemmer fungiert, da das in dem Trennröhrchen gesammelte Blut ohne weiteres Zutun mit der Zeit gerinnen würde. Eine Trennung des Vollblutes in Plasma und Erythrozyten wäre nicht mehr möglich. Es bedarf daher Mittel, um die Gerinnung zu verhindern, wofür das Natriumcitrat dient.
108aa)
109Das Natriumcitrat soll in einer gepufferten Lösung vorliegen. Nach dem unbestrittenen Vortrag der Klägerin ist ein Puffer eine Lösung einer schwachen/mittelstarken Säure/Base mit ihrer korrespondierenden Base/Säure, die eine Stabilisierung des pH-Wertes innerhalb eines bestimmten Bereiches ermöglicht. Letztlich besteht die Lösung aus einem im Gleichgewicht befindlichen Gemisch aus Zitronensäure, Citrat als korrespondierender Base, und Natriumionen.
110bb)
111Der Klagepatentanspruch verlangt zudem, dass es sich um eine gepufferte Natriumcitratlösung in 0,10 M (in der englischen Originalfassung: „a buffered sodium citrate solution at 0.10 M“) handelt. Die Parteien sind sich einig, dass es sich dabei um eine Konzentrationsangabe handelt, nach der 0,1 Mol Natriumcitrat in einem Liter Lösungsmittel gelöst sein sollen, wobei der Klagepatentanspruch letztlich offen lässt, welche absolute Menge an Natriumcitratlösung in den Trennröhrchen enthalten sein soll.
112Bei der Angabe 0,10 M handelt es sich um eine Maßangabe. Nach gefestigter höchstrichterlicher Rechtsprechung sind Zahlen- und Maßangaben wie jeder Bestandteil eines Patentanspruchs grundsätzlich der Auslegung fähig. Wie auch sonst kommt es darauf an, wie der Fachmann solche Angaben im Gesamtzusammenhang des Patentanspruchs versteht, wobei auch hier zur Erläuterung dieses Zusammenhangs Beschreibung und Zeichnungen heranzuziehen sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Zahlen- und Maßangaben schon nach ihrem objektiven Gehalt, der auch das Verständnis des Fachmanns prägen wird, nicht einheitlich sind, sondern in unterschiedlichen Formen Sachverhalte mit durchaus verschiedenen Inhalten bezeichnen können. Schon diese Umstände schließen es aus, dass der Fachmann Zahlen-, Maß- oder Bereichsangaben eine immer gleiche feste Bedeutung zuweisen wird. Jedoch wird er solchen Angaben in aller Regel einen höheren Grad an Eindeutigkeit und Klarheit zubilligen, als dies bei verbal umschriebenen Elementen der erfindungsgemäßen Lehre der Fall wäre. Denn Zahlen sind als solche eindeutig, während sprachlich formulierte allgemeine Begriffe eine gewisse Abstraktion von dem durch sie bezeichneten Gegenstand bedeuten. Zudem müssen solche Begriffe, wenn sie in einer Patentschrift verwendet werden, nicht notwendig in dem Sinn gebraucht werden, den der allgemeine technische Sprachgebrauch ihnen beimisst; die Patentschrift kann insoweit ihr „eigenes Wörterbuch” bilden. Aus der Sicht des fachmännischen Lesers kann durch Zahlen- und Maßangaben konkretisierten Merkmalen deshalb die Bedeutung zukommen, dass der objektive, erfindungsgemäß zu erreichende Erfolg genauer und ggf. enger eingegrenzt wird, als dies bei bloß verbaler Umschreibung der Fall wäre. Da es Sache des Anmelders ist, dafür zu sorgen, dass in den Patentansprüchen alles niedergelegt ist, wofür er Schutz begehrt, darf der Leser der Patentschrift annehmen, dass diesem Erfordernis auch bei der Aufnahme von Zahlenangaben in die Formulierung der Patentansprüche genügt worden ist. Dies gilt umso mehr, als der Anmelder bei Zahlenangaben besonderen Anlass hat, sich über die Konsequenzen der Anspruchsformulierung für die Grenzen des nachgesuchten Patentschutzes klar zu werden. Eine eindeutige Zahlenangabe bestimmt und begrenzt den geschützten Gegenstand grundsätzlich insoweit abschließend; ihre Über- oder Unterschreitung ist daher in aller Regel nicht mehr zum Gegenstand des Patentanspruchs zu rechnen. Andererseits schließt dies nicht aus, dass der Fachmann eine gewisse, beispielsweise übliche Toleranzen umfassende, Unschärfe als mit dem technischen Sinngehalt einer Zahlenangabe vereinbar ansieht. Maßgeblich ist der unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen zu ermittelnde Sinngehalt des Patentanspruchs. Dies gilt grundsätzlich auch für Zahlenbereiche mit Grenzwerten. Ein Verständnis, dass ein Wert genau einzuhalten ist, wird vor allem dann der Vorstellung des Fachmanns entsprechen, wenn er erkennt, dass es sich um einen „kritischen” Wert handelt. Wie eine bestimmte Zahlen- oder Maßangabe im Patentanspruch demnach zu verstehen ist, ist eine Frage des der tatrichterlichen Beurteilung unterliegenden fachmännischen Verständnisses im Einzelfall (BGH GRUR 2002, 511, 512 f – Kunststoffrohrteil; GRUR 2002, 515, 517 f – Schneidmesser I; GRUR 2002, 519, 521 f – Schneidmesser II; GRUR 2002, 523, 525 – Custodiol I; GRUR 2002 527, 529 f – Custodiol II; GRUR 2007, 1059, 1062 f – Zerfallszeitmessgerät).
113Nach diesen Grundsätzen ist die Maßangabe 0,10 M grundsätzlich ernst zu nehmen. Sie stellt einen exakten Einzelwert dar, der gemäß seinem technischen Wortsinn Abweichungen nur im Rahmen üblicher Toleranzen bei der Herstellung von Natriumcitratlösungen mit einer (Soll-)Konzentration von 0,1 M zulässt.
114(1)
115Zunächst ist festzustellen, dass die Maßangabe 0,10 M keinen Wertebereich darstellt, sondern einen exakten Einzelwert, der nicht anders zu bewerten ist als eine Konzentration von 0,1 M, von denen sie Werte mit weiteren Nachkommastellen wie etwa 0,11 M oder 0,101 M mathematisch grundsätzlich unterscheiden. Daher kann aus dem Umstand, dass die Zahlenangabe im Klagepatentanspruch hinter der zweiten Nachkommastelle abbricht, nicht hergeleitet werden, dass jegliche Abweichung in der dritten Nachkommastelle vom Wortsinn des Klagepatentanspruchs umfasst sein soll. Eine solche an der bloßen Schreibweise der Zahlenangabe orientierte Argumentation ist mit der am technischen Sinngehalt zu orientierenden Auslegung des Klagepatentanspruchs nicht vereinbar. Dass sie zu kurz greift, zeigt sich schon daran, dass beliebig kleine Abweichungen nach unten nicht erfasst werden, weil sie bereits die erste Nachkommastelle beeinflussen, etwa wenn die Konzentration nur 0,099 M beträgt. Sie würde zudem bei jeder Zahlen- oder Maßangabe in einem Patentanspruch dazu führen, dass Abweichungen in einer Nachkommastelle, die in dem Patentanspruch nicht explizit beziffert ist, unbeachtlich sind. Dies hat aber mit einer am technischen Sinngehalt orientierten Auslegung nichts mehr zu tun.
116(2)
117Der Fachmann erkennt jedoch, dass eine Natriumcitratlösung mit einer Konzentration von 0,10 M besonders vorteilhaft ist, weil sie die Blutgerinnung zuverlässig hemmt. Wie bereits ausgeführt, übernimmt das Natriumcitrat nach der technischen Lehre des Klagepatents die Aufgabe eines Gerinnungshemmers. Welche Funktion die konkrete Konzentration des Natriumcitrats in der Lösung für das patentgemäße Verfahren hat, ergibt sich nicht unmittelbar aus der Klagepatentschrift. Die Beschreibung des Klagepatents äußert sich zu dem verwendeten Gerinnungshemmer und seiner Konzentration in keiner Weise. Die Klagepatentschrift kennt überhaupt nur ein Ausführungsbeispiel, das der Lehre des Klagepatentanspruchs in der ersten Alternative entspricht. Demnach wird ein Glastrennröhrchen verwendet, das 3 ml eines polyesterbasierten thixotropischen Gels, 1 ml Natriumcitratlösung bei 0,1 M enthält und ein Vakuum von etwa 8,5 ml. Die Patentschrift beschreibt dieses Glasröhrchen als einsatzbereites Gerät für die Herstellung einer Thrombozytenzusammensetzung, das auch RegenTHT genannt werde, mithin ein Produkt der Klägerin darstellt (vgl. Abs. [0158] der Klagepatentschrift). Dies deutet darauf hin, dass eine Konzentration von 0,10 M eine besonders vorteilhafte Konzentration für einen Gerinnungshemmer in Form einer Natriumcitratlösung darstellt. Dafür spricht auch die in der Klagepatentschrift als Stand der Technik erwähnte Patentanmeldung US BB, die unter anderem ein Verfahren zur Herstellung einer Thrombozyten-Konzentrat-Zusammensetzung mit den Schritten Zentrifugieren von Vollblut und Resuspendierung von angereichertem Plasma zum Gegenstand hat (Abs. [0015] der Klagepatentschrift). Demnach kann beispielsweise eine 0,1 M Natriumcitratlösung mit einem pH-Wert von 7,0 (+/- 0,15) durch Auflösen von 29,4 g Na3Citrat.H2O und 0,27 g Zitronensäure.H2O in einem Liter H2O hergestellt werden (Sp. 9 der Anlage AR-D6, in deutscher Übersetzung als Anlage AR-D6a). Nach der US-Anmeldung sollte die Konzentration der Lösung ausreichend sein, um die Koagulation einer Blutprobe zu verhindern. Dafür sollte die Konzentration von Natriumcitrat im Bereich von 0,05 M bis etwa 0,2 M und vorzugsweise von etwa 0,08 M bis etwa 0,13 M liegen, besonders vorzugswürdig zwischen 0,09 M bis etwa 1,1 M und optimalerweise bei 0,1 M (Sp. 9 und 10 der AR-D6a). Auch wenn nicht jede Einzelheit aus der US-Patentanmeldung in den Klagepatentanspruch hineingelesen werden kann (vgl. Schulte/Rinken, PatG 10. Aufl.: § 14 Rn 53), stellt sie doch ein gewichtiges Indiz für das Verständnis des Fachmanns von der Lehre des Klagepatentanspruchs dar. Dieser weiß, dass die Konzentration der Natriumcitratlösung Auswirkungen auf die Blutgerinnung hat und ein Wert von 0,1 M in dieser Hinsicht besonders vorteilhaft ist.
118(3)
119Der Wert von 0,10 M schließt Abweichungen nach oben und unten nicht aus. Dem Fachmann ist bewusst, dass es sich bei einem Wert von 0,10 M nicht um einen besonders kritischen Wert handelt. Bereits die US-Patentanmeldung gibt Wertebereiche an, von denen grundsätzlich anzunehmen ist, dass Konzentrationen innerhalb dieser Bereiche die Blutgerinnung sicher hemmen. Die Klägerin weist insofern auch darauf hin, dass es weniger auf die ursprüngliche Konzentration der Natriumcitratlösung als auf die Konzentration des Gerinnungshemmers im abgenommenen Blut ankomme, die absolute Menge des abgenommenen Blutes aber je nach Patient und Umständen der Blutentnahme variieren könne.
120Dies kann jedoch nicht dazu führen, dass der technische Wortsinn der Angabe 0,10 M sämtliche Natriumcitratlösungen umfasst, die noch als Gerinnungshemmer geeignet sind. Eine solche Auslegung reduzierte die Zahlenangabe auf die bloße Funktion der Natriumcitratlösung als Gerinnungshemmer. Dies ist nach der soeben zitierten höchstrichterlichen Rechtsprechung aber gerade nicht zulässig. Stattdessen ist Zahlen- und Maßangaben in aller Regel ein höherer Grad an Eindeutigkeit und Klarheit zuzubilligen, als dies bei verbal umschriebenen Elementen der erfindungsgemäßen Lehre der Fall wäre. Denn Zahlen sind als solche eindeutig, während sprachlich formulierte allgemeine Begriffe eine gewisse Abstraktion von dem durch sie bezeichneten Gegenstand bedeuten. Eine eindeutige Zahlenangabe bestimmt und begrenzt den geschützten Gegenstand grundsätzlich insoweit abschließend; ihre Über- oder Unterschreitung ist daher in aller Regel nicht mehr zum Gegenstand des Patentanspruchs zu rechnen.
121Demnach ist zu berücksichtigen, dass der Klagepatentanspruch gerade keinen Wertebereich angibt, sondern lediglich einen isolierten Wert von 0,10 M. Weiterhin wird der Fachmann erkennen, dass sich der Wert auf die Konzentration der Natriumcitratlösung als solche bezieht. Es mag sein, dass es für die Gerinnungshemmung weniger auf die Konzentration der Natriumcitratlösung als auf das Verhältnis zur Menge an Vollblut ankommt. Aber weder gibt der Klagepatentanspruch ein solches Verhältnis an, noch nennt er – anders als das Ausführungsbeispiel – eine absolute Menge an Natriumcitratlösung oder Vollblut. Daher kann im Hinblick auf etwaige Schwankungen der Vollblutmenge nichts für die Bestimmung von Abweichungen in der Konzentration der Natriumcitratlösung hergeleitet werden. Letztlich ließe sich jede Abweichung von 0,10 M rechtfertigen, solange nur die Gerinnungshemmung gewährleistet ist. Damit würde die Zahlenangabe aber wiederum nur in unzulässiger Weise auf ihre bloße Funktion reduziert. Insofern ist auch zu berücksichtigen, dass das Verhältnis von Natriumcitrat zum Vollblut ebenso über die absolute Menge an Natriumcitratlösung gesteuert werden kann, für die das Klagepatent gerade keine Vorgaben enthält.
122An dieser Stelle kommt weiterhin zum Tragen, dass der Patentanspruch nicht einen Gerinnungshemmer als solchen schützt, sondern ein Verfahren zur Gewinnung einer Thrombozytenzusammensetzung, bei dem der Gerinnungshemmer neben einem thixotropen Gel auf Polyesterbasis Inhalt eines Glastrennröhrchens ist. Auch wenn der Klagepatentanspruch keine relativen oder absoluten Mengen für das Gel und die Natriumcitratlösung angibt, handelt es sich – wie auch die Klägerin in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat – um ein sensibel austariertes System, für das bestimmte Gele, Lösungsmittel und Mengenverhältnisse erforderlich sind, damit das Verfahren erfolgreich durchgeführt werden kann. Denn einerseits muss die Natriumcitratlösung geeignet sein, die Gerinnung des Vollblutes zu hemmen, andererseits darf es die Eigenschaften des thixotropen Gels nicht derart beeinflussen, dass die gewünschte Trennung von Plasma und Erythrozyten nicht bewerkstelligt werden kann. Es mag sein, dass bestimmte Abweichungen in der Konzentration der Natriumcitratlösung dieses System aus Natriumcitratlösung und thixotropem Gel nicht beeinflussen. Daraus kann aber nicht hergeleitet werden, dass sämtliche Abweichungen schlechthin vom Wortsinn des Klagepatentanspruchs umfasst seien. Abgesehen davon, dass nicht vorgetragen ist, in welchem Umfang solche Abweichungen überhaupt möglich sind, liefe eine solche Auslegung wiederum darauf hinaus, die Zahlenangabe lediglich auf die Funktion der Gerinnungshemmung – allenfalls beschränkt durch die Funktionsfähigkeit des Systems als solches – zu reduzieren. Vielmehr ist anzunehmen, dass der Fachmann im Hinblick darauf, dass es sich um ein austariertes System handelt, den Wert von 0,10 M für das Austarieren des System als vorteilhaft wahrnimmt und daher nicht jede mögliche Abweichung von diesem Wert als vom Wortsinn erfasst ansieht.
123(4)
124Nach alledem wird der Fachmann die Angabe von 0,10 M für die Konzentration der Natriumcitratlösung ernst nehmen und nur solche Abweichungen vom Wortsinn umfasst ansehen, die sich im Rahmen der üblichen Toleranzen für die Herstellung einer Natriumcitratlösung in 0,10 M ergeben. Soweit die Klägerin für etwaige Toleranzen auf die übliche Schwankungsspanne bei der Befüllung der Röhrchen abstellt (Ziff. vii) der Anlage K 22), ist dies unbeachtlich. Denn es ist nicht davon auszugehen, dass die Natriumcitratlösung erst im Glastrennröhrchen hergestellt wird. Vielmehr ist anzunehmen, dass zunächst die Lösung hergestellt und dann das Röhrchen befüllt wird. Die Konzentration der Lösung ist jedoch vom Befüllvorgang des Röhrchens unabhängig und vorher wie nachher gleich. Wird von einem solchen Herstellungsablauf ausgegangen, sind Herstellungstoleranzen in der Konzentration einer Natriumcitratlösung sicherlich nicht im oberen einstelligen Prozentbereich zu erwarten. Aus der bereits zitierten US-Patentanmeldung ergibt sich, dass beispielsweise für eine 0,1 M Natriumcitratlösung 29,4 g Na3Citrat.H2O und 0,27 g Zitronensäure.H2O in einem Liter H2O aufgelöst werden. Es ist dem Fachmann bekannt, dass die Masse des verwendeten Natriumcitrats ohne weiteres auf die Nachkommastelle genau bemessen werden kann. Selbst wenn Schwankungen von 1 g für Natriumcitrat zulässig sein sollten, handelt es sich um eine Abweichung von gut 3 %, die sich genau so auch in der Konzentration der Natriumcitratlösung wiederfindet; diese beträgt dann nicht 0,1 M sondern etwa 0,103 M. Etwaige Schwankungen bei der Bemessung der Zitronensäure fallen hingegen kaum ins Gewicht, da sie im Wesentlichen der Pufferung der Natriumcitratlösung und der Einstellung des pH-Wertes dient. Im Übrigen ist auch hier bei der Herstellung einer entsprechenden Menge an Lösung ohne weiteres eine Genauigkeit bis zur zweiten Nachkommastelle bei der Bemessung der Zitronensäure möglich.
1252.
126Nach diesen Ausführungen kann die objektive Eignung der angegriffenen Ausführungsform zur Anwendung des patentgemäßen Verfahrens nicht festgestellt werden, weil jedenfalls die Merkmale 2.1.1 und 2.1.2 nicht verwirklicht werden.
127a)
128Die Klägerin hat nicht dargelegt, dass die angegriffene Ausführungsform ein thixotropes Gel auf Polyesterbasis enthält (Merkmal 2.1.1).
129aa)
130Die Darlegungs- und Beweislast für die Verwirklichung der Merkmale des Klagepatentanspruchs trägt der Kläger. Seiner Darlegungslast kommt er zunächst dadurch nach, dass er die konkrete Behauptung aufstellt, die angegriffene Ausführungsform mache von jedem Merkmal des Patentanspruchs Gebrauch. Irgendeines Nachweises hierzu bedarf es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die Notwendigkeit ergänzenden, weiter substantiierten Vortrages ergibt sich für den Kläger erst dann, wenn der Beklagte die Verwirklichung eines oder mehrerer Merkmale bestritten hat. Dem Beklagten obliegt es deshalb, sich darüber zu erklären, ob und ggf. welches Anspruchsmerkmal von der angegriffenen Ausführungsform nicht verwirklicht werden soll. Dies kann zunächst ebenfalls pauschal erfolgen und braucht nicht weiter substantiiert zu werden als die gegenteilige (pauschale) Behauptung des Klägers. Nur wenn der Beklagte sich im genannten Sinne konkret geäußert hat, ist der betreffende Sachvortrag streitig, so dass der Kläger jetzt seine Verletzungsbehauptung weiter ausführen, d.h. mitteilen muss, aufgrund welcher Untersuchungen er zu welchen die Patentverletzung bestätigenden Ergebnissen gelangt ist (Kühnen, Hb. d. Patentverletzung, 11. Aufl.: Kap. E Rn 147).
131bb)
132Nach diesen Grundsätzen hat die Klägerin die Verwirklichung des Merkmals 2.1.1 nicht hinreichend substantiiert dargelegt.
133(1)
134Die Klägerin hat lediglich einfach behauptet, dass es sich bei dem in der angegriffenen Ausführungsform verwendeten Gel um ein polyesterbasiertes Gel handele. Sie hat zwar – von der Beklagten mit Nichtwissen bestritten – an der angegriffenen Ausführungsform der Typen F und D eine Infrarot-Spektralanalyse durchführen lassen, deren Auswertung sie als Anlage K 21 (in deutscher Übersetzung als Anlage K 22) in Form einer gutachterlichen Stellungnahme ihrer Mitarbeiterin Dr. CCvorgelegt hat. Sie hat das Ergebnis aber lediglich mit dem Ergebnis einer Spektralanalyse ihres eigenen Produkts verglichen, von dem sie behauptet, dass es polyesterbasiert sei. Sie hat vorgetragen, der Vergleich der Spektralanalysen beweise die enge stoffliche Verwandtschaft der beiden Gele. Damit hat sie das in der angegriffenen Ausführungsform als Gel verwendete Material als solches nicht unabhängig bestimmt, mithin anhand üblicher und dem Fachmann bekannter Methoden analysiert und klassifiziert. Sie hat stattdessen die Behauptung, die angegriffene Ausführungsform enthalte ein polyesterbasiertes Gel, lediglich durch die Behauptung ersetzt, das in ihrem Produkt verwendete Gel sei polyesterbasiert.
135Es mag sein, dass die Spektren der von der Klägerin untersuchten angegriffenen Ausführungsform und ihres eigenen Produkts ähnlich oder gar identisch sind. Dies wird auch von der Beklagten nicht in Abrede gestellt. Allerdings ist nicht ersichtlich, ob und wie die Klägerin das Material des in ihrem Produkt verwendeten Gels bestimmt hat. Sie behauptet lediglich, dass dieses Gel polyesterbasiert sei. Woraus sich das ergibt, wird jedoch nicht weiter substantiiert. Noch weniger wird das im Produkt der Klägerin verwendete Gel weiter spezifiziert. Es bleibt unklar, ob es sich um eine Mischung verschiedener Materialien handelt und welches konkrete Polyester in dem Gel Verwendung findet. Weder die Beklagte, noch die Kammer kann überhaupt beurteilen, ob das Produkt der Klägerin ein Gel auf Polyesterbasis im Sinne des Klagepatents verwendet. Im Ergebnis ist der Vortrag der Klägerin damit auf die einfache Behauptung beschränkt, das in der angegriffenen Ausführungsform verwendete Gel sei polyesterbasiert.
136Allein durch die gutachterliche Stellungnahme ihrer Mitarbeiterin CC wird der schriftsätzliche Vortrag der Klägerin ein wenig unterfüttert. Diese führt aus, dass in den Spektren der Peak bei 1729/30 cm-1 das Vorhandensein einer Ester-Gruppe belege, insbesondere falle er in den Erstreckungsbereich der C=O-Verbindung eines Esters (Ziff. v) der Anlage K 21 bzw. K 22). Es bleibt aber unklar, ob und inwieweit dieser Befund für einen Polyester spricht oder nur allgemein das Vorhandensein von Estergruppen belegt. Die übrigen Ausführungen in der gutachterlichen Stellungnahme vermögen den Vortrag einer Patentverletzung nicht weiter zu substantiieren. Sie sind völlig allgemein gehalten und werden auch von der Klägerin nicht näher erläutert, sind damit also unergiebig. So wird ausgeführt, weitere Peaks sowie das Gesamtmuster des Gels bestätigten zusätzlich das Vorhandensein eines polyesterbasierten Gels. Welche Peaks im Einzelnen gemeint sind und was mit „Gesamtmuster“ gemeint ist, bleibt offen. Auch was mit den weiter erwähnten Datenbankauszügen gemeint ist, wird nicht näher ausgeführt. Vergleichsspektren, so sie denn überhaupt Gegenstand der Spektralanalyse waren, werden weder genannt, noch dargestellt. Worauf die Klägerin ihre Annahme stützt, das Spektrum des in der angegriffenen Ausführungsform bzw. in ihrem eigenen Produkt eingesetzten Gels sei für ein Gel auf Polyesterbasis typisch, wird nicht dargelegt.
137(2)
138Die Beklagte hat diesen Vortrag der Klägerin substantiiert bestritten. Denn sie hat vorgetragen, dass es sich bei dem von ihr in der angegriffenen Ausführungsform verwendeten Gel um eine Zusammensetzung aus einem Polyolefin, konkret aus einem Polyolefin Hydrocarbon Oligomer, und Tris(2-ethylhexyl)trimellitat handelt. Es ist unstreitig, dass eine solche Zusammensetzung kein Polyester und auch kein Gel auf Polyesterbasis darstellt. Bereits in der Klageschrift hat die Beklagte in Abrede gestellt, dass ihre Trennröhrchen ein thixotropes Gel auf Polyesterbasis aufweisen. Das Gel sei in der Vergangenheit mindestens einmal modifiziert worden. Das hier maßgebliche Gel enthalte eine monomerische Estergruppe, die nicht die charakteristischen strukturellen Eigenschaften eines „Polyesters“ aufweise. Diesen Vortrag hat die Beklagte in der Duplik weiter konkretisiert. Sie hat vorgetragen, sie habe seit der Patenterteilung keine Trennröhrchen mit einem thixotropen Gel auf Polyesterbasis vertrieben. Das Gel der angegriffenen Ausführungsform basiere stattdessen auf einem Polyolefin. In einem weiteren Schriftsatz hat die Beklagte ihren Vortrag dann noch weiter konkretisiert und durch ein von ihr in einem englischen Parallelverfahren vorgelegtes Gutachten des von ihr beauftragten Sachverständigen Z (Anlage AR 9, in deutscher Übersetzung Anlage AR 9a) gestützt. Auch Z führte IR-Spektralanalysen mit dem Gel der angegriffenen Ausführungsform durch. Es ergab sich ein mit den von der Klägerin untersuchten Proben nahezu identisches Spektrum. Der Peak bei 1729 cm-1 zeigt nach dem Vortrag der Beklagten jedoch allenfalls ein Ester-Carbonyl, nicht aber ein Polyester. Weiterhin nahm Z eine rechnergestützte Datenbankrecherche vor, um den untersuchten Stoff zu identifizieren. Die Datenbank enthält spezifische Spektralmuster einer Vielzahl von Verbindungen, die mit dem gemessenen Spektrum verglichen werden können, so dass Verbindungen bei entsprechenden Übereinstimmungen identifiziert werden können. Nach der Recherche von Z ergab sich als bestes Ergebnis eine Korrelation von 86 % mit Trihexyl-Trimellitat (97 %). Trihexyl-Trimellitat enthält Estergruppen, allerdings nicht in der Form eines Polyesters im Sinne des Klagepatents. Nach dem schriftsätzlichen Vortrag der Beklagten enthält das Gel der angegriffenen Ausführungsform tatsächlich Tris(2-ethylhexyl)trimellitat. Auf Nachfrage hat die Beklagte in der mündlichen Verhandlung ergänzt, das Gel der angegriffenen Ausführungsform bestehe zu 40 bis 60 % aus Polyolefin Hydrocarbon Oligomer und zudem aus Tris(2-ethylhexyl)trimellitat. Zudem wurden von Z weitere Untersuchungen durchgeführt, die das Ergebnis der Spektralanalyse stützen sollen.
139(3)
140Die Klägerin hat ihren Vortrag auch vor dem Hintergrund der von der Beklagten konkret für das Gel der angegriffenen Ausführungsform genannten Materialien und der vorgelegten Untersuchungen nicht weiter substantiiert. Sie bleibt stattdessen bei der einfachen Behauptung, es handele sich bei dem in der angegriffenen Ausführungsform verwendeten Gel um ein polyesterbasiertes Gel, weil auch ihr eigenes Produkt ein polyesterbasiertes Gel verwende. Die Beklagte stellt lediglich das methodische Vorgehen von Z in Frage. Unter anderem stellt sie es als fehlerhaft dar, dass Z das IR-Spektrum eines Stoffgemischs mit einer Datenbank abgleicht, die Vorschläge von Reinstoffen enthält. Ein Vergleich mit Stoffgemischen finde überhaupt nicht statt, daher könne auch kein Stoffgemisch, das einen Polyester enthalte, gefunden werden. Selbst wenn dieser Einwand und auch die anderen Einwände der Klägerin hinsichtlich des Gutachtens von Z durchgreifen sein sollten, ist für die Verwendung eines Gels auf Polyesterbasis in der angegriffenen Ausführungsform nichts dargetan. Es bleibt vielmehr bei der Behauptung der Beklagten, bei dem Gel in der angegriffenen Ausführungsform handele es sich um eine Mischung aus einem Polyolefin und einem Trimellitat. Bereits diese Behauptung genügt für das substantiierte Bestreiten der einfachen Behauptung der darlegungs- und beweisbelasteten Klägerin, die angegriffene Ausführungsform verwende ein polyesterbasiertes Gel. Dass der Peak bei 1729 cm-1 nicht zwingend für einen Polyester spricht, hat die Beklagte plausibel erläutert. Dem ist auch die Klägerin nicht weiter entgegengetreten.
141Auch der weitere Vortrag der Klägerin trägt nicht zur weiteren Substantiierung bei. Sie hat vorgetragen, in verschiedenen von den Internetseiten www.promedics.org und abrufbaren Dokumenten werde mitgeteilt, dass in der angegriffenen Ausführungsform des Typs F als thixotropes Gel ein so genanntes „z-Gel“ verwendet werde, dass auch die Klägerin in der Vergangenheit verwendet habe; es handele sich um ein polyesterbasiertes Gel. Ungeachtet der streitigen Frage, ob und inwieweit die Beklagte für das Produkt F verantwortlich ist, ist nicht ersichtlich und von der Beklagten bestritten, dass diese überhaupt für die Dokumente und Internetseiten verantwortlich ist. Weiterhin hat die Beklagte in der mündlichen Verhandlung zuletzt ausdrücklich bestritten, dass die Beklagte ein so genanntes z-Gel verwendet habe und dieses polyesterbasiert sei. Damit bleibt es letztlich bei der bloßen Behauptung der Klägerin, die Beklagte verwende in der angegriffenen Ausführungsform ein thixotropes Gel auf Polyesterbasis.
142Soweit die Klägerin vorträgt, die Beklagte verhalte sich widersprüchlich, weil sie in dem das Klagepatent betreffenden Einspruchsverfahren behaupte, in dem Produkt der Klägerin sei ein Gel auf Polyesterbasis verwendet worden, diese Polyesterbasis in den eigenen Produkten trotz der nahezu identischen Spektralanalysen aber bestreite, greift auch das nicht durch. Die Klägerin bewertet lediglich mündlichen Vortrag der Beklagten, der den jeweiligen prozessualen Anforderungen der verschiedenen Verfahren geschuldet ist. Sie selbst legt aber nicht substantiiert dar, welche Materialien in der angegriffenen Ausführungsform verwendet werden. Zudem hat die Klägerin trotz der Einwände der Beklagten und der Nachfrage des Vorsitzenden in der mündlichen Verhandlung nie mitgeteilt, wann und wo sie die von ihr untersuchten Glastrennröhrchen erworben hat und welche Röhrchen im Einzelnen untersucht wurden. Für die Beklagte ist somit überhaupt nicht möglich, im Einzelnen nachzuvollziehen, welche Gele in welchem Röhrchen Verwendung fanden. Insofern hat die Beklagte noch in der mündlichen Verhandlung mit Nichtwissen bestritten, dass das untersuchte Trennröhrchen der Klägerin und die vorprioritär verwendeten Röhrchen der Klägerin identisch seien.
143b)
144Die angegriffene Ausführungsform enthält auch keine gepufferte Natriumcitratlösung in 0,10 M (Merkmal 2.1.2).
145Die angegriffene Ausführungsform enthält nach dem Vortrag der Klägerin Acid-Citrate-Dextrose (ACD) in einer Stoffmengenkonzentration von 0,109 M. Eine solche Abweichung von 9 % vom anspruchsgemäßen Wert von 0,10 M ist nach zutreffender Auslegung nicht mehr von der Lehre des Klagepatents umfasst. Es handelt sich um eine Abweichung weit jenseits üblicher Herstellungstoleranzen, die aus der Lehre des Klagepatentanspruchs herausführt.
146Die Klägerin hat zwar gestützt auf die gutachterliche Stellungnahme ihrer Mitarbeiterin behauptet, der Wert von 0,109 M liege im Bereich der Messfehlertoleranz. Eine Konzentration im „1000stel-Bereich“ könne nicht zuverlässig gemessen oder industriell abgefüllt werden. Dies hat die Beklagte jedoch bestritten. Weiter substantiiert hat die Klägerin ihren Vortrag nicht, noch weniger hat sie Beweis angetreten. In der Tat kann nicht angenommen werden, dass eine Abweichung von 9 % im Bereich einer Messfehlertoleranz liegt. Auch der Verweis auf den „1000stel-Bereich“ der Konzentrationsangabe verfängt nicht. Die Angabe einer Konzentration für eine Natriumcitratlösung bis auf drei Nachkommastellen ist aus Sicht des Fachmanns durchaus üblich. Dies belegt nicht nur die Angabe 0,109 M für ACD in der angegriffenen Ausführungsform, sondern auch die Tabelle in der bereits zitierten US-Patentanmeldung, die Angaben von 0,109 M und 0,129 M für gepuffertes Natriumcitrat angibt und 0,10 M für Leucoprep-Citrat (Sp. 5 der Anlagen AR-D6a). Solche Maßangaben wären sinnlos, wenn die Konzentration der Lösungen ohnehin nicht auf die dritte Nachkommastelle genau hergestellt werden könnte. Davon ist aber auszugehen, da es sich um den Bereich der Medizinprodukte handelt, bei dem von einer besonders hohen Genauigkeit auszugehen ist
147Auch wenn – wie im Rahmen der Auslegung – nicht die molare Konzentration sondern die korrespondierenden Masseangaben bezogen auf 1 L Lösung betrachtet werden, bewegt sich der so genannte „1000stel-Bereich“ zwischen Werten von etwa 0,25 g bis 2,5 g. Mit alledem setzt sich die Klägerin nicht auseinander, sondern bleibt bei der allgemeinen Behauptung, eine Abweichung von 9 % – mithin von über 2 g bezogen auf 1 L Lösung – bewege sich im Rahmen von Toleranzen. Dem vermag die Kammer aus den vorgenannten Gründen nicht zu folgen. Eine Konzentration von 0,109 M wird der Fachmann nicht mehr als einen Wert ansehen, der im Bereich üblicher (Herstellungs-)Toleranzen für eine Natriumcitratlösung mit einer Konzentration von 0,10 M liegt.
148Soweit die Klägerin zur Begründung von Abweichungen von der Konzentration von 0,10 M auf Ungenauigkeiten im Abfüllprozess und bei der Blutentnahme abstellt, ist bereits ausgeführt worden, dass davon die Konzentration der Natriumcitratlösung als solche unberührt bleibt.
149c)
150Das Erfordernis einer gepufferten Natriumcitratlösung in 0,10 M wird auch nicht mit äquivalenten Mitteln verwirklicht.
151Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung gilt wie für die Erfassung des technischen Sinngehalts des Patentanspruchs auch für die Bestimmung eines über diesen hinausreichenden Schutzbereichs, dass im Anspruch enthaltene Zahlen- oder Maßangaben mit den angegebenen Werten den geschützten Gegenstand begrenzen. Im Rahmen der Schutzbereichsbestimmung darf vom Sinngehalt der Zahlen- und Maßangaben nicht abstrahiert werden. Bei der Prüfung der Frage, ob der Fachmann eine Ausführungsform mit einem vom Anspruch abweichenden Zahlenwert auf Grund von Überlegungen, die sich am Sinngehalt der im Anspruch umschriebenen Erfindung orientieren, als gleichwirkende Lösung auffinden kann, muss vielmehr die sich aus der Zahlenangabe ergebende Eingrenzung des objektiven, erfindungsgemäß zu erreichenden Erfolgs berücksichtigt werden. Als im Sinne des Patentanspruchs gleichwirkend kann nur eine Ausführungsform angesehen werden, die der Fachmann als eine solche auffinden kann, die nicht nur überhaupt die Wirkung eines - im Anspruch zahlenmäßig eingegrenzten - Merkmals der Erfindung erzielt, sondern auch gerade diejenige, die nach seinem Verständnis anspruchsgemäß der zahlenmäßigen Eingrenzung dieses Merkmals zukommen soll. Fehlt es daran, ist auch eine objektiv und für den Fachmann erkennbar technisch ansonsten gleichwirkende Ausführungsform vom Schutzbereich des Patents grundsätzlich nicht umfasst. Wie bei anderen Elementen des Patentanspruchs auch darf deshalb die anspruchsgemäße Wirkung nicht unter Außerachtlassung von im Anspruch enthaltenen Zahlen- und Maßangaben bestimmt werden. Es reicht daher für die Einbeziehung abweichender Ausführungsformen in den Schutzbereich grundsätzlich nicht aus, dass nach der Erkenntnis des Fachmanns die erfindungsgemäße Wirkung im Übrigen unabhängig von der Einhaltung des Zahlenwerts eintritt. Erschließt sich dem Fachmann kein abweichender Zahlenwert als im Sinne des anspruchsgemäßen Werts gleichwirkend, erstreckt sich der Schutzbereich insoweit nicht über den Sinngehalt des Patentanspruchs hinaus. Die anspruchsgemäße Wirkung des zahlenmäßig bestimmten Merkmals wird in diesem Fall nach dem Verständnis des Fachmanns durch die (genaue) Einhaltung eines Zahlenwerts bestimmt und kann daher notwendigerweise durch einen abweichenden Zahlenwert nicht erzielt werden. In einem solchen Fall genügt es nicht, dass der Fachmann auch eine von der Zahlenangabe abstrahierende Lehre als technisch sinnvoll erkennt. Der Anmelder wird nicht immer den vollen technischen Gehalt der Erfindung erkennen und ausschöpfen; er ist auch - unbeschadet der Frage, ob ihm das rechtlich möglich ist - von Rechts wegen nicht gehalten, dies zu tun. Beschränkt sich das Patent bei objektiver Betrachtung auf eine engere Anspruchsfassung, als dies vom technischen Gehalt der Erfindung und gegenüber dem Stand der Technik geboten wäre, darf die Fachwelt darauf vertrauen, dass der Schutz entsprechend beschränkt ist. Dem Patentinhaber ist es dann verwehrt, nachträglich Schutz für etwas zu beanspruchen, was er nicht unter Schutz hat stellen lassen. Das gilt selbst dann, wenn der Fachmann erkennt, dass die erfindungsgemäße Wirkung als solche (in dem vorstehend ausgeführten engeren Sinn) über den im Patentanspruch unter Schutz gestellten Bereich hinaus erreicht werden könnte (BGH GRUR 2002, 511, 513 – Kunststoffrohrteil; GRUR 2002, 515, 518 – Schneidmesser I; GRUR 2002, 519, 522 – Schneidmesser II; GRUR 2002, 523, 525 f – Custodiol I; GRUR 2002, 527, 530 – Custodiol II).
152Nach diesen Grundsätzen scheidet eine äquivalente Verwirklichung des Merkmals 2.1.2 durch die angegriffene Ausführungsform aus. Denn dem Fachmann erschließt sich kein von 0,10 M abweichender Zahlenwert als im Sinne des anspruchsgemäßen Werts gleichwirkend. Die Beschreibung des Klagepatents verhält sich in keiner Weise zu dem Wert 0,10 M für die Konzentration der Natriumcitratlösung. Der Fachmann erkennt zwar, dass die Natriumcitratlösung die Funktion eines Gerinnungshemmers hat und ihre Konzentration für die Wirkung als Gerinnungshemmer relevant ist. Es erschließt sich aber nicht, welche Wirkung gerade der im Klagepatentanspruch angegebenen Konzentration von 0,10 M zukommen soll. Es gibt zwar Konzentrationen, die mit dem anspruchsgemäßen Wert ohne weiteres gleichwirkend sind. Dies wird auch dem Fachmann bekannt sein, genügt für sich genommen aber nicht, um solche abweichenden Lösungen in den Schutzbereich einzubeziehen. Denn es fehlt an der Erkenntnis, welche dieser abweichenden Werte mit der Konzentration von 0,10 M im Sinne der Äquivalenzgrundsätze gleichwertig sind.
153Dies gilt erst Recht, wenn die in der Klagepatentschrift genannte und bereits zitierte US-Patentanmeldung BB in die Betrachtung einbezogen wird. Diese gibt nämlich Wertebereiche an, innerhalb derer die Konzentration der Lösung auf Natriumcitratbasis ausreichend ist, um die Gerinnung der Blutprobe zu hemmen. Der äußerste Bereich wird von 0,05 M bis 0,2 M angegeben und umfasst weiter bevorzugte Bereiche bis hin zu einem optimalen Einzelwert von 0,1 M (Sp. 9 und 10 der Anlage AR-D6a). Damit bleibt die Lehre des Klagepatentanspruchs hinsichtlich der Konzentration der Natriumcitratlösung bei objektiver Betrachtung erkennbar hinter dem technischen Gehalt der Erfindung zurück. Es ist kein Grund dafür ersichtlich, warum der Klagepatentanspruch auf eine Konzentration von 0,10 M beschränkt ist. Dann aber muss sich der Anmelder/Erfinder daran festhalten lassen und beschränkt sich der Schutz auf das, was noch mit dem Sinngehalt seiner Patentansprüche in Beziehung zu setzen ist (BGH GRUR 2002, 519 – Schneidmesser II). Dazu gehört jedenfalls nicht – wie gezeigt – eine Natriumcitratlösung mit einer Konzentration von 0,109 M.
154Der Einwand der Klägerin, der in der US-Patentanmeldung angegebene optimale Wert von 0,1 M für die Konzentration der Natriumcitratlösung beruhe allein darauf, dass es sich um ein Röhrchen handele, das neben einem thixotropen Gel auch einen FICOLL-PAQUE-Gradienten enthalte, überzeugt nicht. Es ist nichts dafür ersichtlich, dass der behauptete Zusammenhang besteht. Dementsprechend bleibt die Klägerin jede Begründung für ihren Einwand schuldig. Ungeachtet dessen kommt es auch nicht darauf an, welcher konkrete Wert in der US-Patentanmeldung für die Konzentration der Natriumcitratlösung angegeben wird. Entscheidend ist vielmehr, dass das Klagepatent sich anders als die US-Patentanmeldung nicht für die Angabe eines Wertebereichs entschieden hat, sondern eines Einzelwerts. Da die mit dem Wert von 0,10 M spezifisch verbundenen Wirkungen nicht ersichtlich sind, bleibt es dabei, dass die angegriffene Ausführungsform mit einer Konzentration von 0,109 M nicht in den Schutzbereich des Klagepatents fällt.
155III.
156Der von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung beantragte Schriftsatznachlass zum Schriftsatz der Beklagten vom 09.04.2018 war nicht zu gewähren, weil dieser für die Entscheidung nicht erheblich gewesen ist. Gleiches gilt aufgrund der für sie positiven Entscheidung hinsichtlich des Antrags auf Schriftsatznachlass der Beklagten anlässlich der geänderten Anträge und des Schriftsatzes der Klägerin vom 09.04.2018 zum Schweizer Recht. Schließlich war auch hinsichtlich des nicht nachgelassenen Schriftsatzes der Klägerin vom 23.05.2018 eine Wiedereröffnung der Verhandlung nicht geboten, §§ 296a, 156 ZPO.
157C
158Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.
159Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO. Dem von der Klägerin hilfsweise geltend gemachten Vollstreckungsschutzantrag war nicht stattzugeben, da sie die Voraussetzungen des § 712 Abs. 1 ZPO weder dargelegt, noch gemäß § 714 Abs. 2 ZPO glaubhaft gemacht hat.
160D
161Der Streitwert wird auf 500.000,00 EUR festgesetzt.